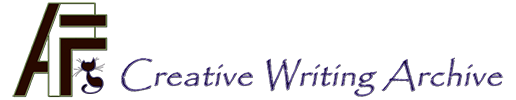Der Freak-Club (Des Desasters zweiter Teil)
Kondome für den Elternsprechtag
A/N
Zuerst einmal vielen Dank an A. e. Dezimal und Bradrukh, die Reviews zu meinen Geschichten geschriebn haben. Hat mich unglaublich gefreut! Und ich weiß genau, was Du meinst, Bradrukh, mir ist das auch schon aufgefallen, aber irgendwie hatte ich immer den Eindruck, daß diese Stellen absolut notwendig waren. Ich werde versuchen, sowas demnächst nach außerhalb der Sexszenen zu verlagern, aber ich weiß nicht, ob mir das immer gelingt. Ich habe das auch schon in diesem Kapitel versucht, bin mir aber nicht sicher, inwiefern die ganzen Informationen, die ich notwendigerweise über Maria einbauen mußte, den Fluß stören. Wenn du magst, würde mich über Deine Meinung darüber sehr interessieren.
~7~
Kondome für den Elternsprechtag
Nach nunmehr fast einer Woche am Richard Wagner Internat für Mädchen bereitete es Fantasma kaum noch Schwierigkeiten, Raum 53 zu finden, wo Emilia und Emma zusammen wohnten. Das war für sie bereits eine echte Leistung. An den ersten beiden Tagen hatte sie selbst ihr eigenes Zimmer nur mit Mühe wiedergefunden, und da das ihrer Freundinnen nicht auf ihrem Weg zum Klassenzimmer lag, sondern sie sich stattdessen sogar noch tiefer ins Innere des verwinkelten Gebäudes vorwagen mußte, verbuchte sie das als vollen Erfolg. Sonst fand sie sich in einer fremden Umgebung nur zurecht, wenn sie täglich derselben Route folgte, die natürlich möglichst einfach gehalten und nur wenige Abzweigungen beinhalten sollte. Das war in diesem alten Herrenhaus, in dem jeder der überall gleich ausgestatteten Gänge in immer neue, sich kreuzende Korridore mündete, gar nicht so einfach. Selbst in ihrer Heimatstadt, in der sie ihr gesamtes bisheriges Leben verbracht hatte, fiel es ihr schwer, an einen bestimmten Ort zu gelangen, den sie noch nie oder nur selten aufgesucht hatte, sogar wenn er sich in einer Gegend befand, in der sie sich eigentlich auskannte.
Unter diesen Voraussetzungen war es natürlich einigermaßen riskant gewesen, sich alleine auf diese Suche zu begeben, aber Isabelle war zu sehr mit einem ihrer Experiment beschäftigt, um sie zu begleiten. Nun ja, sie wollte diese Sache sowieso nicht zu einer offiziellen Clubangelegenheit machen, auch wenn sie gerade durchaus in dessen Interesse unterwegs war. Es war Freitagnachmittag, das erste Wochenende des neuen Schuljahrs hatte soeben begonnen und nachdem Fantasma zusammen mit den anderen gegessen hatte, war sie auf ihr Zimmer gegangen. Doch als sie dort auf dem Bett lag und las, während Isabelle zu nichts anderem zu bewegen war als hochkonzentriert durch ihr Mikroskop zu blicken, war ihr wieder eingefallen, daß sie ja noch einmal in die Statd wollte, um Kondome zu besorgen. Zwar hatten Nadine und Nicole sich gestern überraschenderweise doch zu dieser sehr speziellen Form einer Einweihungsfeier bereiterklärt, die Isabelle sich für sie ausgedacht hatte, trotzdem war es fraglos besser, sich für möglicherweise stattfindende Clubaktivitäten der ausgefalleneren Art vorzubereiten. Sie konnten in Zukunft wohl kaum ausschließlich Analverkehr verlangen, insbesondere wenn es um das Werben neuer Mitglieder ging – Fliegen fing man ja bekanntlich am besten mit Honig – und auf Dauer war es wohl zu unsicher, sich darauf verlassen zu müssen, daß die jeweilige Halbdämonin sich rechtzeitig zurückzog.
Als sie die Tür erricht hatte, klopfte sie kurz, dann blieb sie mit hinter dem Rücken verschränkten Händen davor stehen und wartete. Es verging einige Zeit, ehe geöffnet wurde und Emilia erschien. Ihr Gesichtsausdruck war so mürrisch wie immer, allerdings kam es Fantasma so vor als würde er sich ein wenig erhellen, als das geisterhafte Mädchen sie erblickte. Aber natürlich war es möglich, daß sie sich in diesem Punkt irrte, in Emilias Stimme jedenfalls war von dieser Aufhellung nicht viel zu bemerken.
»Hey, Fantasma«, sagte sie betont desinteressiert, »was gibt’s? Hast du was vergessen, was du vorhin beim Essen von uns wolltest?«
Fantasma beschloß, sich nicht ärgern zu lassen. Öhm, nein«, antwortete sie lässig mit den Schultern zuckend, als hätte sie die angedeutete Stichelei gar nicht bemerkt, dann sah sie auf einmal rechts und links den Korridor entlang, als würde sie Emilia nun ihr größtes Geheimnis anvertauen. Obwohl die Stimmung in der Schule mit Beginn des Wochenendes reichlich ausgelassen war, befanden sich nur wenige Schülerinnen in dieser Abbiegung des Flurs, und keine davon stand in unmittelbarer Nähe, trotzdem drückte Fantasma sich lieber etwas allgemeiner aus. »Ich wollte nur eben mal runter in die Stadt, um ein paar, äh... Clubutensilien zu holen und fragen, ob du oder Emma vielleicht Lust habt mitzukommen.«
»Tut mir leid, ich hab schon was vor«, winkte Emilia ab.
Fantasma hakte nicht nach, worum es sich dabei handelte, wahrscheinlich war sie sowieso wieder mit Maria verabredet. »Und Emma?«, fragte sie stattdessen.
»Keine Ahnung, sie ist nicht da.«
»Wo ist sie denn?«
»Hat sie nicht gesagt, aber wenn ich jemals in die Verlegenheit kommen sollte, sie suchen zu müssen, würde ich damit in der Bibliothek anfangen.«
»Oh, ja, gute Idee. Danke. Dann bis später.«
»Ja, mach’s gut«, verabschiedete sich auch Emilia, und nachdem die Tür sich hinter ihr wieder geschlossen hatte, wandte Fantasma sich um, zurück in die Richtung aus der sie gekommen war. An ihrem Zimmer ging sie jedoch vorbei, folgte dem Gang weiter bis zur Treppe und stieg sie hinab. Unten angekommen steuerte sie auf die Bibliothek zu, deren Eingang gleich hinter dem Treppenaufgang lag.
Kaum hatte sie die Glastür hinein geöffnet, war ihre Suche auch schon beendet. Obwohl es ihr auf diese Weise viel Mühe ersparte, hatte Fantasma sich das irgendwie spannender vorgestellt, wenigstens ein bißchen mehr wie in einem der Krimis, die sie sich von Emma ausgeliehen hatte, aber dort stand sie einfach, direkt vorne am Tresen bei Frau Everling, der Bibliothekarin, für alle Welt offen sichtbar.
Langsam machte Fantasma einen Schritt auf sie zu, hielt aber sofort wieder an, als sie die Vertraulichkeit zwischen den beiden bemerkte. Die Hände auf die Theke gestützt hatte Emma sich weit vornübergebeugt, sodaß ihr Gesicht nur wenige Handbreit von dem der Bibliothekarin entfernt war. Sie sahen sich fest in die Augen und lächelten.
Frau Everling war ohnehin völlig anders als die Bibliothekarin in Fantasmas Heimatstadt. Sie war noch sehr jung, höchstens 25, trug Stiefel und dazu weite Hosen sowie ein ärmelloses Top, die alle in einem ebensolchen tiefen Nachtschwarz glänzten wie ihr schulterlanges Haar. Überhaupt hatte Fantasma noch nie eine so schöne Bibliothekarin gesehen und nun stand die hier herum und starrte in Emmas wundervoll zimtfarbenen, feinfühligen Augen.
»Das klingt alles sehr interessant, Carmilla«, hörte sie ihre Freundin jetzt sagen, »vielleicht könntest du mir später mehr davon erzählen?«
Fantasmas Herz zersprang in tausende winziger Splitter, als wäre es eine Glaskugel, die zu Boden gestürzt war. Sie wußte gar nicht, was sie schlimmer finden sollte: daß die zwei sich bereits mit den Vornamen ansprachen, oder daß Emma Vorbereitungen traf, diesen Flirt in ungestörterer Umgebung fortzusetzen, denn nichts anderes war das hier, so viel stand fest. Dabei verstand sie nicht einmal, was ihr so sehr daran widerstrebte. Klar, sie empfand eine tiefe Zuneigung zu ihr, doch die fühlte sie ebenso Emilia gegenüber, aber bei ihr machte es Fantasma nichts aus, daß sie sich heute wieder wie schon in den letzten vergangenen Tagen mit Maria traf; da gäbe es doch viel mehr Grund zur Eifersucht.
Dann ging ihr plötzlich auf, was geschehen war. Als sie im Verlauf dieser Woche beide Mädchen näher kennengelernt hatte, war ihr Herz endlich zu einer Entscheidung gelangt, die bisher jedoch nicht zu ihrem Bewußtsein durchgedrungen war. Nun allerdings war es an der Zeit, sich nicht mehr länger etwas vorzumachen. Sie hatte sich eindeutig verliebt und zwar in Emma.
Leider nutzte ihr diese Erkenntnis jetzt nicht mehr viel, dazu war sie ihr einfach zu spät gekommen, denn in diesem Augenblick sagte Frau Everling: »Natürlich. Warum kommst du nicht nochmal um 18 Uhr vorbei, wenn ich schließe? Dann kann ich nochmal in Ruhe alles mit dir durchgehen.«
Während Fantasma sich noch ausmalte, welche verrufenen Sexualpraktiken Frau Everling Emma wohl in der Abgeschiedenheit der verdunkelten, abgeschlossenen Bibliothek beibringen wollte, öffnete sich plötzlich die Tür hinter ihr und knallte zum zweiten Mal in dieser Woche gegen sie, nun aber in ihren Rücken, nicht in ihr Gesicht. Überrascht stolperte sie einen weiteren Schritt vorwärts und konnte auch einen leisen Schmerzenslaut nicht unterdrücken.
»Oh, ’tschuldigung, hab dich nicht gesehen«, murmelte das Mädchen, dessen Versuch, die Bibliothek zu betreten, soeben gescheitert war.
Mit zusammengekniffenen Augen wirbelte Fantasma zu ihr herum. »Das ist eine Glastür! Da kann man durchgucken!«
»Ja, okay, schon gut, ich hab eben nicht drauf geachtet, in Ordnung? Normalerweise bleibt man nicht direkt hinter der Tür stehen.«
»Stimmt, du hast Recht, in dem Fall habe ich es natürlich verdient, einfach aus dem Weg geschubst zu werden. Ist ja meine eigene Schuld.« Es tat gut, ihren Ärger über Emma und sich selbst an der Unbekannten auszulassen, doch währte die Erleichterung dieser Ersatzhandlung nur kurz.
»Schön, daß du das so siehst, dann sind wir ja einer Meinung«, sagte die fremde Schülerin, drängelte sich an ihr vorbei und verschwand in der Philosophie-Abteilung. Nun wieder mit ihrem Frust alleingelassen sah Fantasma zu Emma und Frau Everling hinüber. Die beiden erwiderten ihren Blick in einer Art erstauntem Interesse. Wenigstens war damit das dämliche Grinsen in ihren Gesichtern erloschen, allerdings waren nun auch sämtliche Überlegungen, die Bibliothek unbemerkt wieder zu verlassen und so zu tun, als wäre nichts gewesen, auf einen Schlag hinfällig geworden. Emma hatte sie offensichtlich erkannt, sich jetzt umzudrehen und kommentarlos davonzurauschen, hätte die unangenehmen Fragen bestenfalls auf einen späteren Zeitpunkt hinausgezögert.
Somit blieb ihr wohl nur die Flucht nach vorn.
Gemächlich schlenderte sie zu den beiden herüber, als läge ihre Gefühlswelt nicht in Trümmern. »Hallo. Stör ich etwa?«
»Aber nein«, beeilte Emma sich zu sagen, »ich hab nur gerade Frau Everling...«
»Ja ja, schon gut, ich hab’s ja gesehen«, winkte Fantasma schnell ab, bevor Emma ihren Satz zuende bringen konnte. Es war schon schlimm genug, Augenzeugin dieses Annäherungsversuchs gewesen zu sein, da wollte sie die Details nicht unbedingt noch aus dem Mund des Mädchens hören, von dem ihr erst in dem Moment klargeworden war, daß sie sie liebte, in dem sie jegliche Chancen bei ihr verspielt hatte. »Was ist denn eigentlich aus Carmilla geworden?«
»Oh, du darfst mich gerne auch Carmilla nennen«, mischte sich nun die Bibliothekarin selbst ein, »ist mir sowieso viel lieber, von den Schülerinnen mit Vornamen angesprochen zu werden.«
Abschätzig sah Fantasma die hübsche Frau an. »Kann ich mir denken.«
»Ähm, was wolltest du eigentlich hier?«, warf Emma die erste Frage ein, die ihr in den Sinn kam. Auch wenn Frau Everlings Reaktion bisher nur aus einem ratlosen Stirnrunzeln bestand, befürchtete sie doch, daß diese Situation nur allzu bald außer Kontrolle geraten könnte. Die Feindseligkeit in Fantasmas Stimme war unverhohlen, nur hatte Emma nicht die geringste Ahnung, woher die so unvermittelt kam.
»Ich hab dich gesucht«, entgegnete Fantasma, nun auf einmal eher melancholisch denn abweisend. »Mia hat gesagt, daß du hier wärst.«
»Ja? Ich hab ihr doch gar nicht erzählt, wo ich hin wollte.«
»Naja, sie hat es sich eben gedacht.«
»Hm«, nickte Emma. Es war wohl tatsächlich nicht schwer gewesen, darauf zu kommen, wohin sie gegangen war. Zwar gab sich die Schulleitung offenbar Mühe, das Leben im Internat mit den Clubs und den Aufenthaltsräumen mit ihren Fernsehern und Gesellschaftsspielen möglichst abwechslungreich zu gestalten, doch für Freaks wie sie einer war, war dies der einzige in Frage kommende Rückzugsort. Nicht nur daß sie hier in Ruhe ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen konnte, ohne daß jemand sie bat, das Licht zu löschen, oder ihre Eltern sie fragten, ob sie bei dem schönen Wetter nicht vielleicht auch einmal nach draußen gehen wolle, umgeben von Büchern hatte sie sich einfach schon immer am wohlsten gefühlt. Nicht einmal an einem so schönen Freitagnachmittag wie heute, an dem die meisten der anderen Schülerinnen mit dem Bus in die Stadt fuhren, um ins Schwimmbad oder ins Kino zu gehen, konnte sie sich etwas besseres vorstellen, als genau hier zu sein. Sie liebte Bücher einfach über alles. »Und was wolltest du von mir?«
»Es... äh, es geht um eine vertrauliche Clubangelegenheit«, erklärte Fantasma mit vielsagendem Seitenblick auf Frau Everling.
»Oh, du bist in einem Schulclub?«, fragte die Bibliothekarin Emma überrascht. Damit hatte sie offensichtlich nicht gerechnet. »In welchem denn?«
Ganz schön neugierig, die Kleine, fand Fantasma, aber so war das eben, wenn man auf jemanden stand. Das war bei ihr ja nicht anders gewesen, bevor ihr Herz in blutige Fetzen gerissen worden war. Während Emma noch stammelnd nach einer Ausrede suchte, sagte Fantasma reichlich mürrisch: »Tut mit leid, aber das ist ein Geheimclub.« Sie hatte deutlich weniger Bedenken, sich bei Frau Everling unbeliebt zu machen. Sollte sie sie eben für unfreundlich halten.
»Ach so«, meinte die jedoch unbeeindruckt, »falls ihr ein ruhiges Plätzchen braucht, um zu reden, in der Bibliothek ist gerade nicht viel los.«
»Ähm, danke, Carmilla«, lächelte Emma sie unbeholfen an, »ich komm dann später noch mal vorbei, ja?« Unsicher wandte sie sich um, den tieferen Regionen der Bibliohtek zu. »Okay, suchen wir uns irgendeine Abteilung, wo sonst niemand ist«, fügte sie an Fantasma gerichtet hinzu.
»Ja, wie wär’s mit den Krimis?«, schlug die mit neuentfachtem Ärger vor, nun da Emma ihr geplantes Rendezvous mit Frau Everling vor ihren Augen noch einmal bestätigt hatte.
Emma zuckte kurz zusammen, sagte aber nichts weiter dazu, sondern führte Fantasma tatsächlich in die Krimiabteilung. Zu ihrem Leidwesen war wirklich niemand dort. Neben einem der vollen hohen Regale blieb sie stehen, drehte sich zu ihrer Freundin um und fand sich endlich bereit, sie zur Rede zu stellen. »Bist du irgendwie sauer auf mich? Hab ich was Falsches gesagt, oder so?«
»Nö, wieso? Ist doch deine Sache, was du tust.«
»Was meinst du?«
»Na, dein Treffen mit Carmilla.« Fantasma betonte den Namen nicht nur, um auf die unangemessene Intimität zwischen ihr und Emma hinzuweisen, sie bedachte ihn außerdem noch mit der nötigen Portion Angewidertheit, als handele es sich um eine ansteckende Krankheit, die einem langsam die inneren Organe verflüssigte. »Es geht mich ja gar nichts an, was ihr zwei hier nach den Öffnungszeiten so treibt. Alleine. Im Dunkeln.« Abweisend verschränkte sie die Arme vor der Brust, schaffte es aber nicht, dem Mädchen vor sich in die Augen zu sehen. Stattdessen starrte sie den Teppich zu ihren Füßen in Grund und Boden.
Endlich begriff Emma. »Oh, du denkst...« Sie mußte es gar nicht erst aussprechen; was Emma vermutete war offenkundig. Unwillkürlich errötete sie, weniger wegen der Anschuldigung an sich, so falsch sie auch war, vielmehr weil sie ihr peinlich war. Gerade Fantasma gegenüber wollte sie auf keinen Fall den Anschein erwecken, auf jemand anderes zu stehen. »So war das gar nicht! Ich...«, verteidigte sie sich auch sofort, verstummte aber schnell wieder. Natürlich hätte sie jetzt alles abstreiten und Fantasma darlegen können, wie die Verhältnisse zwischen ihr und Frau Everling tatsächlich beschaffen waren, doch befürchtete sie, daß es kaum einen Sinn haben würde. Die angespannte Haltung und der zu Boden gerichtete, funkelnde Blick machten unmißverständlich klar, daß Fantasma von Ausflüchten nichts wissen wollte. Welchen Grund hätte sie denn auch haben sollen, ihr zu glauben, daß sie Carmilla zwar sehr nett und durchaus attraktiv fand, ihre Verabredung jedoch keineswegs sexueller Natur war?
Nun gut, wenn Fantasma die ganze Wahrheit hören wollte, würde Emma ihr geben, wonach sie verlangte. Viel lieber hätte sie ihr ihre Gefühle in einem Brief gestanden, als sie improvisiert vor sich hin zu stammeln. Das hatte ihr schon immer mehr gelegen. Oft fiel es ihr schwer, so kurzfristig die richtigen Worte zu finden, sie wählte sie lieber mit Bedacht. So hätte sie auch etwas länger an Dramaturgie und Stilistik ihrer Liebeserklärung feilen können, aber sie konnte Fantasma wohl schlecht fragen, ob sie hier warten würde, während sie ihr mal eben einen Brief schrieb. Nein, falls es je einen geeigneten Zeitpunkt geben sollte, sich ihr zu offenbaren, so war er jetzt gekommen.
»Ich...«, sagte sie zum zweiten Mal, brauchte aber noch einen weiteren Anlauf, um den Satz vollständig über die Lippen zu bringen, »ich liebe dich.« Das war doch schonmal ein Anfang. Es war immer gut, einen Vortrag mit der Hauptaussage zu beginnen. Das nahm ihm vielleicht den Spannungsbogen und ein wenig der emotionalen Wucht, die eine langsame Vorbereitung geschaffen hätte, war der Verständlichkeit aber nur dienlich. Außerdem hatte sie so das Moment der Überraschung auf ihrer Seite und schuf ein Fundament, auf das sie ihre Ausführungen stützen konnte. Von Fantasma brachte ihr das zumindest ein Stirnrunzeln ein. »Schon vom ersten Augenblick an, als ich dich im Bus gesehen habe«, fuhr sie nach einer kurzen Kunstpause fort, »habe ich mich in dich verliebt. Ich kann einfach an nichts anderes denken, als an deine wunderschönen Augen.« An dieser Stelle hatte Emma sich für eine kleine künstlerische Freiheit entschieden. In gewissen Zusammenhängen hatte sie sehr wohl an einige andere, möglicherweise etwas weniger romantische ihrer Körperteile gedacht, die sie hier aber lieber nicht erwähnen wollte. Das hätte am Ende nur die Stimmung zerstört, die sie aufzubauen versuchte. »Seit ich dich kennengelernt habe, kann ich kaum noch essen, kaum noch schlafen, weil ich ständig an dich denken muß. Ich will nicht mehr ohne dich sein. Du bist alles, was ich mir je erträumt habe: süß, nett, witzig, intelligent, phantasievoll... und du verstehst mich einfach. Immer wenn wir uns unterhalten, habe ich das Gefühl, daß du genau weißt, worauf ich hinaus will, und daß du, selbst wenn du meine Ansichten nicht teilst, doch zumindest nachvollziehen kannst.«
Fantasma Arme sanken an ihrem Körper herab, als sie den Kopf hob, um Emma endlich ebenfalls in die Augen zu sehen. »Aber was ist mit Frau Everling?«
»Nichts. Ich hab mich nur mit ihr unterhalten, weil ich mich dafür interessiere, Bibliothekarin zu werden. Weißt du, eigentlich möchte ich ja Schriftstellerin werden, aber falls das nichts wird, habe ich wenigstens einen Beruf gelernt, den ich mag. Außerdem muß man ja irgendwas machen, bis man erfolgreich genug ist, und das erscheint mir als die beste Wahl. Ich hab schon immer Bibliohteken geliebt, da ist es doch eine gute Idee, in einer zu arbeiten, oder? Ich habe Carmilla dann vorgeschlagen, unser Gespräch später fortzusetzen, weil ich sie nicht von der Arbeit abhalten wollte. Ich kann ja nicht die ganze Zeit die Bücherausgabe in Beschlag nehmen.«
Bedächtig nickte Fantasma. Aus so ziemlich denselben Gründen hatte sie daran gedacht, Buchhändlerin zu werden. Doch noch waren ihre Zweifel nicht völlig dahin. »Und wie steht’s mit Mia und den anderen? Empfindest du für sie nichts?«
»Nicht dasselbe wie für dich. Natürlich mag ich sie, aber ich liebe nur dich allein. So etwas habe ich noch nie zuvor gefühlt, für kein Mädchen auf der Welt«, sagte Emma und meinte es vollkommen ernst. Selbstverständlich hatte sie sich schon zu anderen hingezogen gefühlt, ebenso wie bei ihrer Begegnung mit Fantasma, doch daß diese Schwärmerei sich von Tag zu Tag immer mehr zu einer alles verschlingenden Liebe wandelte, während sie mehr voneinander erfuhren, sodaß vor Sehnsucht ihr Herz in der Brust zu platzen drohte, war bisher noch nicht vorgekommen.
Einen Augenblick lang starrte Fantasma sie reglos an, als die Worte sich tief in ihre Seele gruben und sie mit Wärme erfüllten, dann stürzte sie sich auf einmal in ihre Arme. Sie konnte einfach nicht anders. Nachdem sie ihre gerade erst entdeckte Liebe zu Emma bereits als verloren geglaubt hatte, war deren Beichte für sie wie ein Rettungsring, den man einem Ertrinkenden zuwarf. Sie war der Fels in der Brandung ihrer stürmisch brodelnden Gefühle, und genauso klammerte sie sich auch an sie.
Nach einiger Zeit hörte Emma sie sogar unterdrückt schluchzen, als das unaufhaltsam nach draußen drängende Glück sich auf diese Weise einen Weg aus ihr heraus bahnte. Bei diesem Geräusch konnte auch Emma sich nicht länger zurückhalten. Ihre Augen waren bereits während ihres ausschweifenden Monologs feucht geworden, als sie ihre geheimsten Gedanken über ihre Angebetete preisgegeben hatte, nun jedoch begann sie endgültig zu weinen. Aber das gehörte zu wahrer Liebe wohl auch dazu, befand Emma. Ob nun aus Glück oder vor Schmerz, das kam darauf an, doch Tränen flossen in jedem Fall. So umschlungen wartete sie geduldig, bis Fantasmas leises Wimmern verebbte und sie endlich den Kopf hob.
»Und was jetzt?«, fragte sie dann, die Wangen noch immer naß und die Stimme belegt vom Ausbruch ihrer angestauten Empfindungen.
»Naja, ich denke, nach einer so bedeutenden Enthüllung wäre der Beginn eines neuen Kapitels angebracht oder wenigstens ein Szenenwechsel, damit die Ereignisse möglichst in sich geschlossen bleiben und die Neugier des Lesers aufrechterhalten wird«, versuchte Emma sich in romantischer Ironie. Dabei waren ihr Dinge wie Descartes’ Traumtheorie – die trotz dessen schlußendlicher Erkenntnis, daß zu denken auch zu sein implizierte, nicht völlig widerlegt werden konnte – sonst eher zu abgehoben. Grundsätzlich betrachtet hielt sie die Ontologie schon für eine gute Sache, nur war das nicht unbedingt ihr Metier, außerdem sagten ihr solch radikale Ansichten des Skeptizismus nicht rückhaltlos zu, aber was wußte sie denn schon, ob nicht vielleicht doch etwas dran war? In letzter Zeit jedenfalls hatte ihr Leben deutlich surrealistische Züge angenommen.
Allerdings irrte Emma sich in einem Punkt. Zwar sollte tatsächlich bald ein Szenenwechsel folgen, um dieser Entwicklung den nötigen Raum zur Entfaltung zu verleihen, doch ist zuvor noch ein Hinweis auf den weiteren Verbleib unserer Charaktere nötig, um die Übergänge zwischen den einzelnen Abschnitten flüssiger zu gestalten. Zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt, als die Erinnerungen aber noch frisch waren und sie sich mit den gesamten Geschehnissen dieses Schuljahres noch einmal eingehend auseinandersetzte, fiel ihr das selbst auf, weshalb wir dem nun auch Folge leisten.
Diese Aufgabe fiel hingegen Fantasma zu. »Vergleichst du das Leben immer mit einem Roman?«, fragte sie, ein liebevolles Lächeln auf den Lippen.
Scheu grinste Emma zurück. »Hin und wieder.«
Fantasmas warmer Blick verklärte sich noch etwas mehr. Zugegebenermaßen war das etwas, das sie selbst gelegentlich tat; zweifellos einer der vielen Gründe, warum es dazu gekommen war, daß sie sich nun auschließlich zu Emma hingezogen fühlte. »In dem Fall ist das für mich bereits das Happy End, nur daß die Figuren in einem Buch danach sich selbst überlassen werden, aber für uns fängt das Wochenende gerade erst an. Also was willst du damit anfangen?«
Diese Frage überrumpelte Emma ein bißchen. Sie hatte es immer für ziemlich unwahrscheinlich gehalten, eine feste Freundin zu finden, zumindest so bald, deshalb hatte sie sich darüber eher weniger Gedanken gemacht. Als sie jetzt genauer darüber nachdachte, fielen ihr allerdings eine ganze Menge Anliegen ein, die sie an Fantasma richten wollte: Sie könnten sich alles voneinander erzählen, ihr gesamtes bisheriges Leben, ihre Wünsche, Träume und Ängste, sie könnten sich gemeinsam ihre Lieblingsfilme anschauen, oder einfach nur stumm nebeneinander auf der Wiese hinter dem Internat liegen und in den strahlend blauen Himmel blicken, während sie die Anwesenheit der jeweils anderen genossen.
Besonders die letzte Möglichkeit erschien ihr äußerst reizvoll, doch fiel ihr plötzlich etwas ein, das sie im Taumel des gerade Erlebten kurzzeitig vergessen hatte. »Äh, hattest du mich nicht wegen einer dringenden Clubangelegenheit gesucht?«
»Oh, ja, stimmt. Aber von dringend war gar keine Rede, ich sagte ›vertraulich‹.«
»Okay, und worum geht’s?«
Obwohl sie einander sowieso noch immer umarmten und die ganze Zeit über sehr leise gesprochen hatten, sodaß sie vor etwaigen Lauschern eigentlich nichts zu befürchten hatten, näherte Fantasma sich Emmas Gesicht so weit, daß sich ihre Nasen beinahe berührten und senkte ihre Stimme zu einem kaum hörbaren Flüstern herab. »Ich wollte in die Stadt fahren, um uns ein paar Kondome zu besorgen und dich fragen, ob du nicht mitkommen möchtest.«
Natürlich war Emma nur allzu gern bereit, sie zu begleiten. Selbst wenn das nicht bedeutet hätte, daß sie mindestens eine Stunde lang nur für sich waren, kam das immerhin auch ihrem eigenen Wohl zugute. Nun da sie feste Freundinnen waren, war das nächste Mal, daß sie ihre Liebe auch körperlich zum Ausdruck bringen wollten, bestimmt nicht mehr fern. Doch Fantasmas Mund so nah an ihrem, konnte sie nicht widerstehen, sie um einen kleinen Gefallen als Gegenleistung zu bitten. »Ich komme mit, wenn du mir einen Kuß gibst.«
»Abgemacht«, erwiderte Fantasma, und noch bevor Emma sich auf ihren ersten Kuß hätte vorbereiten können, preßte sie auch schon ihre Lippen fest und zugleich unendlich einfühlsam auf die ihren.
Jetzt folgt ein Szenenwechsel, und könnte es einen schöneren Moment geben, die beiden für eine Weile zu verlassen?
~+~
Unwillkürlich den Atem anhaltend horchten die Zwillinge auf das Klingeln am anderen Ende der Leitung. Nicole hatte die Nummer auf ihrem Handy gewählt, den Lautsprecher eingeschaltet und es danach auf ihre Knie gelegt, sodaß Nadine neben ihr auf dem Bett sitzend mithören konnte. Beide zuckten zusammen, als endlich abgehoben wurde.
»Deuze, hallo?«
»Hallo, Mama«, sagte Nicole und hoffte, daß die Fröhlichkeit in ihrer Stimme ihre Nervosität überspielen würde.
»Oh Nicole, du bist das! Schön, daß du anrufst!« Während Nicole noch darüber nachdachte, daß es wohl nur eine Mutter schaffte, ihre Zwillingstöchter allein anhand der Stimme am Telefon auseinanderzuhalten, hörte sie, wie Atera über ihre Schulter hinweg nach hinten rief: »Umbra, komm schnell, es sind die Kinder!« Dann wandte sie sich offenbar wieder dem Hörer zu. »Ist Nadine denn auch bei dir, Schatz?«
»Ja«, meldete die sich selbst zu Wort, »hallo, Mama.«
Nun war auch Umbra dazugekommen. »Hallo, meine Mäuschen! Wie geht es euch?«
»Ganz gut, danke«, antwortete Nicole ausweichend, während sie überlegte, wie sie ihre Mütter am besten darauf ansprach, weshalb sie eigentlich angerufen hatten.
»Habt ihr denn schon Freunde gefunden?«
»Ähm, ja, ich denke schon. Wir haben zumindest schon einige Mädchen gefunden, mit denen wir uns gut verstehen. Wobei mir einfällt... sind wir eigentlich adoptiert?«
»Was? Wie kommt ihr denn darauf?«, fragte Atera beinahe entsetzt nach.
»Naja, ihr seid immerhin zwei Frauen, also wenn wir nicht adoptiert sind, was dann? Künstliche Befruchtung? Oder seid ihr erst nach unserer Geburt zusammengekommen?« Ein langes Schweigen entstand, in dem ihre Mütter anscheinend ihre Optionen gegeneinander abwogen: die Wahrheit erzählen oder Lügen, und falls die Wahl auf letzteres fiel, für welche sollten sie sich entscheiden? Bei diesem Gedanken beschloß Nicole, sie so weit in die Enge zu treiben, daß sie reden mußten. »Oder ist eine von euch so wie wir? Ist sie... eine Dämonin?« Ursprünglich hatte sie nicht vorgehabt, dieses Wort so voreilig zu erwähnen. Wenn sich diese Vermutung als falsch erwies, hätte sie damit nur unangenehme Fragen auf sich gezogen, doch die Befürchtung, nur vage Einwände oder, schlimmer noch, handfeste Lügen vorgesetzt zu bekommen, ließ sie solch eine verzweifelte Maßnahme ergreifen.
Glücklicherweise hatten ihre Clubkameradinnen mit ihrer Annahme jedoch nicht danebengelegen. »Oh«, sagte Umbra schlicht, »dann habt ihr es also herausgefunden?«
Wie benommen nickte Nicole, bis ihr einfiel, daß ihre Mütter das natürlich nicht sehen konnten. »Ja. Wißt ihr, wir sind an dieser Schule gar nicht die einzigen... Freaks.« Kurz lachte Nicole auf, obwohl ihr danach gar nicht zumute war. »Aber... wieso habt ihr uns nie etwas davon erzählt?«
»Naja, ihr beide wart immer so... unbedarft, so unschuldig. Wir haben es eben nie übers Herz gebracht, euch zu erzählen, daß ihr... anders seid. Wir hatten ein bißchen Angst davor, wie ihr reagieren würdet. Wir wissen doch, wie sensibel ihr seid.«
»Was absolut positiv gemeint ist!«, vergewisserte Umbra ihnen schnell. »Es ist immer gut, wenn man so einfühlsam ist wie ihr. Außerdem hat sich nie der richtige Augenblick ergeben. Wann teilt man seinen Töchtern denn schon mal mit, daß man aus einer anderen Welt stammen, und sie deshalb nie so sein können, wie alle anderen?«
»Dann stimmt es also?«, warf Nadine ein. »Wir sind tatsächlich Halbdämoninnen?«
»Ähm, also das ist eigentlich nicht ganz der passende Ausdruck.« Verwirrt sahen sich Nadine und Nicole an, doch noch bevor sie weiter nachhaken konnten, fuhr Atera auch schon fort: »Genaugenommen sind wir beide Dämoninnen, was heißt, daß ihr... ebenfalls welche seid.«
Nicole war zwar überrascht, doch schockieren konnte sie diese neue Offenbarung nicht mehr. Nachdem sie sich bereits damit abgefunden hatte, zur Hälfte eine Art Monster zu sein, kostete es sie kaum mehr Überwindung zu akzeptieren, ein vollwertiges zu sein. Ganz schlüssig waren ihr die Schilderungen ihrer Eltern jedoch nicht geworden. »Aber wenn ihr beide nicht aus dieser Welt stammt, wieso lebt ihr dann hier?«
»Das ist nicht leicht zu erklären«, setzte Umbra an, es dennoch zu versuchen. »Seht ihr, vor einiger Zeit hat eine neue Königin ihre Herrschaft im Limbus angetreten und wir waren mit ihrer Politik einfach nicht einverstanden.«
»Sie hat einfach alles erlaubt«, empörte Atera sich. Das war geradezu charakteristisch für ihre Mütter. Während Umbra sich besonnen ihre Worte zurechtlegte und dabei sorgsam darauf achtete, niemanden zu verurteilen, tat Atera ihre Meinung impulsiv kund, ohne sich groß um die der anderen zu kümmern. Vielleicht war das der Grund für ihre nicht zu übersehende Zuneigung zueinander: Sie ergänzten sich nun einmal perfekt. »Die vorigen Königinnen hatten immer vernünftige Gesetze und haben Verbrecher gerecht bestraft, aber Sinistra hat das Recht des Stärkeren eingeführt. Sie findet, wer stark genug ist, sich zu nehmen, was er will, hat es auch verdient. Wenn du mich fragst, liegt das daran, daß sie selbst die Stärkste von uns ist. Es wird diejenige Königin, die die amtierende in einem fairen Zweikampf besiegt. Seitdem muß sich jeder selbst darum kümmern, daß ihm nichts zustößt. Zwar schließt dieses völlige Fehlen von Regeln Rache keineswegs aus, sondern befürwortet sie sogar, aber das ist ja wohl nur ein schwacher Trost.«
»Aber wenn diese Königin so schlimm ist«, wandte Nadine unsicher ein, »warum tut ihr euch dann nicht zusammen, um sie zu besiegen? Und wenn dann sowieso gleich mehrere Königin sind, ist das doch ein guter Anfang, eine Demokratie einzuführen.«
»So funktioniert das leider nicht, Schatz. Wenn die Königin nicht aus eigener Kraft besiegt wird, also weil sie einfach stirbt, oder wie ihr vorschlagt, abgesetzt wird, muß ein Turnier veranstaltet werden, um eine neue zu finden, bei dem jeder, der will, mitmachen kann und die Siegerin am Ende die neue Herrscherin wird. Da würde Sinistra mit Sicherheit gewinnen, aber anders kann man es nicht machen, das ist Tradition. Außerdem stehen viele aus unserem Volk durchaus hinter diesem Erlaß. Im Grunde ist es ja auch eine schöne Idee; die absolute Freiheit. Niemand, der einem Vorschriften macht, wie man sein Leben zu führen hat, was richtig und was falsch ist, worauf man stehen darf oder nicht. Die Leute müßten nur verstehen, daß das eigene Wohlergehen nicht wichtiger ist als das der anderen. Wahrscheinlich wäre es tatsächlich die vollkommenste aller Welten, wenn jeder tun und lassen könnte, was er will, solange er nur die persönliche Freiheit aller anderen respektiert. Nur wird es leider immer ein paar geben, die sich nicht daran halten, und was soll man da machen, wenn die ohne Strafe davonkommen, bereit die nächste Untat zu vollbringen? So sehr ich es mir auch wünsche, ich fürchte, ganz ohne Gesetze geht es einfach nicht.«
Unweigerlich ergriff Nadine die Hand ihrer Schwester und drückte sie sanft. Diese Einstellung konnte sie nur allzu gut nachvollziehen. Eine Liebe wie die ihre wäre dann zumindest nicht mehr verboten. Endlich bräuchten sie sich nicht mehr zu verstellen und ihre Gefühle füreinander furchtsam zu verstecken, sondern könnten sie ganz offen ausleben, ohne Angst vor Ausgrenzung, Spott oder Schlimmerem.
»Jedenfalls wollten wir nicht, daß ihr so aufwachst«, übernahm nun Umbra wieder. »Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, uns hier niederzulassen. Wir waren der Meinung, daß ihr hier... behüteter ihr selbst sein könnt.«
»Hm«, machte Nicole nachdenklich, »aber wie funktioniert so ein Umzug in eine andere Welt denn? Habt ihr einfach all euer Zeug in einen Lastwagen gepackt und seid losgefahren, bis ihr hier angekommen seid?«
»Ähm, nein«, sagte Umbra, »nicht ganz. Um genau zu sein, haben wir Dämoninnen ein paar Fähigkeiten, die die der Menschen übersteigen.«
»Dann haben wir also doch übernatürliche Kräfte?«, warf Nadine ein. »Und ich meine damit ein bißchen mehr als irgendwelche kleine Zaubertricks«, fügte sie zur Sicherheit noch mit an.
»Nun, aus Sicht der Menschen ist das wohl so. für uns ist das etwas alltägliches, nichts anderes als Stricken oder Lesen. So wie die Menschen sich Flugzeuge gebaut haben, die wir in unserer Welt, dem Limbus, übrigens nicht haben, benutzen wir die Schatten, um von Ort zu Ort zu reisen. Das ist nichts besonderes, dazu muß man nur lernen, die Dunkelheit als stofflich zu begreifen und sie nach den eigenen Wünschen zu formen.«
»Und können wir noch mehr? Fliegen zum Beispiel? Oder wie wär’s mit dem Röntgenblick?«
»Äh, nein, tut mir leid. Soweit ich weiß, ist die einzige Fähigkeit, die uns von den Menschen unterscheidet, daß wir die Dunkelheit kontrollieren können. Aber auch damit sind eine ganze Menge Dinge unterscheidlicher Art möglich. Da sind der Phantasie kaum Grenzen gesetzt.«
»Und wie funktioniert das mit dem Reisen genau?«
»Zuerst einmal mußt du dich konzentrieren, dann solltest du irgendwann die Schatten um dich herum spüren können. Wenn du dieses Gefühl erweiterst, nimmst du plötzlich jeden Fetzen Dunkelheit des Universums wahr, bis dir auffällt, daß gleich dahinter noch mehr Finsternis darauf wartet, entdeckt zu werden. Das sind die anderen Welten. Wenn du die Dunkelheit in dir selbst mit der verbindest, die du an dem Ort spürst, zu dem du möchtest, ist es ganz einfach, dort hinzugelangen. Natürlich ist es schwieriger, je weiter entfernt das ist, und ein anderes Universum zu besuchen kostet besonders viel Kraft.« Umbra verstummte für einen Augenblick, ergriff aber schnell wieder das Wort, als ihr etwas einfiel. »Aber probiert das ja nicht ohne Aufsicht aus! Das ist gefährlich!«
»Schon gut, Mama«, sagte Nicole abwehrend, »machen wir nicht. Aber... das heißt ja dann, daß es noch mehr Welten gibt als diese und... den Limbus, richtig?«
»Unzählige«, bestätigte Atera, »aber zwischen diesen beiden scheint eine besondere Beziehung zu bestehen. Es ist ziemlich leicht, zwischen ihnen hin und her zu wechseln, viel leichter als zwischen anderen Welten, und irgendwie fühlt man sich selbst als Dämonin wohl hier, obwohl es gravierende Unterschiede gibt.«
»Aber vermißt ihr nicht manchmal eure eigene Welt?«, fragte Nadine mitfühlend.
»Doch, natürlich, schließlich ist es unsere Heimat. Das ewige Zwielicht des Himmels, vor dem sich schroffe Felsen und kahle Bäume abzeichnen, ist ein unvergesslicher Anblick, an den ich oft denken muß. Aber hier sind wir auch glücklich. Wir sind zwar vor allem hier hergekommen, damit es euch gut geht, aber so lange ihr glücklich seid, sind wir es auch.«
Wieder trat eine Zeit der Stille ein, als die Zwillinge, gerührt von diesem Bekenntnis, sich außerstande sahen zu sprechen, ohne dabei unvermeidlich in Tränen auszubrechen.
»Ihr seid uns doch nicht böse, daß wir euch das alles erst jetzt erzählt haben, oder?«, fragte Umbra letztlich mit einer Stimme so sanft und leise wie der Klang einer tragischen Melodie aus weiter Ferne.
»Nein, Mama, natürlich nicht«, schaffte Nicole es hervorzubringen. »Wir sind nur etwas... überwältigt von dem ganzen.«
»Oh, ja, das ist verständlich. Dann wechseln wir am besten das Thema. Wie läuft es denn mit der Schule? Ich hoffe, daß ihr jetzt mit so vielen Mädchen in eurem Alter zusammenwohnt, hält euch nicht vom Lernen ab.«
Lautlos unterdrückte Nicole ein Stöhnen. Das war eine weitere Eigenheit aller Eltern: Früher oder später führte jedes Gespräch mit ihnen zwangsläufig zu Fragen die schulischen Leistungen betreffend.
~+~
Währenddessen waren Fantasma und Emma durch die gesamte Stadt gelaufen auf der Suche nach einem Kondomautomaten, ohne jedoch einen entdeckt zu haben. Hätten sie auf der Herrentoilette des Bahnhofs nachgesehen, hätten sie einen gefunden, doch da das zugegebenermaßen schwierig geworden wäre, selbst wenn sie daran gedacht hätten, blieb ihnen als einzige Alternative nur noch die örtliche Apotheke.
Eine Klingel kündigte ihr Erscheinen an, als sie durch die sich automatisch öffnende Tür traten, was allerdings unnötig war. Hinter dem Tresen stand bereits ein Mann in weißem Kittel und sah ihnen freundlich lächelnd entgegen. Obwohl er noch gar nicht so alt wirkte, war sein Haar fast völlig grau, durchzogen nur von einigen wenigen Einsprengseln der früheren schwarzen Farbe. Irgendwie erinnerte er Fantasma an ihren Stiefvater. Das würde ihr Vorhaben nicht unbedingt vereinfachen, doch war es nun offensichtlich zu spät, einen Rückzieher zu machen. Erhobenen Hauptes schritt sie auf den Apotheker zu.
»Hallo, die jungen Damen«, sagte der. »Was kann ich für euch tun?«
In diesem Moment verflog Fantasmas gerade erst gesammelter Mut auch schon wieder. Das gab es doch nicht, der Mann sprach sogar wie ihr Stiefvater. »Ähm, wir wollten etwas kaufen...«, sagte sie zögerlich, mehr Zeit zu gewinnen, denn wirklich ihr Anliegen vorzutragen.
»Ja? Was denn?«
»Äh... Traubenzuckerbonbons?«
»Haben wir. Kein Problem.« Der Apotheker drehte sich um, entnahm dem hinter ihm stehenden Regal eine Tüte und legte sie vor Fantasma auf den Tresen. »Das wären eins neunundsiebzig. Darf es sonst noch etwas sein?«
»Äh, ja, irgendwas sollte ich doch noch mitbringen. Was war es denn gleich nochmal...? Ach ja, Kondome, bitte.« Zufrieden mit sich sah Fantasma den Apotheker erwartungsvoll an, doch als sie seinen Blick auf sich ruhen fühlte, beeilte sie sich hinzuzufügen: »Ich kauf die nicht für mich, sondern für einen Freund. Äh, nein! Nicht für einen Freund! Also, nicht für meinen Freund. Die sind für... äh, eine Freundin, die sich selbst nicht traut.« Wortlos sah der Apotheker zu Emma hinüber. »Äh, nein, nicht sie. Und diese andere Freundin, ach, eigentlich gar keine richtige Freundin, eher eine Bekannte, die braucht sie auch nur für den Unterricht, also für den Biologieunterricht, wissen Sie? Zum Angucken. Mehr nicht. Naja, vielleicht ziehen sie die auch über Gurken oder so, zum Ausprobieren. Keine Ahnung, ist ja nicht meine Klasse. Ich geh nicht mal auf dieselbe Schule. Jedenfalls brauchen sie die auch nur zum Üben. Für später irgendwann mal. Als Anschauungsmaterial. Ja. Genau.«
Das Lächeln im Gesicht des Apothekers war unverändert geblieben. »Und wieviele wollt ihr dafür haben? Also deine Bekannte.«
So unschuldig wie sie nur konnte, sah Fantasma ihn an. »Naja, es soll ja für die ganze Klasse reichen und vielleicht gehen ein paar kaputt... also ich würde sagen so hundert Stück.« Das sollte vorerst ja wohl genügen, sie hatte zumindest keine Lust, so schnell noch einmal hierher zu kommen und dem Apotheker zu erklären, wieso sie schon wieder eine Großpackug Kondome benötigte. Doch der schien sich gar nicht weiter über diese Angelegenheit zu wundern. Er holte einfach nur die Präservative aus dem Regal und legte sie zusammen mit den Traubenzuckerbonbons in eine weiße Tüte. Nachdem sie bezahlt hatte, schnappte Fantasma sie sich und stürmte so schnell wie möglich aus dem Laden.
Draußen angekommen atmete sie erst einmal tief durch. Dann holte sie die Traubenzuckerbonbons hervor, riß die Verpackung auf und warf sich eines in den Mund. »Auch eins?«, fragte sie Emma, ihr die geöffnete Tüte entgegenhaltend.
Doch die konnte nicht mehr länger an sich halten. Hemmungslos begann sie loszulachen.
»Was ist denn so komisch?« Mit einem verkniffenen Gesichtsausdruck steckte Fantasma die Bonbons wieder ein, während sie sich bereits den Weg die Sraße hinunter zur Bushaltestelle machte.
Noch immer kichernd eilte Emma ihr hinterher. »Du warst einfach großartig da drin«, sagte sie und meinte es trotz ihres Ausbruchs vollkommen aufrichtig. Zwar hatte Fantasma sich nicht gerade von ihrer lässigsten Seite gezeigt, doch war sie unglaublich niedlich gewesen, wie sie dem Apotheker weiszumachen versucht hatte, die Kondome seien keinesfalls für sie bestimmt und würden schon gar nicht ihrem eigentlichen Verwendungszweck zugeführt. Die endlose Folge von Beteuerungen, die sie von sich gegeben hatte, war in ihrer Hilflosigkeit schlicht liebenswert gewesen. In gewisser Weise legte diese Situation sogar die Gründe für Emmas Hingezogenheit, die sie für Fantasma empfand, überaus deutlich offen: Sie waren sich so unheimlich ähnlich. Sie beide hatten klare Vorstellungen von der Welt, wie sie beschaffen sein sollte, doch waren die schon zu oft enttäuscht worden, um noch ohne Furcht vorgetragen zu werden.
»Ja, danke«, tat Fantasma Emmas Bekundung zwar folgerichtig aber dennoch falsch auch als bloßen Sarkasmus ab, »für dich war das sicher lustig, für mich eher weniger. Außerdem hat mich der Spaß die Hälfte meines Taschengelds für diesen Monat gekostet.«
»Wenn du wilst, können wir ja zusammenlegen.«
»Schon gut, diesmal geht’s auf mich, dafür kann das nächstes Mal jemand anders erledigen. Ich glaub, nochmal steh ich das nicht durch.«
»Wie du willst. Aber wenn du die Sache mal von der positiven Seite aus siehst, hast du wenigstens auch ein paar Bonbons bekommen. À propos, wolltest du mir nicht eins abgeben?«
»Hm, inzwischen bin ich mehr nicht mehr so sicher, ob du dir das verdient hast.«
»Wieso? Ich hab’s absolut ernstgemeint. Du warst hinreißend, wirklich. Völlig bezaubernd. Aber abgesehen davon bin ich gar nicht wählerisch, ich würde auch das nehmen, das du gerade im Mund hast.«
Entgeistert starrte Fantasma sie an. »Emma! Wir sind hier mitten in der Öffentlichkeit!«
»Ich weiß«, antwortete Emma schulterzuckend, »aber das ist ja schließlich nicht verboten... naja, nicht mehr. Und dafür gibt es nicht mal wirklich eine Altersbeschränkung. Warum sollten wir uns schämen für das, was wir sind? Wir lieben uns doch, oder? Was soll daran falsch sein? Oder bin ich dir etwa peinlich?«
»Aber nein!«, rief Fantasma bestürzt. Sie konnte sich gar nicht erklären, wie Emma überhaupt auf diese Idee kam. Niemals hätte sie sich bloßgestellt gefühlt zuzugeben, daß sie nun fest miteinander gingen, war sie doch geradezu die Verkörperung all ihrer unbewußten Sehnsüchte und Wünsche. Selbst jetzt konnte sie noch gar nicht fassen, daß sie mit diesem wunderschönen Mädchen zusammen war und freute sich schon darauf, den anderen Clubmitgliedern davon zu erzählen. Doch sich hier vor dieser nicht unbeträchtlichen Menge wildfremder Leute so zu offenbaren, war etwas vollkommen anderes. Obwohl sie diese Leute vermutlich nie wiedersehen würde, war es ihr aus irgendeinem Grund unangenehm, vor ihnen ihre – anscheinend – lesbische Neigung auszuleben. Trotzdem, als sie nun in Emmas empindsamen, dunkelbraunen Augen sah, überkam sie das unwiderstehliche Verlangen, sie auf der Stelle zu küssen, hier und jetzt, völlig egal ob die Menschen um sie herum das gutheißen würden oder nicht. Zwar ließ sie ihren Blick erst noch unsicher nach links und rechts schweifen, doch dann richtete sie ihn wieder unverwandt auf ihre Geliebte, nun mit einem herausfordernden Glanz darin. »Na gut, wenn es dir nichts ausmacht... dann hol ihn dir doch.«
Ein Lächeln, irgendwo zwischen unsagbarem Glück und zügelloser Lust, erblühte in Emmas Gesicht. Ihre Reaktion fiel ungleich weniger zaghaft aus. Mit einem Mal stürmte sie vor, schloß Fantasma fest in ihre Arme und drückte den Mund auf ihren. Sofort darauf öffnete sie die Lippen und schob ihre Zunge zwischen die von Fantasma. Mit den Bemühungen, des Bonbons habhaft zu werden, ließ Emma sich jedoch Zeit; viel Zeit, in der ihre Zungen beharrlich um ihn rangen, sich stetig umeinander windend und leckend.
~+~
Zögerlich nahm Emilia die Kopfhörer aus ihren Ohren. Zwar hatte sie Fantasma nicht belogen, sie hatte heute, da Emma scheinbar den ganzen Tag über nicht in ihrem gemeinsamen Zimmer zugegen war, tatsächlich noch etwas vor, doch hatte sie diese seltene Gelegenheit, allein zu sein, bisher einzig damit zugebracht, im Bett zu liegen, die Decke anzustarren und Musik zu hören. Ihren Verstand hatte sie dabei aber nicht ausschalten können. Unablässig hatte sie nachdenken müssen, über ihre Mutter, deren Pläne und nicht zuletzt ihre eigene Pflicht.
Diesem letzten Punkt war es auch geschuldet, daß sie sich heute nicht mit Maria traf. Zwar hatte die sie am Tag zuvor, nach ihrer letzten Verabredung, noch gefragt, ob sie an diesem Nachmittag nicht wieder etwas gemeinsam unternehmen wollten, doch hatte Emilia schweren Herzens ablehnen müssen. Schließlich war es schon eine Woche her, seit sie am Internat angekommen war, zweifellos wartete Sinistra bereits ungeduldig darauf, daß sie sich endlich meldete. Zu berichten gab es allerdings kaum etwas, ihrem eigentlichen Ziel war sie währenddessen jedenfalls keinen Schritt nähergekommen. Genaugenommen war ihr nur aufgetragen worden, auf seltsame Vorgänge an der Schule zu achten und dabei besonders diese Lilly im Auge zu behalten, doch war Emilia sich ziemlich sicher, daß ihre Mutter sich nicht damit zufrieden geben würde, daß obwohl dieses Mädchen komisch aussah, ansonsten reichlich unauffällig war, und daß die einzigen besonderen Vorkomnisse darin bestanden, daß erstaunlich viele Halbdämoninnen mit ihr in eine Klasse gingen, sie aber keine Erklärung dafür habe.
Dennoch stand sie nun langsam auf, legte ihr Handy beiseite und stellte sich vor die Ecke des Zimmers, in der die Schatten der hoch am Himmel stehenden Sonne unbeschadet am dichtesten waren. Sie hatte diese Sache schon viel zu lange vor sich her geschoben, wenn sie es jetzt nicht tat, würde noch eine Woche vergehen, bis sich wieder solch ein günstiger Moment auftat, denn ihr Gespräch würde bestimmt nicht so schnell vorrüber sein. Sinistra würde in allen Einzelheiten erfahren wollen, was Lilly in ihrem Beisein von sich gegeben hatte und ob sie sonst wirklich gar nichts Seltsames bemerkt hätte. Wahrscheinlich würde sie sogar wissen wollen, zu welchen Uhrzeiten sie die Toiletten aufsuchte.
Dabei hatte sie selbst nicht einmal eine Ahnung, was das ganze sollte. Daß die Motive ihrer Mutter nicht die edelsten waren, stand wohl außer Frage. Sie hatte schon bei den verschiedensten Anlässen klargemacht, daß sie die Menschheit im allgemeinen eher geringschätzte und hatte auch nie einen besonderen Hang den gängigen Moralvorstellungen der Gesellschaft gegenüber gezeigt, aber was sollte sie denn schon schlimmstenfalls vorhaben? Selbst wenn sie den Weltuntergang herbeiführen wollte, was wäre daran so verwerflich gewesen? Früher oder später würde alles Leben auf der Erde sowieso enden, daran gab es keinen Zweifel. Dazu bedurfte es nicht einmal der unweigerlich erfolgenden Ausdehnung der Sonne zu einem roten Riesen oder der kosmichen Strahlung, die bei einer Supernova freigesetzt wird, dafür würde die menschliche Art schon selbst sorgen, oder zumindest würde sie sich zuvor selbst zugrunde richten. Dazu genügten bereits die sinnlosen Kriege, die sie ständig gegeneinander führten, und ihre Fähigkeit Waffen herzustellen, deren Notwendigkeit zur Verantwortung ihr Fassungsvermögen von Ethik bei weitem überstieg. Wenn man bedachte, wie viele Spezies sie in der kurzen Spanne ihres Bestehens ausgerottet hatten, wäre das nicht mehr als die einzig angemessene Strafe.
Die Geschichte der Menschheit war eine Geschichte der Gewalt, der Niedertracht und der Intoleranz. Es wäre nicht weiter bedauerlich, sollte sie hier und heute enden, aber was wäre dann aus Emilia, Fantasma und den anderen geworden? Waren sie nicht der Rettung wert? Selbstverständlich waren sie das, doch zum Glück würde sich diese Frage ohnehin nicht stellen. Auch wenn die Meinung ihrer Mutter in Bezug auf diese Welt nicht die höchste war, würde sie sie schon nicht ernsthaft vernichten wollen.
Ebenso wie Sinistra es ihr gezeigt hatte, konzentrierte Emilia sich auf die Schatten der Zimmerecke vor ihr und rief sich dabei genau die Beschaffenheit der Dunkelheit in deren Innern ins Gedächtnis. Das war keine erzwungene Beschwörung, wie sie wußte, damit brachte sie ihre Mutter nicht dazu, sich hier zu manifestieren, es war vielmehr eine Art Anrufung. Jede Dämonin spürte es, wenn man sich stark genug auf die einzigartige Struktur ihrer persönlichen Finsternis konzentrierte und mit dem Gedanken der eines bestimmten Ortes war es eine Bitte, sich dort zu treffen. So hatten sie es auch ausgemacht, ehe Emilia zum Internat aufgebrochen war. Auf diese Weise sollte sie sich bei ihr melden, wenn sie ungestört reden konnten. Das war nun ja wohl der Fall. So wie es aussah, verbrachte ihre Mitbewohnerin den Nachmittag mit Fantasma, und falls sie unerwarteterweise doch früher zurückkehren sollte, würde das Öffnen der Tür genug Zeit in Anspruch nehmen, um Sinistra die Möglichkeit zu bieten, rechtzeitig in den Limbus zu verschwinden, denn obwohl sie den ganzen Tag hier drinnen gewesen war, hatte sie den Raum vorsichtshalber abgeschlossen.
Jetzt blieb ihr also nichts anderes übrig, als auf die Ankunft ihrer Mutter zu warten, doch dauerte es nur einen Augenblick, bis die Schatten, die der breite Kleiderschrank an die Wand warf, begannen zu brodeln und sich zu verdichten. In einem sichtbar schwerfälligen Prozeß wurden sie immer dunkler, während sie sich in der Mitte zu sammeln schienen. Dort zogen sie sich zusammen, sich zu einem fester werdenden Umriß verbindend. Ganz allmählich, Schicht für Schicht, schälte sich eine Gestalt aus der Dunkelheit im Zentrum der Schatten. Erst bildeten sich die Knochen, ein tiefschwarzes Skelett, hinterlassen von der zurückweichenden Finsternis, die wieder zu dem Grau üblicher Schatten fanden, von dem sich der Schemen deutlich abhob. Als nächstes setzte sich Fleisch auf ihm ab, wie aus der es umgebenden Dunkelheit destilierend, wenn auch nur sehr wenig; kaum genug, um die bloßen Knochen zu bedecken. Dann kamen Muskulatur und Adern hinzu, schlangen sich um das aus der Düsternis geborene Wesen wie ein kunstvolles Netz.
Zuletzt hockte ein lebendes, atmendes Geschöpf in den Schatten, die es hervorgebracht hatten, obwohl es höchst schimärenhaft blieb. Die Beine angezogen, die Zehen gerade außerhalb der Reichweite des Lichts, saß es in der Ecke, in Dunkelheit gehüllt wie in einen Mantel. Genauso wie immer in den letzten Monaten blieb die Erscheinung allerdings unfertig. Davor war sie immer unmittelbar aus irgendeiner dunklen Ecke getreten, so erhaben und vollkommen wie es ihr zu eigen war, nun jedoch umschloß keine Haut den unvollständigen, ganz in unterschiedliche Abstufungen mitternächtlicher Farben gehaltenen Körper, der feucht schimmerte als sei er in Blut getaucht.
Bei jedem anderen hätten dieses Äußere und diese Haltung vermutlich gebrechlich gewirkt, nicht aber bei Sinistra. Trotz ihres scheinbar desolaten Zustands wirkte sie nicht weniger würdevoll als es ihr Status als Herrscherin über eine gesamte Welt gebot. »Oh, Emilia«, sagte sie, die nachtschwarzen Lippen zu einem kühlen Grinsen verzogen, als wäre es für sie eine unvermutete aber nicht unangenehme Überraschung, hier ihre Tochter anzutreffen. »Wie gefällt dir denn das Internat so?«
Emilia zuckte mit den Schultern. »Ganz gut, schätze ich.«
»Freut mich, das zu hören. Ist dir denn irgendetwas besonderes aufgefallen?«
»Naja, es gehen erstaunlich viele Halbdämoninnen auf diese Schule... allerdings weiß ich auch nicht, wie viele es überhaupt gibt. Wenn sie gar nicht so selten sind, ist das vielleicht völlig normal.«
»Wie viele sind es denn?«
»Sechs bisher, mich eingeschlossen.« Die offenliegenden, aus Schatten geformten Muskeln oberhalb Sinistras Augen verschoben sich sichtlich. In ihrer derzeitigen Verfassung entsprach das wohl einem Stirnrunzeln. Emilia entschied sich, dieses Anzeichen der Verwirrung ausnutzen, indem sie eine Frage andeutete, auf die sie bei voller Aufmerksamkeit keine Antwort hätte erwarten dürfen. »Aber ich weiß auch gar nicht, was ich hier überhaupt soll.«
»Oh, deine Noten sind nicht so gut, daß es schaden könnte, dich auf eine Schule zu schicken, an der etwas mehr Wert auf Leistung gelegt wird.«
Ein weiteres Indiz Sinistras Herrschaftswürde: Selbst wenn sie abgelenkt war, bewahrte sie uneingeschränktes Stillschweigen über jedwede Geheimnisse. Doch so leicht ließ Emilia sich diesmal nicht abwimmeln, immerhin wußte sie, daß ihre Noten nicht schlecht waren. Zwar waren sie auch nur oberes Mittelmaß, doch waren ihre beiden Mütter in dieser Hinsicht immer zufrieden mit ihr gewesen. »Ich mein’s ernst. Warum sollte ich unbedingt hierher? Was soll denn so besonderes an diesem Internat sein?«
»Das mußt du jetzt noch nicht wissen. Vertrau mir einfach. Alles, was ich tue, hat schon seinen Grund. Du vertraust mir doch, oder?«
Emilia legte den Kopf schief. Die simple Wahrheit war, daß sie das wirklich tat – oder es sich zumindest so sehr wünschte, daß sie es selbst glaubte. Immerhin war Sinistra biologisch gesehen ihr Vater, wenn sie ihr nicht trauen konnte, wem dann? Selbst wenn es tatsächlich ihr Ansinnen war, die Apokalypse zu entfesseln, würde sie doch mit Sicherheit auf das Wohlergehen ihrer Freunde und das von Amanda, ihrer anderen Mutter, achten. Wie auch immer ihr Plan aussehen mochte, bestimmt sah sie ihn als unabdingbar an für die Belange ihrer Familie. Wie hätte Emilia die Entscheidungen dieser ehrfurchtgebietenden Monarchin denn auch in Frage stellen können? Zumal sie dem Ende der Menschheit nicht einmal unbedingt mit Bedauern entgegenblickte.
»Ja«, sagte sie letztlich. »Ja, ich vertraue dir.«
»Gut.« Die Schatten auf Sinistras Stirn glätteten sich wieder und die Fäden reinster Finsternis, aus denen sich ihre Sehnen zusammensetzten, ließen das Lächeln in ihre Züge zurückkehren. »Und was ist mit Lilly? Hast du sie schon kennengelernt?«
Emilia nickte unwillig. »Wir gehen in dieselbe Klasse.«
»Sehr gut! Also, was ist mit ihr?«
Emilia verzog das Gesicht zu einer entschuldigenden Miene. »Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich hab bisher noch nicht mit ihr gesprochen und im Unterricht verhält sie sich unauffällig. Ich glaub, ich hab noch nie gesehen, daß sie sich gemeldet hätte. Es sieht fast so aus, als würde sie sich verstecken, als würde sie konsequent vermeiden, irgendeine Art von Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das einzig Interessante, was ich über sie herausgefunden habe, ist, daß sie lesbisch sein soll und angeblich mit Lisa, ihrer Mitbewohnerin zusammen ist.«
Sinistra seufzte tief; ein heiserer raschelnder Laut, wie Wind, der durch das sterbende Laub eines herbstlichen Waldes strich, ausgestossen von nur zur Hälfte materialisierten Lungen, Stimmbändern und Lippen. »Das hilft uns nicht weiter. Unterhalte dich doch einfach mal mit ihr. Versuch, ihr Vertrauen zu gewinnen! Sei immer für sie da, tu so, als würdest du sie besser verstehen als irgendjemand sonst auf der Welt, so lange, bis sie sich dir völlig öffnet.«
»Ah«, stöhnte Emilia unterdessen auf. Es war nicht so, daß Lilly ihr gänzlich unsympathisch war, nur hatte sie einige schlechte Erfahrungen mit Gruftis gemacht und sich nun gezwungenermaßen mit ihr anfreunden zu sollen, weckte bloß ihr ohnehin allgegenwärtiges auflehnendes Verhalten. Außerdem erschien ihr die Unmenge Zeit, die in Errichtung dieses von vorneherein ihrer Auflösung harrenden Verhältnisses gesteckt werden mußte, vergeudet. Viel lieber hätte sie diese Stunden mit Maria verbracht. »Ich weiß nicht. Sie macht nicht gerade den Eindruck, an einem netten Geplauder über das Wetter interessiert zu sein. Ich glaube nicht, daß wir gut miteinander klar kämen.«
»Oh, ich bin mir sicher, daß ihr beide euch sehr gut verstehen würdet, wenn ihr euch näher kennenlernt. Bestimmt habt ihr mehr gemeinsam, als du dir vorstellen kannst.«
»Das denke ich auch«, entschied Lilly sich für diesen Augenblick, um in Erscheinung zu treten. Ebenso wie es früher Sinistras Angewohnheit gewesen war, als sie Emilia und ihre Mutter noch sehr häufig und ohne Schwierigkeiten besucht hatte, schritt sie einfach aus einer schattenbehangenen Ecke heraus, ohne daß zuvor auch nur die geringste Ahnung ihrer Anwesenheit bestanden hätte. Es war unmöglich zu beurteilen, wie lange sie dort schon als lebende Finsternis gelauert hatte, ehe sie mit einem Mal Gestalt angenommen hatte. Erst bei genauerer Betrachtung fiel Emilia auf, daß dieser Teil des Raumes eigentlich gar keine Dunkelheit beherbergen durfte. Es befand sich kein Objekt zwischen ihm und dem Fenster, das ihn hätte verdüstern können.
Obwohl sie lange gezögert hatte, fortzufahren, war ihre Stimme doch fest, als Lilly es endlich tat. »Immerhin stammen wir von derselben Dämonin ab, nicht wahr, Sinistra?« Kurzerhand hatte sie beschlossen, das Monster, das für all die Schrecken ihrer sie unentwegt verfolgenden Alpträume verantwortlich war, bei ihrem wahren Namen zu nennen, schließlich war Lucy Ferria, ihre vorige Inkarnation unzweifelhaft verstorben, und Mutter würde sie sie jedenfalls nie wieder nennen.
»Oh, Lilly, wie ich sehe, hast du ein paar neue Tricks gelernt«, grinste Sinistra ohne eine Spur der Überraschung zu zeigen, geschweige denn eine Reaktion auf die Enthüllung, die in den Worten ihrer Tochter mitgeschwungen war, obwohl sie innerlich brodelte. Es kostete einige Kraft, sich auf die Präsenz eines anderen zu konzentrieren, um herauszufinden, wo diese Person sich gerade aufhielt, die sie, geschwächt von dem unvollendeten Übergang in diese Welt, nicht aufzubringen vermocht hatte. Sie hatte einfach gehofft, daß Lilly, die sich ihrer Fähigkeiten bis vor kurzem selbst nicht bewußt gewesen war, noch immer nicht dazu in der Lage war. Allerdings war sie in gewisser Weise auch stolz, daß sie, in die sie immer die größten Hoffnungen hatte, es offensichtlich ohne jede Anleitung geschafft hatte, ihr Talent so weit zu perfektionieren. In dieser Hinsicht hatte sie sich nicht geirrt. Trotz ihrer niederen Herkunft als Halbblut hatte Lilly ohne Frage das Potential, die stärkste aller Dämoninnen zu werden.
Das vielleicht mächtigste Mädchen der Welten nickte stumm. Während sie mit Lisa in ihrem gemeinsamen Zimmer gesessen und sich mit ihr unterhalten hatte, war ihr plötzlich eine merkwürdige Wahrnehmung aufgefallen, wie eine Bewegung gerade außerhalb des Sichtfeldes, das nichts anderes sein konnte als die Benutzung von Schattenkräften. Als sie dieses Gefühl ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit richtete, wurde ihr schnell klar, daß es die Anwesenheit ihrer dämonischen Mutter war, die sie spürte. Zwar war sie bei ihrem letzten Aufeinandertreffen noch nicht im vollen Besitz ihrer Gabe gewesen, trotzdem mußte sich das Gefüge derer dunklen Natur sich unbewußt tief in sie gegraben haben, zumindest würde sie dieses Muster nie wieder vergessen. Doch noch bevor Lilly sich weiter dazu äußern konnte, begann Emilia zu sprechen.
»Moment mal«, wandte sie sich an Sinistra, »was meint sie denn damit, wir stammen von derselben Dämonin ab?«
»Na, was soll das schon heißen?«, antwortete die Königin des Limbus nicht ohne einen Hauch von Arroganz. »Ich bin eben ihr Vater, genau wie ich deiner bin.«
»Dann sind wir also Schwestern?«
»Halbschwestern, um genau zu sein«, korrigierte die dahingeschiedene, noch nicht wieder ganz zur Wiedergeburt bereite ehemalige Schulleiterin. »Eure menschlichen Mütter sind nicht dieselben.«
»Richtig«, bestätigte Lilly, »und gerade weil ich meine echte Mutter geliebt habe, verstehe ich gar nicht, wie du Sinistra nur helfen kannst! Bedeutet dir deine Mutter denn gar nichts? Oder...«, grimmig sah sie dem in den Schatten aufragenden Phantom der Frau, die für die abscheulichsten Schrecknisse in ihrem Leben verantwortlich war, in die Augen, »war es bei Emilias Mutter anders? Hast du sie mit irgendetwas freiwillig geködert?«
Sinistra zog es vor, Lillys Blick mit ihrem üblichen undurchsichtigen Lächeln zu erwidern, ließ sich aber ansonsten zu keiner weiteren Reaktion herab. Im Gegensatz zu Emilia, die erneut nachfragen mußte. Eine Ahnung beschlich sie, unbestimmt zwar, doch von einem unnennbaren Grauen durchzogen. »Was... was willst du damit sagen?«
»Heißt das, du weißt davon nichts?«
»Wie Sinistra meine Mutter kennengelernt hat? Nein.«
»Ich meinte eher Sinistras wahre Natur. Weißt du... der einzige Grund für meine Geburt war, daß sie meine Mutter vergewaltigt hat.« Unwillkürlich senkte Lilly die Augen. »Und selbst ich bin nicht vor ihr verschont geblieben.« Nur durch die langen, tiefgreifenden Gespräche mit Lisa über die letzten Monate hinweg, in denen sie sich wohl instinktiv gegenseitig halfen, mit dem Erlebten fertigzuwerden, fühlte sie sich jetzt überhaupt in der Lage, diese traurige Wahrheit ihrer Halbschwester gegenüber, die sie so gut wie gar nicht kannte, auszusprechen. Ihren Körper hatte Sinistra wieder und wieder geschunden, ihre Seele aber hatte sie nicht brechen können. Natürlich hatte diese einige niemals wieder gutzumachende Schäden davongetragen – sie schlief nur selten eine Nacht durch, manchmal überfielen sie grundlos panikartige Zustände und es gab Momente, in denen sie sich selbst vor den unverfänglichsten menschlichen Kontakten ekelte – doch hatten sich die offenen Wunden inzwischen zu Narben geschlossen, die zwar nicht völlig heilen würden, aber wenigstens nicht mehr unaufhörlich schmerzten. Dennoch fiel es ihr unendlich schwer, über ihre Vergangenheit zu reden. Bekenntnisse dieser Art brachten unweigerlich Scham und eine Qual mit sich, die einem das Herz in der Brust zu Eis gefrieren ließ.
Emilia konnte noch gar nicht fassen, was ihr da soeben offenbart worden war. Sie mußte an Emmas Bericht über die Umstände ihrer Zeugung denken und ihre Verwunderung darüber, daß Sinistra als Dämonin eine liebenswerte Person sein sollte. Hatte ihre Freundin am Ende doch Recht behalten und stand sie selbst nun kurz davor, eine ähnliche Erfahrung wie die vor einiger Zeit zu machen? War sie etwa nicht mehr als das unwillkommene Produkt eines erzwungenen Akts und hatte sie sich die ganze Zeit über derjenigen anvertraut, die ihrer Mutter das angetan hatte?
Aber das konnte doch gar nicht sein. Sinistra war immer die einzige gewesen, mit der sie über alles hatte reden können, die sie so akzeptierte, wie sie eben war, ohne daß sie sich hätte verstellen müssen. Sogar Amanda hatte sie immer mit einer gewissen Zurückhaltung behandelt, so wie jemanden, den sie zwar liebte, weil es eben ihre Tochter war, doch der es dank ihrer Sonderbarkeit mit etwas Abstand zu begegnen galt. Sollte das alles nur Fassade gewesen sein? Ein hinterhältiges Vexierspiel mit dem Ziel, sie gefügig zu machen?
»Ist das wahr?«, schaffte Emilia es schließlich, ihre Zweifel in Worte zu kleiden, ihre Stimme nur ein Flüstern in der von unterschwelligen Spannungen und entgegen den Naturgesetzen vorhandenen Dunkelheit erfüllten Luft.
Sinistra verharrte weiterhin still. Was blieb ihr denn auch anderes übrig? Nur zur Hälfte materialisiert besaß sie in dieser Welt nicht mehr Substanz als die Schatten, die sie geformt hatten. Hätte sie auch nur den Finger aus ihnen heraus ins Licht gestreckt, würde er sich unvermeidlich auflösen, so wie jede andere Dunkelheit, wenn ein Schimmer sie erhellte. Für den Moment war sie an diesen beengten Flecken Finsternis gebunden, war er ihr Zuhause und Rückzugsort, wie es die Schatten für sie immer gewesen waren. Emilia als Zeichen der Vertrautheit zu berühren, kam also nicht in Frage, ebenso wie Lillys Einfluß auf sie zu unterbinden. Der unvollkommene Wechsel hier hinüber hatte ihre gesamten Kräfte bis auf weiteres erschöpft; so stand ihr höchstens noch die Flucht zurück in den Limbus offen. Natürlich hätte sie alles abstreiten können, aber was hätte das denn schon genutzt? Lilly hätte sie bloß in ein Wortgefecht verwickelt, daß diese letztendlich ohnehin für sich entschieden hätte. Die Welt liebte nun einmal ihre Opferlämmer.
Emilias Augen weiteten sich währenddessen immer weiter vor Entsetzen und Unglaube, als sich in Sinistras Züge nicht der kleinste Hinweis des Leugnens zeigte, sondern vielmehr das widerwillige Eingeständnis einer Niederlage. Bekannte sie sich damit zu der ihr vorgeworfenen Schuld? Emilia konnte es nicht fassen und wahrhaben wollte sie es erst recht nicht. Andererseits kam sie nicht umhin zuzugeben, daß diese Vorhaltungen, so peinigend sie auch waren, einen grausamen, aber nicht von der Hand zu weisenden Sinn ergaben. Hatte Sinistra nicht gerade erst in dem Vorschlag, wie sie sich Lillys Freundschaft erschleichen sollte, ihre eigene Taktik im Umgang mit ihrer Tochter verraten? War es nicht genau das gewesen, was Emilia immer für sie eingenommen hatte, dieses Verständnis, dieses Gefühl der Verbundenheit? Und nun sollte das alles nicht mehr gewesen sein als eine gemeine Täuschung, ebenso wertlos wie die flüchtigen Liebesschwüre, die irgendein schmieriger Aufreißer dahinsagte, um die Auserwählte dieses Abends ins Bett zu kriegen, schon wieder vergessen, noch ehe der nächste Morgen anbrach.
Wenn dem tatsächlich so war, ließ das auch Amandas Verhalten Emilia gegenüber sehr viel nachvollziehbarer erscheinen. Falls sie wirklich aus so einer verachtenswerten Verbindung hervorgegangen war, konnte man es ihrer Mutter wohl kaum vorwerfen, daß sie im Umgang mit ihr keine bedingungslose Hingabe gezeigt hatte. Wahrscheinlich konnte sie sie nicht einmal ansehen, ohne an dieses abscheuliche Erlebnis denken zu müssen, besonders da ihre Tortur nie aufgehört hatte, sondern noch immer andauerte. Denn auch wenn Sinistra nicht bei ihnen wohnte, und als Herrscherin des Limbus die meiste Zeit über dort war, hatte sie sie oft besucht und war dabei oft über Nacht geblieben. In diesem Zusammenhang gewann auch Amandas Alkoholkonsum und die von einer unerklärlich scheinenden Tragik erfüllten Blicke, mit denen sie manchmal minutenlang ins Leere starrte, eine ganz neue Bedeutung.
Emilia erinnerte sich noch, wie sie eines Abends, als ihre beiden Mütter gemeinsam zu Bett gegangen waren, einen dieser Blicke eingefangen hatte. Sinistra war schon im Schlafzimmer gewesen, während Amanda die Tür hinter sich zuzog. Kurz bevor sie ins Schloß gefallen war, hatte Emilia den Ausdruck in ihrem Gesicht bemerkt; die unverkennbare Erwartung eines unerträglichen Schmerzes, dem man keinesfalls entgehen konnte. Und doch hatte sie nie einen Laut aus diesem Raum dringen gehört. Was immer ihrer Mutter dort auch angetan wurde, offensichtlich hatte sie es still über sich ergehen lassen und nie ein Wort darüber verloren.
So furchtbar ihr eigenes Schicksal aber auch gewesen war, am entsetzlichsten kam es Amanda mit Sicherheit vor, zur Untätigkeit verdammt beobachten zu müssen, wie ihre Tochter in den Bann ihrer Peinigerin geriet; wie sie von ihr an der Hand geführt wurde, sich von ihr ihre indoktrinären Lebensweisheiten lehren ließ und am Ende sogar alles tat, was sie von ihr verlangte. In diesem Augenblick wurde Emilia klar, daß es doch Intrigen gab, die über die Verderbnisse der Apokalypse hinausgingen, Schicksale, die schlimmer waren als der Tod. Sklaverei zum Beispiel, das stumme Leid ihrer Mutter.
Mitten in ihre Überlegungen hinein öffnete sich plötzlich die Tür und Emma und Fantasma erschienen darin. Verständnislos sah ihre Mitbewohnerin erst zu ihr hinüber, wie sie mit vor verspäteten Tränen glitzernden Augen neben Lilly stand, einem Mädchen, das sie wohl als letztes hier vorzufinden erwartet hätte, dann zu der unheimlichen Schattenkreatur im Dunkeln und schließlich wieder zurück zu Emilia.
»Was... was ist denn hier los?«
Emilia verblieb reglos. Einen Moment lang konnte sie sich unter den fragend auf sie gerichteten Blicken ihrer Freundinnen unmöglich bewegen. Sofort darauf erfolgte allerdings ein Ausbruch, der so unerwartet kam, daß er in seiner Heftigkeit sogar sie selbst überraschte. Es geschah völlig unwillkürlich. Ohne daß sie eine bewußte Entscheidung gefällt hätte, begannen die Schatten im Raum wie ein lautloser Sturm umherzuwirbeln. Flirrende Finsternis jagte durch die Luft, ergriff herumliegende Papiere und Schulhefte, riß sie mit sich und zerrte an Kleidung und Haaren der Mädchen. Auf einmal dehnte sich die Dunkelheit explosionsartig aus, stieß Lilly zu Emma und Fantasma hinüber und schob sie zusammen zur Tür hinaus, die sich krachend hinter ihnen schloß.
Als sich die wogenden Schatten endlich legten und wieder an ihre angestammten Plätze zurückkehrten, war Emilia alleine in ihrem Zimmer. Zwar hätte Sinistra diesem Angriff sonst widerstehen können, das wußte Emilia, doch hatte sie nach dem Wechsel in diese Welt offenbar nicht mehr genug Kraft übrig gehabt, um ihre derzeitige Form aufrechtzuerhalten. Was sie nicht wußte, war, daß auch Lilly sich mit Leichtigkeit hätte widersetzen können. Sie fand nur, daß ihre Halbschwester nun einige Zeit für sich selbst benötigte und ließ es geschehen, in dem Wissen, daß Sinistra sie vorerst nicht wieder aufsuchen konnte, um sie weiter ihrem unheilvollen Einfluß auszusetzen.
Hätte Emilia das geahnt, wäre es ihr auch recht gewesen. Hauptsache, sie blieb sich selbst überlassen. Als sie vorhin in Emmas so unschuldig wirkende Augen gesehen hatte und dabei unweigerlich daran denken mußte, was ihrer beider Mütter widerfahren war, hatten sich ihre Mächte ganz automatisch Bahn aus ihr gebrochen. Sie hätte diesem bohrenden Blick einfach keine Sekunde länger standhalten können, hätte er sich doch zweifellos in eine stumme Anklage gewandelt, wenn Emma gewußt hätte, wer die düstere Gestalt gwesen war und daß Emilia sie in voller Absicht hierher gerufen hatte, um ihr alle Geheimnisse zu verraten, die sie in der kurzen Zeit am Internat herausgefunden hatte. Nun strengte sie ihre Schattenkräfte noch einmal an, um den Schlüssel in der Tür zu drehen. Sollte Lilly den anderen ruhig von ihren Verfehlungen berichten. Ihrer Erfahrung nach hätten sie sich früher oder später ohnehin von ihr abgewandt, jetzt hatten sie wenigstens eine triftige Erklärung dafür, denn auch wenn ihre Sünden eigentlich nur in Unwissenheit und Unterlassung begründet lagen, waren sie ohne Frage zu schwerwiegend, um je vergeben werden zu können.
Eine Weile blieb sie noch an Ort und Stelle stehen, unfähig sich zu rühren, dann trabte sie schwach auf ihr Bett zu und ließ sich anstandslos hineinfallen. Lethargisch vergrub sie ihr Gesicht im Kissen, in der Hoffnung, es nie wieder daraus erheben zu müssen. So blieb sie liegen, bis sie das Gefühl hatte, keine Luft mehr zu bekommen. Das war als Stafe bei weitem nicht ausreichend, aber als Selbstgeißelung immerhin schonmal ein Anfang. Als sie ihren Kopf letztlich etwas anhob – gerade weit genug, daß sie nicht erstickte – entlud sich ihr angestauter Atem in einem lauten, hemmungslosen Schluchzen.
~+~
»Moment mal«, warf Isabella ein, »was soll das denn heißen, ›Strang reinster Finsternis‹? Es gibt gar keine Finsternis! Dunkelheit ist nur die Abwesenheit von Licht.«
Leise seufzte Lilly auf. Es fiel ihr schon schwer genug, ihre Geschichte ohne unnötige Unterbrechungen zu erzählen. Nachdem Emilia sie gemeinsam mit den anderen aus ihrem Zimmer gedrängt hatte, ließ Fantasma ein unangekündigtes Clubtreffen einberufen. Sie hatten die Zwilling und Lisa abgeholt und waren dann in Fantasmas Zimmer gegangen, wo Isabelle noch immer vor ihrem Mikroskop saß. Hier wurde sie dazu auserkoren, diese rätselhaften Ereignisse zu erklären. Dazu hatte sie ein wenig ausholen müssen, angefangen vom Verhältnis ihrer Eltern zueinander, bis hin zu ihren eigenen Erlebnissen an den Tagen, kurz nachdem sie aufas Internat gekommen war.
»Ich verstehe ja, daß ihr euch dessen nicht bewußt seid, aber wir Halbdämoninnen haben die Macht, Schatten zu kontrollieren.« So war es ihr schließlich selbst ergangen. Daß Sinistra diese Kräfte besaß, hatte sie schon immer gewußt, daß sie als Halbdämonin sie ebenfalls freisetzen konnte, hatte sie hingegen erst erfahren, als es breits zu spät war. Deshalb konnte sie Isabelles Unglaube in dieser Beziehung gut nachvollziehen, gelegen kam er ihr jedoch nicht.
»Aber Schatten haben keine Materie!«, führte Isabelle weiter aus. »Selbst wenn sie nicht einfach nur das Fehlen von Licht wären, könnte man mit ihnen keine Dinge bewegen, geschweige denn einen Brustkasten durchstoßen!« Ihre Eltern hatten ihr schon früh das Geheimnis ihrer Abstammung anvertraut, irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten hatten sie aber nicht erwähnt. Vielleicht hatten sie angenommen, Isabelle habe das schon von allein herausgefunden, jedenfalls berichteten sie ihr laut eigener Aussage davon, weil sie sie für reif genug hielten, die Wahrheit zu erfahren. Außerdem sei sie so neugierig und intelligent, daß sie sie sowieso irgendwann herausgefunden hätte. All das war sie auch, in besonderem Maße sogar, trotzdem hatte sie von irgendeiner in ihr schlummernden Macht nicht einmal etwas geahnt.
»Naja«, meldete Fantasma sich zu Wort, die es kaum erwarten konnte, diese aufregende Geschichte weiter zuhören zu dürfen, »das muß wohl Magie sein. Was hast du denn von Dämonen erwartet, die aus einer anderen Welt kommen und sich hier auf irgendeine Weise manifestieren?«
»Sogar falls Dämoninnen irgendwie die Schatten kontrollieren könnten, ist das mit Sicherheit keine Magie. Das ist vielleicht deine Theorie, meine ist...« Isabelle hielt kurz inne und dachte angestrengt nach. »Okay, im Moment habe ich keine Theorie, aber das heißt nicht, daß es keine natürliche Erklärung dafür gäbe!«
Für Lilly war die Frage, ob es sich bei ihren Kräften um Magie handelte oder nicht, von geringerer Bedeutung, aber sie konnte ihren Mitschülerinnen wenigstens beweisen, daß sie tatsächlich existierten. Ohne sichtbare Mühe ließ sie einen der auf den Boden fallenden Schatten sich erheben und tippte damit Isabelle auf die Schulter. Als die sich umdrehte und den schwebenden Fetzen Dunkelheit bemerkte, kniff sie die Lippen zu einem dünnen Strich zusammen.
»Na schön, Dämonen können also die Schatten beherrschen«, brachte sie zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor, »trotzdem ist das keine Magie!« Ihre Eltern hatten ihr ja bereits erzählt, daß ihre dämonische Mutter aus dem Nimbus stammte und sich bei einer zufälligen Reise hierher in ihre menschliche verliebt hatte. Danach war sie einfach bei ihr eingezogen und so lebten sie halt als vorgeblich lesbisches Paar zusammen. Das alles hatte Isabelle leicht akzeptieren können, immerhin gab es nach der Multiversum-Theorie eine unendliche Anzahl Welten, und wäre es nicht auch vermessen gewesen zu behaupten, dies sei die einzig mögliche? Obwohl ihren Eltern im Zuge dieser Eröffnung eine Myriade Fragen gestellt hatte, war die nach dem Wechsel von einer Welt in die andere nicht aufgekommen. Es waren so viele Gedanken in ihrem Kopf umhergeschwirrt, daß dieser dabei etwas untergegangen war. Später hatte sie einfach angenommen, daß die Dämonen eine Technologie entwickelt hatten, mit der das eben möglich wurde. Doch da sich hier gerade eine Möglichkeit ergeben hatte, beschloß sie, das Versäumte jetzt nachzuholen. »Aber wenn Dämonen nur die Dunkelheit beeinflussen können, wie schaffen sie es dann überhaupt, in unsere Welt zu kommen?«
Lilly öffnete bereits den Mund, um zu antworten, doch Fantasma kam ihr zuvor. »Das ist doch jetzt egal, oder? Darüber können wir ja später noch sprechen, jetzt sollten wir uns vielleicht erstmal um diese Sache kümmern.«
Nicole, die zusammen mit ihrer Schwester hinter Insabelle stand, lehnte sich zu ihr vor. »Kein Problem«, raunte sie ihr zu, »wir haben gerade mit unseren Eltern gesprochen und da haben sie es uns erklärt. Wenn du willst, können wir es dir nachher erzählen.«
Während Isabelle ihr nickend einen dankbaren Blick zuwarf, wandte Fantasma sich wieder Lilly zu. »Also, was ist dann passiert?«
»Da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wie schon erwähnt wäre die Verletzung tödlich gewesen, weshalb Sinistra zurück in den Limbus gezogen wurde.«
»Aber Dämonen sind doch nicht unsterblich, oder?«
»Nein, sie leben nur viel länger als wir, aber wenn sie in dieser Welt getötet werden, ist das nur so, als hätten sie all ihre Kraft verloren. Dann können sie ihre Präsenz hier nicht länger aufrechterhalten und kehren in den Limbus zurück.«
»Und wie lautet deine Theorie dafür?«, lächelte Fantasma Isabelle an.
»Ich arbeite noch daran«, antwortete sie völlig ernst. Das war nur ein weiteres Rätsel der Natur, das sie zu gegebener Zeit lösen würde.
»Und dann?«, drängte Fantasma Lilly schon wieder weiter, ohne näher darauf einzugehen.
»Tja, Katrin ist ihr dann gefolgt. Weil beide in nächster Zeit nicht völlig in diese Welt wechseln können, hat Frau Flimm ihr Verschwinden der Polizei gemeldet. Es gab eine kurze Untersuchung, die aber natürlich nichts ergeben hat. Seitdem ist Frau Flimm jetzt die Direktorin.«
»Okay«, sagte Fantasma, »das erklärt aber noch nicht, was das dann eben bei Emilia war und warum diejenige ausgesehen hat...«, einen Augenblick lang suchte sie nach den richtigen Worten, um die seltsame Kreatur angemessen zu beschreiben, »wie ein halbverwester Zombie ohne Haut, der in einen Bottich schwarzer Farbe gefallen ist.«
»Äh, ich glaube, das erklärt doch schon so einiges«, versuchte Emma ihrer nunmehr festen Freundin klarzumachen. In dem ganzen Chaos, das ihrer Rückkehr ins Internat nachgefolgt war, hatten sich bisher noch nicht die passenden Umstände aufgetan, ihre gerade aufgenommene Beziehung zu verkünden, trotzdem hatte sie sich zu Beginn dieser Unterredung so dicht neben Fantasma gestellt, daß die Art, wie sich ihre Schultern berührten, einer Umarmung gleichkam. »Dieses... Ding war diese Sinistra. Weil sich ihre Kraft noch nicht ausreichend wieder hergestellt hat, konnte sie hier nicht völlig Gestsalt annehmen, sondern nur so weit, wie wir eben gesehen haben, richtig?«
Lilly, die im Laufe ihres Berichts immer weiter an Lisa herangerückt war, bis sie fast so eng beieinander waren wie Emma und Fantasma, nickte wortlos.
»Aber was wollte sie denn dann von Emilia?«, fragte Fantasma.
»Sie hat auch Emilia gezeugt.« Die eher subtile Tragweite dieser Enthüllung löste nicht unbedingt heillose Bestürzung unter ihren Zuhörerinnen aus, doch ließ die offensichtliche Verwirrung in ihren Gesichtern Lilly schnell fortfahren. »Wir haben unterschiedliche Mütter, aber bei uns beiden ist Sinistra der biologische Vater. Ich hab selbst nicht alles mitbekommen, aber so weit ich es verstanden habe, hat sie bei Emilias Mutter auch nicht erst groß um Erlaubnis gefragt, bevor sie sich über sie hergemacht hat, wenn ihr wißt, was ich meine.« In Anbetracht der deutlich gestiegenen Menge an ihr erst seit kurzem bekannten Mädchen, die sie nun umgab, drückte sie sich statt der drastischen Wortwahl, die sie Emilia gegenüber angwandt hatte, lieber etwas zurückhaltender aus, trotzdem schienen die anderen sie zu verstehen. Wahrscheinlich hatten die meisten schon ähnliche Darlegungen von ihren Müttern gehört. »Emilia hat davon aber bis eben nichts gewußt. Irgendwie hat Sinistra das vor ihr geheimhalten können, obwohl sie sich scheinbar sehr nahe standen. Emilia hat von ihr den Auftrag bekommen, mich zu beobachten. Ich denke, nachdem ihr Plan gescheitert ist, mich auf ihre Seite zu ziehen, wollte sie einfach auf dem laufenden bleiben, was ich tue, für den Fall, daß ich etwas gegen sie aushecke.«
Unmerklich schüttelte Emma den Kopf. Überall an dieser Schule wimmelte es von Halbdämoninnen, Halbschwestern und undurchsichtigen Plänen. Was für eine Seifenoper. Trotzdem erschien alles mehr oder weniger einen Sinn zu ergeben, nur eine Frage war noch offen geblieben. »Eines versteh ich aber nicht. Wieso sind überhaupt so viele Halbdämoninnen hier auf dem Internat? Und wieso haben sie alle ein Stipendium bekommen?«
»Oh, das«, sagte Lilly, den Kopf, den sie zuvor hatte sinken lassen, wieder anhebend. »Naja, einmal, als ich gerade mit Lisa gesprochen habe«, bei diesen Worten umfaßte sie sachte die Hand ihrer so dicht neben ihr stehenden Freundin, »fiel mir ein, daß es wahrscheinlich ja noch viel mehr Kinder gibt, die wie ich entstanden sind. Zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, daß alle Dämonen grundsätzlich schlecht sind und fand, man müßte diese Kinder vor ihnen schützen. Bis dahin hatte ich meine Kräfte schon weiterentwickelt und konnte Dämoninnen und Halbdämonen von normalen Menschen unterscheiden, wenn ich nahe genug bei ihnen war. Also haben Lisa und ich uns gemeinsam überlegt, alle diese Kinder hier auf das Internat zu holen, wo sie in Sicherheit vor ihnen wären. Erstens wären sie nachts nicht alleine und zweitens hätte ich es gemerkt, wenn sich eine Dämonin eingeschlichen hätte. Wir sind dann zusammen zu Frau Flimm gegangen, und sie fand die Idee ebenfalls gut. Sie hat sich auch die Sache mit den Tests ausgedacht. Mit ihr bin ich dann durch das ganze Land gefahren, um an jeder Schule diesen Test durchzuführen. So konnte ich jeder Klasse nahe genug kommen, um die Halbdämoninnen unter ihnen aufzuspüren. Jede von ihnen hat ein Stipendium bekommen, und obwohl nicht alle angenommen haben, sind jetzt doch fast alle Halbdämoninnen des Landes an dieser Schule.«
»Ah«, machte Fantasma, »dann sind in den anderen Klassen also noch mehr von uns?«
»Nein, jedenfalls nicht in den anderen siebten. Wir haben beschlossen, alle Halbdämoninnen eines Jahrgangs in dieselbe Klasse zu schicken, und jeweils zwei von euch zusammen wohnen zu lassen, damit die anderen Schülerinnen möglichst nichts merken, und falls es eine Mitbewohnerin doch herausfindet, ist sie wenigstens selbst eine Halbdämonin.«
Unwillkürlich blickten die anderen sich untereinander an bei der Erkenntnis, daß sie die einzigen ihrer Art waren, zumindest in ihrer Altersklasse.
»Na gut«, meinte Emma, »aber wieso hat dann Isabelle kein Stipendium? Sie ist doch auch eine Halbdämonin und außerdem die einzige von uns, die selbst ohne diese besondere Qualifikation eines verdient hätte.«
»Ja, das war der Grund dafür, wieso ich gemerkt habe, daß nicht alles Dämonen böse sein müssen.« Noch immer Lisas Hand haltend wandte Lilly sich Isabelle zu. »Einmal, als du gerade zur Schule gegangen bist, und bevor deine Eltern zur Arbeit mußten, habe ich sie... besucht. Ich war mit Lisa schon ein paar Mal in der Stadt gewesen, es ist ja die nächste, und dabei ist mir aufgefallen, daß dort eine Dämonin und eine Halbdämonin leben. Also habe ich mich entschieden, mal mit ihr zu sprechen. Ich weiß selbst nicht, wieso, immerhin hatte ich ja angenommen, daß sie genauso ein Monster wie Sinistra ist.«
Lisa schloß die Hand in ihrer fester ein. Sie konnte sehr wohl beurteilen, warum sie das getan hatte. Dazu kannte sie Lilly nur allzu gut. Selbstverständlich hatte sie vermutet, daß Isabelle in einer ähnlichen Situation steckte wie sie in ihrem Zuhause, vor dem Tod ihrer Mutter, der sie letztlich hierher geführt hatte. Genau deshalb war Lilly auch gegangen: Nicht weniger als die Errettung eines wehrlosen Opfers hatte sie im Sinn gehabt. Sie konnte den Gedanken einfach nicht ertragen, daß andere dasselbe durchmachen mußten wie sie.
»Als ich deine Mutter aber dann getroffen habe«, fuhr Lilly inzwischen fort, »habe ich festgestellt, wie nett sie ist, und daß deine andere Mutter offensichtlich nicht gegen ihren Willen dort war. Wir haben dann lange Zeit in der Küche zusammengesessen, Kakao getrunken und geredet. Da haben sie mir nicht nur erzählt, wie sie sich ineinander verliebt haben, und daß deine dämonische Mutter seitdem hier im Exil lebt, sondern auch viel über den Limbus und seine Bewohner, was ich selbst noch nicht wußte. Ein Stipendium war nicht nötig, weil sie schon beschlossen hatten, dich hierher zu schicken, als deine Lehrer ihnen das empfohlen hatten.«
Das meiste, was ihr bis dahin über Dämonen bekannt war, hatte sie von ihrer menschlichen Mutter erfahren. Nachdem diese noch während ihrer Schwangerschaft von Frankreich hierher geflohen war, wo ihr leider bald bewiesen wurde, daß nicht einmal diese Maßnahme ihr einen Schutz vor Sinistras Übergriffen gewähren konnte, hatte sie versucht, so viel wie nur irgend möglich über ihre Verfolgerin zusammenzutragen. In diesem Bestreben hatte sie unzählige Stunden in Bibliotheken zugebracht, Unmengen an Büchern mit mythologischem Hintergrundwissen nach einem Fünkchen Wahrheit durchstöbert, Legenden und angeblich wahre Erlebnisberichte gelesen, sowie Professoren dieses Gebiets befragt. Obwohl dabei nur wenig nützliches oder glaubhaftes herausgekommen war, hatte sie jede Einzelheit, die sie als wahrhaftig anerkannt hatte, an ihre Tochter weitergegeben. Andere Dinge hatte Sinistra ihr verraten, um sie damit gefügig zu machen, und einiges hatte sie selbst entdeckt, wie beispielsweise in einer angsterfüllten Nacht, in deren grauenerregendem Verlauf sie ein Stück Holz zwischen die Beine geschoben bekommen hatte, daß Kreuze entgegen allgemeiner Meinung nichts gegen Dämonen ausrichteten. Letztendlich hatte nichts davon sie vor dieser Heimsuchung bewahren können.
»Deshalb habe ich auch euch beide mit hergeholt«, merkte sie an Nadine und Nicole gerichtet an.
»Hm?«, entfuhr es Emma fragend. »Warum denn auch nicht?«
»Naja«, sagte Nicole entschuldigend, als sei das ein unverzeihliches Sakrileg, »wir beide sind gar keine Halbdämoninnen, sondern, ähm... richtige Dämonen.«
Zweifelnd sah Emma sie an. »Wie bitte? Ich dachte, ihr wißt es nicht?«
»Haben wir gestern auch noch nicht, aber wir haben vorhin mit unseren Eltern telefoniert, und die haben es uns gesagt.
Emma murmelte etwas unverständliches, das vielleicht ihre Freude darüber zum Ausdruck brachte, daß die Zwillinge endlich Klarheit über sich gewonnen hatten, vielleicht aber auch ihren Unmut darüber, daß es so spät geschehen war, dann senkte sich Schweigen über den Raum.
»So«, sagte Lilly schließlich fast flüsternd, wie um die Ruhe, die plötzlich eingekehrt war nicht zu stören, »wären damit alle Fragen beantwortet?«
Wie aus einem melancholischen Traum erwachend blickte Fantasma mit entrückten und doch leuchtenden Augen auf. »Ich denke schon«, meinte sie, bevor ihr auffiel, daß das nicht ganz stimmte. Ein Schicksal lag nach wie vor im Unklaren, auch wenn Lilly und Lisa das wohl nicht näher beleuchten konnten. »Was glaubt ihr, wie es Mia jetzt geht?«
Vernehmbar atmete Emma aus. »Nicht so gut, schätze ich. Sie hat heute nicht nur erfahren, daß sie eine Halbschwester hat, sondern auch daß ihre Mutter sie ihr ganzes Leben lang belogen hat. Wahrscheinlich sollten wir mal nach ihr sehen. Wer geht?«
»Du natürlich«, sagte Fantasma sofort.
»Ich?«
»Ja klar. Sie ist schließlich in deinem Zimmer. Außerdem kennst du sie am besten von uns, immerhin wohnt ihr zusammen.«
Emma setzte schon zu widersprechen an, überlegte es sich jedoch anders. So sehr sie auch fand, daß Emilia jetzt Zuspruch gebrauchen konnte, war sie äußerst skeptisch, daß sie die richtige für diese Aufgabe war. Zwar verstanden sie sich im allgemeinen ganz gut, doch war ihr Verhältnis zueinander wiederum nicht so vertrauensvoll, daß sie sich gegenseitig das Herz ausgeschüttet hätten. Allerdings waren sämtliche Vorbehalte vergessen, sobald sie nur in das Gesicht dieses bezaubernden Mädchens sah. Wie hätte sie ihr auch jemals etwas abschlagen können, war Fantasma für sie doch nicht weniger als eine Prinzessin, und somit wie es sich gehörte alleinige Herrscherin ihrer Geschicke. Für sie wäre Emma sogar in einen Käfig voll hungriger Löwen gesprungen, dagegen war es doch eine Kleinigkeit, Emilia zu stören, wenn die gerade schlechte Laune hatte. Obwohl das Ausmaß der Gefahr eigentlich vergleichbar war, würde ihre Mitbewohnerin wenigstens kurzen Prozeß machen.
»Okay, ich gehe. Aber ich möchte, daß du eines weißt.«
Eerwartungsvoll sah Fantasma sie an, blieb ansonsten aber still.
»Wenn sie mich mit Dunkelheit durchlöchert oder so, ist das deine Schuld.«
Ungeduldig schob Fantasma sie zur Tür hinaus. »Ja, schon gut, und jetzt sei brav. Wenn du lieb bist und tust, was man dir sagt, kriegst du hinterher auch eine schöne Belohnung.«
»Versprochen?«
»Ja ja, und jetzt zisch endlich ab!« Ohne das süße Lächeln zu beachten, das Emma ihr zuwarf – so unwiderstehlich es in seiner Mischung aus bedingungsloser Zuneigung und Anzüglichkeit auch war – schlug Fantasma ihr die Tür vor der Nase zu. Es dauerte aber höchstens zwei Minuten, bis sie ihr Gesicht wiedersah, jetzt jedoch ohne Lächeln.
»Und? Was sagt sie?«, fragte Fantasma, gleich nachdem Emma die Tür hinter sich geschlossen hatte.
Emma hob die Schultern. »Daß ich mich verpissen soll.« Etwas anderes hatte sie gar nicht erwartet.
»Aha. Ist das alles?«
»Nicht ganz. Sie hat mir noch ein paar Vorschläge gemacht, was ich mit mir selbst machen könnte, wenn ich das nächste Mal alleine bin, außerdem ist sie noch ein bißchen ins Detail gegangen, was sie mit mir tun würde, wenn ich nicht sofort das Zimmer verlasse. Hauptsächlich ging es dabei um ihren Fuß und meinen... ›dicken Hintern‹. Die Bemerkung Körperflüssigkeiten betreffend haben dabei den Schlußpunkt ihrer Ausführungen dargestellt.«
»Gut zu wissen«, antwortete Fantasma unweigerlich grinsend. Sie liebte Emmas Ader, sich so elegant auszudrücken, besonders da es nun mit solch übertriebenem Hochmut nicht ohne Selbstironie geschah. »Naja, vielleicht sollte ich mal nach ihr sehen.«
»Ähm, ich mag mich ja irren, aber als ich vorhin bei ihr war, kam es mir so vor, als wäre sie im Moment lieber alleine.«
»Ach, auch wenn sie es jetzt noch nicht weiß, in Wirklichkeit will sie, daß ich zu ihr komme. Sie wird mir noch dankbar sein.«
Daran hatte Emma ernste Zweifel, behielt sie aber für sich. Sie nahm an, wenn es irgendjemand schaffte, Emilia aus ihrem Zimmer zu bewegen, so war es Fantasma. »Wenn du meinst«, gab sie nach und hielt ihr ihren Schlüssel hin. »Nimm den lieber mit für den Fall, daß sie wieder abgeschlossen hat.«
»Danke.« Als Fantasma den Schlüssel einsteckte, versank sie für eine Weile, ohne daß sie es hätte verhindern können, in Emmas liebevollen braunen Augen, dennoch brachte sie es irgendwann zustande, sich ihrem Bann zu entziehen und wandte sich zur Tür. »Bis gleich«, sagte sie noch, während sie öffnete, dann war sie auch schon fort.
Sobald sie das Zimmer verlassen hatte, sah Emma sich nach den anderen um. Die Gelegenheit war günstig, niemand achtete auf sie. Lilly und Lisa, ihre Hände noch immer sanft einander umfassend, blickten in die Richtung, in die Fantasma entschwunden war, als könnten sie sie durch die Wand hindurch sehen, während die Zwillinge in eine ihrer unausgesprochenen Unterhaltungen vertieft schienen. Also stellte sie sich mit dem Rücken dicht vor Isabelle hin und flüsterte ihr über die Schulter hinweg zu: »Jetzt sei mal ehrlich, findest du meinen Hintern dick?«
Während Isabelle noch ebenso überrascht wie bewundernd das überaus reizvolle Hinterteil vor sich begutachtete, erreichte Fantasma ihr Ziel. Sie klopfte an, und obwohl das zugegebenermaßen verhaltener erklang, als sie beabsichtigt hatte, war es doch so laut, daß es auf der anderen Seite hätte gehört werden müssen. Eine Antwort blieb dennoch aus, genaugenommen war nicht die geringste Reaktion wahrnehmbar. Nichts regte sich hinter der geschlossenen Tür; kein Geraschel von Kleidung drang hindurch, noch die leiseste Andeutung von Schritten. Nach einer ihr angemessen erscheinenden Weile des Abwartens versuchte sie es mit der Klinke, doch war, wie Emma ganz richtig vermutet hatte, abgesperrt. Es blieb ihr also nichts weiter übrig, als den Schlüssel hervorzuholen und sich selbst Einlaß zu verschaffen.
Als sie das getan hatte und die Tür aufstieß, erstreckte sich der Raum dahinter in Zwielicht. Vorsichtig trat sie ein, wie es eben der Fall ist, wenn man nicht weiß, was einen erwartet. Die Vorhänge waren zugezogen, doch konnten sie das Licht der Sonne, die nun am späten Nachmittag ihre Strahlen mit allem ihr zur Verfügung stehendem Ungestüm entsendete, nicht völlig ausschließen. Zunächst war Emilia nicht zu entdecken, erst als sich ihre Augen an die dämmrigen Verhältnisse gewöhnt hatten, machte Fantasma ihre Umrisse auf dem Bett aus. Es wirkte ganz so, als habe sich ihre Vorstellung, die sie bei ihrer ersten Begegnung überkommen hatte, nun verwirklicht: Auf dem weißen Bettzeug liegend, Haar und Kleid in derselben Farbe, verschwand das blasse Mädchen fast darin. Regungslos lag sie auf dem Bauch, den Kopf der Wand zugedreht, sodaß ihr Gesicht nicht zu sehen war.
»Hi«, sagte Fantasma leise, »was machst du gerade?«
»Ich überlege, woher sich wohl das Wort ›Etymologie‹ ableitet«, behauptete Emilia noch immer ohne sich zu bewegen, die Stimme heiser und gedämpft.
Fantasma hatte keine Ahnung, was Etymologie bedeutete, aber das mußte sie auch nicht, um zu wissen, daß es sarkastisch gemeint war. Sie wertete das als gutes Zeichen. Normalerweise war diese Art von Humor ja eher weniger Ausdruck von Heiterkeit, bei Emilia gehörte das jedoch schlichtweg zu ihrem Wesen. Daß sie nun darin zurückfiel, konnte nur bedeuten, daß es ihr wieder besser ging. Langsam ging sie näher auf das Bett zu, in dem ihre Klassenkameradin lag, weiterhin auf plötzliche Ausrufe der Zurückweisung gefaßt, war aber nun guter Hoffnung, daß sie es ohne Beschimpfungen zu ihr hin schaffte. Nachdem sie tatsächlich ohne derlei Widrigkeiten dort angekommen war, ließ sie sich davor mit angezogenen Knien nieder. Den Rücken an das Gestell gelehnt hockte sie da, die Wand gegenüber betrachtend. Selbst wenn Emilia anscheinend ihre Anwesenheit hinnahm, sich ihr zugekehrt hatte sie deshalb noch lange nicht, und Fantasma hatte wenig Lust, sich mit deren Hinterkopf zu unterhalten. Da beließ sie es lieber dabei, daß sie in einander gegengesetzte Richtungen blickten. Die Knie mit den Armen umschlungen, den Kopf auf sie gestützt, studierte sie ebenso still das Muster der Tapete wie Emilia hinter ihr, während sie darüber nachdachte, was sie sagen sollte.
»Und... wie geht es dir?«, war das beste, was ihr in der kurzen Zeit eingefallen war. Das war zwar nicht gerade originell noch besonders ausgeklügelt, doch hatte sich diese Phrase wohl nicht umsonst als Klischee etabliert. Diese Frage war für gewöhnlich leicht zu beantworten, eignete sich hervorragend als Gesprächseinstieg, um von dort auf andere Themen zu sprechen zu kommen und man tendierte automatisch dazu, sie dahingehend zu beantworten, daß es einem eigentlich ganz gut ginge, selbst wenn es nicht wirklich stimmte – und wenn man es erst einmal laut vor sich hingesagt hatte, fiel es einem leichter, selbst daran zu glauben.
Trotzdem mußte Fantasma lange auf eine Erwiderung warten, denn der Sturm der Gefühle, der von Emilia Besitz ergriffen hatte, war keineswegs so genau einzuordnen wie bei den meisten anderen Menschen. Dieses Chaos war unmöglich zu beschreiben, und im Grunde wußte sie nicht einmal, wie sie sich hätte fühlen sollen. Schuldig natürlich und reumütig, kein Zweifel, doch wußte sie, daß das nicht annäherend genug war. Nichts würde das Unrecht, für das sie verantwortlich war, je ungeschehen machen können, weder das Leid, das ihre Mutter ihretwegen hatte erdulden müssen, noch den Verrat, den sie an ihren Freundinnen begangen hatte.
»Mies«, faßte sie schließlich alles in einem Wort zusammen.
Fantasma hob den Kopf von ihren Knien und sah zur Decke hinauf. »Ich weiß, wie du dich fühlen mußt. Es ist schrecklich zu erfahren, so entstanden zu sein. Das hab ich ja selbst durchgemacht. Klar, bei dir ist das noch schlimmer, ich weiß. Du hast sie ja oft gesehen und ihr immer vertraut, ich hab meinen Vater dagegen glücklicherweise nie kennengelernt.«
Natürlich, das trug ebenfalls zum Elend ihrer ganzen Existenz bei, doch verblaßte es neben den anderen Katastrophen, die dieser Nachmittag enthüllt hatte. Die Erkenntnis alleine nährte lediglich ihre eigene Trauer, viel entsetzlicher jedoch war die Tatsache, daß es Amanda wirklich zugestoßen war, ganz zu schweigen von ihren eigen Verfehlungen. »Das ist es nicht... nicht nur.«
Über die Schulter lugte Fantasma hinter sich zu Emilia hinüber. »Was denn dann? Wir können doch über alles reden. Wir werden immer zu dir stehen.«
Ruckartig drehte Emilia den Oberkörper zu ihr herum, sodaß Fantasma zum ersten Mal, seit sie das Zimmer betreten hatte, das Gesicht ihrer Freundin sehen konnte. Es war noch immer naß und die Augen gerötet von den Tränen, die sie zweifellos vergossen hatte. »Ihr steht immer zu mir?«, rief sie schnaubend aus, wobei unklar blieb, ob das daran lag, daß ihre Stimme belegt war, oder ob es verächtlich gemeint war. »Hat Lilly euch denn nicht erzählt, was ich getan habe?«
»Doch. Alles, was sie wußte.«
»Na also. Durch meine Schuld ist meine Mutter... also, mußte sie weiter auf sich nehmen, was... meine andere Mutter ihr angetan hat. Und der einzige Grund, warum ich überhaupt an diesem Internat bin, ist, euch auszuspionieren!«
»Wieso durch deine Schuld? Du wußtest davon doch gar nichts, oder?«
»Nein. Trotzdem, ich hätte es wissen müssen! Ich hätte irgendwas dagegen tun müssen!«
»Ich versteh dich ja, aber glaub mir, du hättest nichts tun können. Keiner hätte das, solange niemand Bescheid weiß.«
»Aber ich habe euch die ganze Zeit belogen! Ich wollte gar nicht hierher! Ich bin nur hierher gekommen, weil Sinistra Lilly unter Beobachtung halten wollte. Ich war nur hier abgestellt, um alles zu melden, was mir irgendwie komisch vorkommt.«
Fantasma bemerkte dieses seltsame Beharren auf der eigenen Schuld und erkannte es als das, was es war: als Zeichen ehrlichen Bedauerns. Offensichtlich war Emilia der Ansicht, daß einem ohne wie auch immer geartete Form der Sühne keine Vergebung zuteil werden konnte. Doch Fantasma war nicht dazu erzogen worden, dieser selbstzerstörerischen Ausprägung der Genugtuung nachzukommen. Langsam löste sie die Arme von ihren Knien und drehte sich vollends zu ihrer Gesprächspartnerin um.
»Ich weiß«, bestätigte sie Emilias Befürchtungen und Hoffnungen gleichermaßen, »trotzdem verzeihen wir dir. Wir wissen doch, daß du es nicht absichtlich getan hast... oder nicht böse gemeint hast. Manchmal fällt es einem schwer, die richtige Entscheidung zu treffen, und manchmal hat man nicht einmal eine Ahnung, was überhaupt die richtige Entscheidung ist. Niemand ist perfekt, erst recht nicht wir Freaks. Und... du bist immer noch Mit-Glied.«
Trotz der ernsten Umstände konnte Fantasma ein leichtes Grinsen nicht unterdrücken, doch möglicherweise war das gut so. Noch war Emilia nicht überzeugt, aber immerhin setzte sie sich jetzt auf und betrachtete Fantasmas warme, lächelnde Miene. Konnten ihre Freunde ihr tatsächlich vergeben? Einen so heimtückischen Verrat nicht nur an ihnen, sondern sogar an der eigenen Mutter? War es doch noch möglich, Absolution zu erlangen von Sünden dieses Aumaßes?
»Wirklich?«, fragte sie mit so leiser Stimme, wie nur die tiefste Angst vor weiteren Seelenqualen sie herabsenken konnte.
»Aber ja.«
Erneut sammelten sich Tränen in Emilias Augen, doch weigerte sie sich, ihnen freien Lauf zu lassen. »Und was ist mit den anderen? Wie soll ich mich ihnen gegenüber denn jetzt verhalten? Ich werd ihnen doch kaum in die Augen sehen können.«
»Die anderen denken genauso wie ich. Und meine Mutter sagt immer, es ist das beste, einfach man selbst zu sein.«
»Du hast gut reden, du bist ja auch nicht ich.«
Befreit kicherte Fantasma auf. »Siehst du? Nichts hat sich geändert. Du bist immer noch dieselbe wie vorher und genauso haben wir dich auch gemocht. Also los.« Bevor Emilia sich hätte wehren können, ergriff sie deren Hand und zog sie mit sich vom Bett und Richtung Tür. »In meinem Zimmer findet gerade ein Clubtreffen statt, und für dich als Mitglied besteht Anwesenheitspflicht!«
Emilia zierte sich, aber nur gerade so viel wie nötig, um nicht ihre unbändige Freude zu offenbaren. Es tat gut, von Fantasma an der Hand gehalten zu werden. Die sanfte Berührung war fast so beruhigend wie eine Umarmung, sodaß sie sich von ihr hinaus und, nachdem Fantasma die Tür wieder verriegelt hatte, den Flur entlang führen ließ. Es wurde erst wieder unangenehm, als sie das Zimmer erreichten und Emilia die anderen, insbesondere ihre Schwester, wiedersah. Fantasma hatte kein Erbarmen gezeigt und sie ohne weiteres in die Mitte des Raumes gezerrt, wo sie unmittelbar Lilly gegenüberstand, umringt von den übrigen Mitschülern, die in ihre Geheimnisse eingeweiht waren. Es kostete sie einiges an Überwindung, ihre Augen zu heben und in die ihrer Schwester zu blicken. Es ergab sich ein äußerst unwirklicher Moment, als die beiden sich unverwandt anstarrten; auf der einen Seite Lilly mit ihrem schwarzen Kleid, schwarzem Haar und den eisgrauen Augen, auf der anderen Emilia mit weißem Keid, weißem Haar und verschiedenfarbigen Augen, das linke blau, das rechte grün. Das einzige, was sie verband, war die blasse Haut und ein Blick, der so kühl war, daß er die Flammen der Hölle hätte ersticken können.
So faszinierend Fantasma dieses Bild auch fand, sie konnte es einfach nicht mitansehen, wie sich einander abschätzend musterten. Immerhin waren sie doch Schwestern, die sich erst nach so langer Zeit überhaupt kennenlernten. Auch wenn sie unterschiedliche Mütter hatten, sollte dieses Treffen ihrer Meinung nach anders ablaufen. »Jetzt umarmt euch schon!«, rief sie den beiden still dastehenden Mädchen zu. Emilia blinzelte sie finster an, doch das beachtete sie gar nicht weiter. »Umarmung! Umarmung!«, skandierte sie einen Sprechchor anstimmend, während sie im Takt mit den Händen klatschte, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, daß man sie wahrscheinlich noch drei Zimmer weiter hörte. Es dauerte nicht lange, bis die übrigen Clubmitglieder anfeuernd miteinfielen. Berdängt von so vielen Ermutigungen gaben sie letztlich nach. Es folgte noch ein kurzes unsicheres Zögern, dann fielen sie einander in die Arme. Wie nicht anders zu erwarten war es keine unnachgiebige hochemotionale Umklammerung, die sie verband, sondern eher eine unbehagliche ungelenke Annäherung, und obwohl sie recht bald wieder voneinander zurücktraten, beide sichtlich peinlich berührt, brach sie doch das Eis.
Die umstehenden Anvertrauten klatschten und jubelten als sei das die ergreifendste Darbietung einer Familienzusammenführung, der sie je hatten beiwohnen dürfen. Als der Lärm endlich verebbte, fanden sich alle in einem Kreis sitzend am Boden ein, wie es bei ihren Clubtreffen inzwischen üblich geworden war. Sowohl Lilly als auch Emilia kamen nicht umhin, ihre Vergangenheit erneut in allen Einzelheiten vorzutragen, wobei sie sich gegenseitig ergänzten und mit Hilfe einiger Einwürfe von Lisa einen ziemlich genauen Eindruck ihrer gemeinsamen dämonischen Mutter und ihrer jeweiligen Lebensumstände vermittelten.
Danach geriet ihr Beisammensein zu einer regelrechten Beichte, in der jedes der Mitglieder ausführlich seine Vorgeschichte und das Umfeld seines Zuhauses beschrieb. Fantasma schaffte es dabei sogar, ihre Beziehung mit Emma öffentlich bekanntzugeben, worauf sie lange genug hatte warten müssen. Allerdings überraschte diese Nachricht niemanden mehr; dazu war ihr Herumgeturtel in den letzten Stunden zu auffällig gewesen. Emma und Lisa hingegen stellten fest, daß sie beide aus Grünberg stammten, einer kleinen Stadt mitten im Nirgendwo und sogar dieselbe Schule besucht hatten, das Heinrich Heine-Gymnasium, sich aber vorher nie bewußt begegnet waren, da sie in zwei parallele Klassen eingeteilt worden waren.
Solche Trivialitäten entgingen Emilia aber größtenteils. Sie war noch immer mit der Rolle beschäftigt, die Maria in diesem Drama gespielt hatte – oder vielmehr damit, daß sie überhaupt darin vorgekommen war. Sie wußte also nicht nur von der Existenz von Dämonen, laut Lilly war ihr sogar Emilias eigene Herkunft bekannt, und zwar einschließlich der Gegebenheit, daß Sinistra ihre Mutter war. Trotzdem hatte sie sich mehrmals mit ihr getroffen und wenn ihr Gefühl in dieser Hinsicht sie nicht wieder einmal getrogen hatte, begann Maria darüber hinaus sich mit ihr anzufreunden. Emilia war nicht ganz klar, was sie damit bezweckte. Nein, ehrlich gesagt tappte sie völlig im Dunkeln. Maria wußte doch ganz genau, von was für einem Monster sie abstammte, schließlich hatte sie mit eigenen Augen gesehen, wozu Sinistra imstande war, wie um alles in der Welt konnte sie das dann nur tun?
Andererseits hatte Lilly erzählt, daß Maria trotz der schrecklichen Ereignisse, in die sie alle verwickelt waren, für Lisa und sie selbst ebenfalls eine Freundin geworden war. Es hatte damit angefangen, daß sie kurz danach zu ihnen gekommen war, um sich zu entschuldigen. Emilia erkannte sofort, daß dieser Akt der Vergebung beiden Seiten nicht leichtgefallen sein mußte. Ihrer Meinung nach hatte Maria nichts Falsches getan; sie hatte der Schulleiterin bloß gemeldet, daß ihre neue Mitbewohnerin in Wirklichkeit gar kein Mädchen war – zumindest nicht im herkömmlichen Sinne – und im übrigen nur deren Anweisungen befolgt. Die hatten Lilly und Lisa zwar unendliches Leid bereitet, doch dafür konnte Maria nichts, fand Emilia. Was hätte sie auch sonst tun sollen?
Vielleicht waren die eigentlichen Opfer dieser Vorgänge ebenfalls zu diesem Schluß gelangt, jedenfalls hatten sie ihr, als sie mit ehrlichem Bedauern in den Augen bei ihnen um Verzeihung bat, sie ihr gewährt. Der Prozeß, der darauf folgte, hatte sich als langsam und sukzessiv erwiesen, aber auch als ebenso befreiend wie schmerzhaft. Aus irgendeinem Grund hatten sie sich immer öfter zusammen eingefunden, um etwas zu unternehmen. Letztendlich schweißt einen eine Erfahrung, die man gemeinsam durchsteht, eben zusammen, und mit wem hätten sie denn schon offener reden können als miteinander? Ihre größten Geheimnisse waren ihnen ja bereits bekannt, da stellte es kaum noch ein Problem dar, auch ihre geringeren zu teilen.
Als jede ihr Bekenntnis abgelegt hatte, wurde die Stimmung schlagartig säkularer. Nachdem sie zuvor trotz der teilweise ernsten Themen, die sie behandelt hatten, eher ausgelassen gewesen war und sie viel gescherzt und in Erinnerungen geschwelgt hatten, war es nun, als würden sie mit einem Mal von der Gravitation gepackt und zurück auf die Erde geholt werden. Ohne daß sie deshalb weniger fröhlich geworden wären, wurde ihnen doch allen bewußt, daß ihr schwebeartiger Zustand nun vorüber war und sie wieder zurück in der Realität angekommen waren.
Das war also genau der richtige Augenblick, um sich wieder profaneren Bedürfnissen zuzuwenden, sodaß Nadine sich kurz entschuldigte, um die Toiletten aufzusuchen. Vorher wurde noch schnell beschlossen, daß sie sich danach um die anstehenden Clubangelegenheiten kümmern würden – Fantasma erwartete weiterhin von jedem einen Vorschlag zur Verbreitung der Toleranz – dann war sie entlassen. Zurückgekehrt von dieser dringend benötigten Pause starrte sie völlig entgeistert ihre Schwester an, als ihr Blick auf sie fiel.
»Wie hast du es denn vor mir zurückgeschafft?«, fragte sie fassungslos.
Nicole sah sie nicht minder überrascht an. »Was meinst du?«
»Na, du warst doch vorhin auf der Toilette und...«
»Was ›und‹?«
Unsicher ließ Nadine ihren Blick über die Reihe der Halbdämoninnen hinwegschweifen. Es war immer noch etwas unangenehm, vor anderen über solche Dinge zu sprechen, aber immerhin hatte sie vorhin noch praktisch ihre gesamte Privatsphäre vor ihnen ausgebreitet, es gab also keinen Grund, sich vor ihnen zu schämen. Außerdem war diese Angelegenheit viel zu verwirrend, um sie zu verschweigen. »Naja, du hast mir doch da einen geblasen!«
Fantasma brach in ihr typisches unbeschwertes Kichern aus. »Und da halten die Leute mich für eine Träumerin! Bist du vielleicht, ähm... mittendrin eingeschlafen? Nicole war die ganze Zeit hier.«
»Etwa durch so ein Loch in der Wand?«, fragte Isabelle plötzlich ganz aufgeregt Nadine.
Während die noch verwundert nickte, fuhr Fantasma dazwischen: »Ach so! Das hat Dienstag Abend auch jemand bei mir gemacht! Ich dachte, Emma wäre es gewesen.«
»Bei mir war’s vorgestern«, sagte Emma kopfschüttelnd. »Und ich dachte, du wärst es gewesen.«
»Ich?«, wehrte Fantasma ab. »Warum sollte ich auf dem Klo warten, bis du vorbeikommst, nur um dir einen zu blasen?«
»Keine Ahnung. Warum sollte ich denn sowas tun?«
Den Kopf gesenkt sagte Nicole nachdenklich: »Bei mir hat’s auch jemand gemacht. Gestern Nachmittag, gleich nach unserem, ähm... ersten Clubtreffen. Ich dachte...« Ihr blick streifte Isabelle und errötend verstummte sie.
»Wartet mal kurz«, warf Emma ein, »wenn es keiner von uns war, bleibt nur noch...«
Alle richteten ihre Aufmerksamkeit auf Emilia, die jedoch abwehrend die Hände erhob. »Hey, was guckt ihr mich alle so an? Ich hab gar keine Ahnung, wovon ihr überhaupt sprecht. Mir hat auf dem Klo bisher noch niemand einen Antrag gemacht.«
Lilly hingegen stockte der Atem. Sie hatte erst heute kurz nach Mittag ein Mädchen auf dieselbe Weise befriedigt. Selbstverständlich hatte sie angenommen, daß es Lisa gewesen war. Wer hätte es denn auch sonst sein sollen? Es entsprach ganz ihrem Humor und ihrer impulsiven Art, auf so eine sonderbare Idee zu kommen, und obwohl sie selbst sich in dieser Hinsicht keinesfalls beschweren konnte und auch Lisa stets glücklich schien, hatte Lilly vermutet, daß sie so vielleicht etwas mehr Abwechslung in ihr Liebesleben bringen wollte.
Aber jetzt konnte sie es unmöglich gewesen sein, hatte sie doch die ganze Zeit neben ihr gesessen. Wenn Lilly sich so umschaute, waren nur zwei Personen nicht anwesend, denen die besonderen Eigenschaften dieser Gruppe von Mädchen bekannt war. Sie hatte auch schon einen Verdacht, um wen von ihnen es sich dabei handelte und es wäre ihr lieber, nicht zugegen zu sein, wenn der Club sie in der nun unweigerlich folgenden Aktion enttarnte. Einerseits wollte sie es vermeiden, ihr in die Augen zu sehen, während sie erklärte, warum sie dieser Busladung voll Halbdämoninnen einen abgelutscht hatte, zum anderen war das eine Sache, die der Club unter sich ausmachen sollte, entschied sie.
»Ähem«, hüstelte sie, um die Aufmerksamkeit der anderen auf sich zu ziehen, »ich denke, Lisa und ich sollten dann mal langsam gehen. Es sollte ja alles geklärt sein und, äh... wir sehen uns ja dann bestimmt morgen noch. Also bis später!«
Als sie Lisa mit sich am Arm hochzog und dann Richtung Tür führte, flüsterte die ihr zu: »Hast du mir vielleicht etwas zu beichten?«
»Ähm, vielleicht«, gab Lilly zu, »aber laß uns das lieber in unserem Zimmer besprechen.«
Die verbliebenen Schülerinnen sahen ihnen sprachlos hinterher. »Meint ihr, eine von ihnen war das?«, fragte Fantasma, sobald die Tür hinter ihnen ins Schloß gefallen war.
Sachte schüttelte Emma den Kopf. »Sie waren beide mit uns zusammen hier, schon vergessen? Aber so wie sie reagiert haben... war es vielleicht jemand, den sie kennen. Maria zum Beispiel.«
»Ich hab dir schon tausendmal gesagt, Maria ist keine Schlampe!«, zischte Emilia sie an.
»Genaugenommen waren es zweimal«, erwiderte Emma ruhig, »und für jemanden, der innerhalb einer Woche jedem der hier Anwesenden einen geblasen hat, fällt mir ehrlich gesagt keine andere Bezeichnung ein.«
Fantasma zuckte unwillkürlich zusammen. Zwar hatte sie es nur knapp der Hälfte der hier versammelten Hermaphroditen mit dem Mund gemacht, doch hatte sie mit jeder von ihnen auf die eine oder andere Weise Sex gehabt. Hielt Emma sie deshalb etwa ebenfalls für eine Schlampe?
Offensichtlich gingen Emilia ähnliche Gedanken durch den Kopf, denn eine Augenbraue hochziehend sagte sie: »Ach? Hast du denn nicht jeden in diesem Raum gebumst?«
»Das war doch etwas völlig anderes!«, rief Emma. »Außerdem...«, begann sie erneut, verfiel aber sofort wieder in Schweigen, als sie überlegte, wie sie Emilia verständlich machen sollte, wie natürlich und beinahe ohne ihr Zutun es jedesmal dazu gekommen war. Aber noch bevor ihr die geeigneten Worte einfielen, griff Emilia die in der Luft hängende Bemerkung auf.
»Außerdem hast du keinen Beweis dafür, daß es ausgerechnet Maria war!«
»Nun ja, das stimmt natürlich, aber das läßt sich ja leicht überprüfen«, sagte Emma in ihrer besten Kommissarin-Petersen-Stimme, ein festes Lächeln auf den Lippen. Nun war sie wieder ganz in ihrem Element. »Es ist doch gerade erst passiert, oder? Dann ist sie ja vielleicht noch da. Wir gehen einfach rüber und sehen nach, wer es ist.«
»Meinst du denn, sie macht dir die Tür auf, wenn du klopfst?«
»Sie wird ja wohl kaum in der Kabine übernachten. Früher oder später wird sie schon rauskommen. Also los, kommt, je länger wir warten, desto schlechter stehen die Chancen, daß wir sie noch erwischen.» Sie tat einen Schritt auf die Tür zu, doch Emilia, die ihr im Weg stand, machte keine Anstalten beiseitezutreten. Mit Augen, in denen neben unbändiger Neugier nun auch ein leiser Anflug Gereiztheit lag, funkelte Emma sie an. »Du behinderst die Ermittlungen«, wies sie Emilia zurecht.
Die verzog nicht einmal im mindesten die Miene. »Diese Ermittlungen sind auch ohne mich behindert.«
»Du...«, versuchte Emma einen Satz auszusprechen, der ihrer Empörung und Verwunderung gleichermaßen Ausdruck verleihen sollte, verhaspelte sich allerdings schon nach dem ersten Wort und brachte nicht mehr als ein ersticktes Keuchen hervor. Angesichts solcher Unverschämtheit blieb ihr schlicht die Luft weg.
»Nicht schlecht«, lobte Emilia triefend vor Sarkasmus, »das war schonmal ein Subjekt, jetzt noch ein Prädikat, dann haben wir einen vollständigen Satz. Und nächste Woche bringen wir dir bei, wie man ihn etwas genauer ausarbeitet, zum Beispiel mit einem Objekt oder Adjektiv. Vielleicht kannst du dann bald sogar Haupt- und Nebensätze miteinander verbinden.«
»Du...«, stieß Emma erneut grimmig aus, als sei sie in einer Zeitschleife gefangen, bevor sie plötzlich seufzte und ihre Züge sich entspannten. »Naja, du bist jedenfalls wieder ganz die alte, so viel steht fest.« Ein sanftes Lächeln umspielte ihre Lippen, doch ihr Tonfall ließ nicht ganz deutlich werden, ob sie das nun für gut hielt oder nicht.
»Danke, ich nehme das mal als Kompliment. Aber was soll das ganze überhaupt? Tust du das nur, um mir zu beweisen, daß es Maria ist? Wenn ja, kannst du dir die Mühe sparen. Glaub mir, sie ist es nicht. Oder hast du ihr noch nie in die Augen gesehen? Sie ist einfach nicht der Typ, der stundenlang auf einer öffentlichen Toilette hockt, nur um Freaks wie uns einen zu blasen.«
Da war Emma sich jedoch nicht so sicher. Natürlich hatte Emilia scheinbar Recht; mit ihrem makellosen, aufwendig zurechtgemachten Äußeren sah Maria ganz und gar nicht so aus, als würde sie sich zu so etwas herablassen, doch entgegen der Unterstellung hatte Emma ihr tatsächlich schon in die Augen gesehen, und obwohl sie es offensichtlich unter einer Fassade der Unnahbarkeit zu verbergen versuchte, war ihr dabei nicht das Glitzern der Einsamkeit in ihnen entgangen. Sie konnte sich auch nicht vorstellen, daß es von Emilia unbemerkt geblieben sein könnte. So häufig und unmittelbar wie die beiden zusammen waren, mußte ihr dieser Blick unweigerlich ebenfalls aufgefallen sein. Vielleicht lag genau darin ihr Widerstand hinsichtlich dieser Untersuchung begründet, vielleicht hatte sie trotz ihrer ständigen Bekundungen des Gegenteils Angst, daß die Gerüchte über ihre neue beste Freundin stimmten. In diesem Fall ergab ihre Weigerung Sinn. Maria jetzt auf der Toilette vorzufinden, würde ihre Befürchtungen unmißverständlich bestätigen. Doch darum ging es Emma überhaupt nicht.
»Schon gut«, setzte sie zu einer Erklärung an, »ich will dir ja gar nichts beweisen, ich denke nur, daß es eben wichtig ist, herauszufinden, wer das ist. Wenn es wirklich nicht Maria sein sollte, bedeutet das, daß irgendjemand das Geheimnis von uns allen entdeckt hat. Da sollten wir doch schon wenigstens versuchen, dessen Identität zu enthüllen, oder meinst du nicht?«
Dem konnte Emilia nicht widersprechen. Zwar war es ihrer Meinung nach nur eine Halbdämonin einer anderen Altersstufe, doch war ihr nicht wohl bei dem Gedanken, daß irgendjemand so tief in ihre Intimsphäre vorgedrungen war, um die Abnormität ihres Geschlechts aufzudecken. Sie war noch nie sehr offen gewesen, aber dies war mit Sicherheit die Eigenschaft, die sie am verzweifelsten verborgen gehalten hatte. Was war, wenn es sich dabei um Bianca handelte? Dann wüßte am nächsten Tag bereits die ganze Schule Bescheid. »Okay, stimmt. Laß uns gehen.«
»Gut, mir nach«, sagte Emma, während sie sich ungeduldig an Emilia vorbeidrängelte und zur Tür hinaustrat. Nachdem sie den Großteil des dritten Akts offenbar versäumt hatte, konnte sie es kaum erwarten, sich diesem neuen Kapitel zuzuwenden. Da alle anderen bestehenden Fragen schon beantwortet worden waren, konnte es zwar nicht viel mehr als ein Epilog sein, doch zumindest den wollte sie von Anfang bis Ende miterleben. Wahrscheinlich boten sie einen höchst merkwürdigen Anblick, als die sechs Mädchen hintereinander den Flur hinunter zur Toilette marschierten, zum Glück begegneten sie aber nur wenigen anderen Schülerinnen, und die paar, die sie trafen, waren zu sehr in Wochenendstimmung, um sich groß um sie zu kümmern.
Endlich angekommen stieß Emma die Tür auf und ging hinein, gefolgt von ihren Clubkameradinnen. Eine kurze Überprüfung der nicht besonders weitläufigen Räumlichkeit ergab, daß sie nahezu unter sich waren. Außerhalb der Kabinen hielt sich niemand auf und nur eine von ihnen war besetzt. Es war dieselbe, in der die Unbekannte gewesen war, als Emma sie angetroffen hatte, aber um ganz sicher zu gehen, flüsterte sie Nadine mit dem Finger deutend zu: »Ist das die, in der... sich die Verdächtige vorhin befunden hat?« Als die stumm nickte, fuhr sie genauso leise fort: »Gut, das ist schon mal ein bezeichnendes Indiz, aber noch kein Beweis. Wer auch immer da drin ist könnte einfach behaupten... naja, getan zu haben, was man hier eben so macht, wenn wir warten, bis sie rauskommt. Am besten geht eine von uns rein und...falls sie dann wieder ein unmoralisches Angebot bekommt, kann sie sich nicht mehr rausreden.« Einen Moment lang überlegte sie schweigend, dann wandte sie ihren Kopf Emilia zu. »Also, willst du das nicht übernehmen?«
»Ich? Wieso ich?« Trotz ihrer Überraschung gelang es Emilia, ihre Stimme zu einem tonlosen Krächzen herabzudrosseln.
»Du bist doch die einzige von uns, die bisher noch keine Begegnung mit ihr hatte. Das ist die Gelegenheit herauszufinden, in wie weit sie über uns Bescheid weiß. Wenn sie dich auch noch anspricht, läßt das vermuten, daß sie tatsächlich unsere Abstammung kennt. Zumindest ist mir noch nicht zu Ohren gekommen, daß sich hier auf dem Klo jemand heumtreibt, der unschuldige Mädchen darauf hinweist, daß sie doch mal ihre Pimmel durch dieses zufälligerweise in die Wand gebohrte Loch stecken könnten. Wenn das also niemandem passiert, uns allen aber schon, kann das nur bedeuten, daß sie irgendwoher weiß, daß wir von Geburt an anders sind als die restlichen Schülerinnen des Internats, und woher soll sie das schon, wenn sie nichts von unserer Herkunft ahnt?«
So sehr es Emilia auch widerstrebte, mußte sie Emma in dieser Hinsicht einen guten Punkt zugestehen. Sie war von Natur aus äußerst reserviert; sie war stets bemüht, eine gewisse vornehme Zurückhaltung zu wahren, und sich auf der Schultoilette von einer Fremden einen ablutschen zu lassen, entsprach nur bedingt diesem Selbstverständnis. Dennoch konnte sie ihre Neugier nicht leugnen. Emmas Ausführungen folgten einer unbestreitbaren Logik. Sie mußten einfach in Erfahrung bringen, wie viel die Person hinter dieser Wand wußte, oder ob es überhaupt die war, die sie suchten, und das würden sie am besten tun können, indem Emilia dieser Aufforderung nachkam.
»Okay«, sagte sie, »ich mach’s.«
Emma lächelte süffisant. »Gut. Alles andere wäre ja auch unfair, schließlich will niemand von uns dich mit deiner Freundin betrügen.«
Emilia würdigte dieser erneuten spitzen Andeutung keine Antwort. Sie warf Emma einfach einen stummen überheblichen Blick zu, als sie an ihr vorbei in die Kabine stolzierte, die gleich links an die belegte angrenzte.
Maria saß währenddessen auf dem heruntergeklappten Toilettensitz und zog sich ihren Lippenstift nach, der so unauffällig war, daß man ihn nur bemerkte, wenn man darauf achtete. Er diente lediglich dazu, die natürliche Schönheit ihrer geschwungenen Lippen noch ein wenig hervorzuheben. Eigentlich war es nahezu lächerlich, daß sie ihn schon wieder erneuern mußte. Da war er schon kußecht, wischfest und nicht gerade billig, aber wenn man den halben Tag auf dem Klo zubrachte, um ein paar Halbdämoninnen einen zu blasen und sich dabei von ihnen in den Mund spritzen zu lassen, hielt er trotzdem nicht lange vor.
Sie hatte gehört, daß sich draußen zwei Mädchen flüsternd miteinander unterhalten hatten, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Erst als eine von ihnen ausgerechnet die Kabine betrat, von der aus eben noch eine der Zwillinge einen ihrer Schwänze zu ihr herübergestreckt hatte, während die andere offenbar an der Tür stehenblieb, erhob Maria sich. Es hatte ganz den Anschein, als würden sich ihre Dienste mittlerweile herumsprechen. Vermutlich hatte der Zwilling, mit dem sie sich vorhin beschäftigt hatte, irgendjemandem von der besonderen Behandlung erzählt, die ihr hier zuteil geworden war, auch wenn sie keine Ahnung hatte, wer das sein sollte. Deren Schwester hatte Maria bereits in den Genuß ihrer Machenschaften kommen lassen – welche genau konnte sie nicht sagen, sie konnte sie einfach nicht auseinanderhalten – und ansonsten schienen sie eher unter sich zu bleiben.
Aufmerksam geworden kniete sie sich vor die Trennwand und spähte durch das Loch darin hindurch. Es überraschte sie, auf der anderen Seite Emilia zu entdecken, wo sie heute doch angeblich unabkömmlich war. Zwar sah Maria aus ihrer Position heraus nicht mehr als ein weißes Kleid und ebensolche Ballerinas, doch war das völlig ausreichend, um ihre Freundin zweifelsfrei identifizieren zu können. Das war heutzutage einfach keine allzu beliebte Mode mehr, auch wenn Maria fand, daß sie Emilia hervorragend stand, außerdem hätte sie diese blassen porzellanartigen Beine überall wiedererkannt. Wie schlichtweg alles an ihr waren sie nicht weniger als perfekt, so weit Maria sie bisher hatte in Augenschein nehmen dürfen; lang, schlank und makellos.
Es hatte einige Zeit in Anspruch genommen, überhaupt erst einmal diese simple Tatsache zu akzeptieren, daß sie ein anderes Mädchen attraktiv finden konnte. Natürlich hatte sie sich auch zu Frau Ferria hingezogen gefühlt, doch hatte sie das im Nachinein auf die autoritäre Ausstrahlung zurückgeführt, die sie beinahe greifbar verströmt hatte, ihre allgemeine sexuelle Orientierung hatte sie deswegen jedenfalls nicht in Frage gestellt. Diese Einschätzung mußte sie nun allerdings dringend noch einmal überdenken, denn da gab es noch eine Kleinigkeit, die sie sich innerhalb der letzten Tage einzugestehen gehabt hatte: Sie hatte sich in Emilia verliebt, ganz ohne Zweifel. Es hatte sie selbst überrascht, immerhin hatte sie bis vor kurzem noch regelmäßig Jungs aus dem Dorf verführt, ohne sich an deren eindeutig männlicher Physiognomie zu stören. Trotzdem war es so. Schon als sie Emilia zum ersten Mal gesehen hatte, bei Frau Flimms Ansprache zum Schuljahresbeginn, war sie sofort von ihrem Aussehen mit den verschiedenfarbigen Augen und dem hellen Teint fasziniert gewesen. Das hatte die innere Einstellung in Maria zwar erschüttert, aber noch nicht eingerissen. Das war erst später geschehen, als ihre Gefühle für die Halbdämonin allmählich unabweisbar geworden waren.
Während sie sich die letzten Tage über regelmäßig getroffen hatten, war ihr immer bewußter geworden, wie viel ihr an Emilia lag und gestern erst, kurz bevor ihr heimlicher Schwarm eine Verabredung für heute abgelehnt hatte, war Maria endlich klargeworden, daß es Liebe war, die sie für ihre Mitschülerin empfand. Sie war eben nicht nur auf ihre ganz eigene Weise wunderschön, sondern besaß auch noch die bezauberndste Persönlichkeit, die sie sich nur vorstellen konnte – und was vielleicht am wichtigsten war, sie hatte ihr gegenüber immer in allen Belangen Verständnis gezeigt. Inzwischen war es sogar so weit, daß es kaum noch Augenblicke gab, in denen Maria nicht an sie dachte. Wenn sie zusammen waren, hingen ihre Gedanken an jedem ihrer Worte, ja selbst an jedem noch so unmerklichen Atemzug, den sie tat, und wenn sie sich bedauerlicherweise voneinander trennen mußten, sehnte sie sich danach, sie endlich wiederzusehen.
Doch wenn dem wirklich so war, stellte sich natürlich die Frage, warum sie jetzt überhaupt hier war, jeden Schwanz zum Abspritzen bringend, der ihr in diesem Mädcheninternat unterkam. Eigentlich hatte sie heute gar nicht vorgehabt, die schuleigenen sanitären Anlagen wieder dermaßen zweckzuentfremden, aber nachdem Emilia ihr Treffen ausgesetzt hatte, hatte sie nichts anderes zu tun gehabt. Sie hatte einfach in ihrem Zimmer gesessen und Musik gehört, bis ihr eingefallen war, daß sie genauso gut ausgehen konnte, um sich ein wenig zu amüsieren. Nun ja, vielleicht war sie auch ein ganz kleines bißchen eifersüchtig gewesen. Wenn Emilia sie nicht sehen wollte, würde sie nicht darum betteln. Sie konnte sich jederzeit ein Dutzend Jungs anlachen, die ihr bedingungslos zu Füßen lagen – oder eben zwei Halbdämoninnen durch ein Glory Hole befriedigen, so wie sie es letztlich getan hatte.
Anscheinend war ihre Eifersucht ja auch gar nicht unbegründet gewesen, denn wenn Emilia tatsächlich so hochbeschäftigt war, wie sie vorgegeben hatte, warum hatte sie dann trotzdem offensichtlich die Zeit gefunden, etwas mit den Zwillingen zu unternehmen, die sie mit den Möglichkeiten vertraut gemacht haben mußten, die diese spezielle Kabine bot? Für den Moment tat Emilia jedoch nichts weiter, um mit dieser Zuwendung bedacht zu werden. Sie sah nicht einmal das Loch an, stattdessen stand sie unschlüssig vor dem heruntergeklappten Toilettendeckel und starrte ihn an, als wäre es eine unlösbare Aufgabe, ihn anzuheben. Es wirkte also ganz und gar nicht so, als sei sie wegen eines dringenden Bedürfnisses hier, sondern vielmehr als würde sie auf etwas warten.
Das war auch gar nicht verwunderlich, wenn Maria genauer darüber nachdachte. Bisher hatte sie ja immer den ersten Schritt tun müssen, indem sie die Aberrationen, die sie hier anftraf, anwies, was sie zu tun hatten. Insofern war es verständlich, daß Emilia nicht wußte, wie sie sich nun zu verhalten hatte. Sie konnte ja schlecht einfach mal auf Verdacht nachfragen, ob sie nicht Lust hätte, ihr einen zu blasen, in der Hoffnung daß diese Kabine nicht mittlerweile von jemand anderem besetzt war. Mit einem unterdrückten Kichern bedachte sie die Vielzahl peinlicher Situationen, die daraus hätten entstehen können, wurde aber schnell wieder still, als Emilia sich ihr zuwandte.
Jetzt da sie entdeckt worden war, wäre natürlich der Zeitpunkt gekommen, ihr zu versichern, daß sie bekommen könnte, warum sie hier war, doch noch zögerte sie. Sie war sich nicht sicher, ob Emilia dieses Geschenk verdient hatte, das sie jeder anderen Schülerin mit Schwanz, die diese Toilette aufsuchte, hatte zukommen lassen. Maria fühlte sich von ihr hintergangen. Nicht nur daß sie eine Verabredung mit ihr ausgeschlagen hatte, da traf sie sich auch noch hinter ihrem Rücken mit den Zwillingen. Andererseits war das ziemlicher Unsinn. Emilia hatte nie gesagt, was sie vorhatte, nur daß sie heute beschäftigt war. Wie die Dinge also lagen, konnte man ihr nicht vorwerfen, daß sie gelogen hätte, egal was sie miteinander trieben, und nur weil sie alle Halbdämoninnen waren, hieß das ja nicht, daß sie unbedingt etwas am laufen haben mußten. So weit sie es bisher mitbekommen hatte, waren Emilias Noten nicht schlecht, die der Zwillinge waren jedoch hervorragend. Vielleicht gaben sie ihr also bloß Nachhilfeunterricht.
So sehr diese Überlegungen sie letztlich auch beruhigten, nichts davon ließ die eisige Umklammerung ihres Herzens, die sich wie eine krallenbewehrte Pranke tief hineingebohrt hatte, völlig verschwinden. Doch wenn sie Emilia nun durch das Loch hindurch betrachtete, wie sie mit abschätzigem Gleichmut auf sie herabblickte, fühlte Maria sich außerstande abzustreiten, daß sie noch immer in sie verliebt war. Diese Feststellung hätte sie eigentlich nicht überraschen dürfen, denn welchen Sinn hätte Eifersucht denn schon gehabt, wenn man sich nicht zu jemandem hingezogen fühlte? Nur hatte sie sich, wie anfangs bei ihrer Zuneigung zu Emilia, beharrlich geweigert zuzugeben, daß es Eifersucht war, die sie empfand. Sie hatte allerdings auch keine Erfahrung mit dieser Art Gefühl. Sie war es einfach nicht gewohnt, nicht zu bekommen, was sie wollte. Wann immer sie einen Wunsch gehabt hatte, der mit Geld oder Einfluß zu erlangen gewesen war, hatte sie ihn nur zu äußern brauchen, um ihn von ihren Eltern erfüllt zu bekommen.
Selbstverständlich hatte sie trotzdem Ablehnung kennengelernt. Kaum eine ihrer Klassenkameradinnen, egal ob hier oder in ihrer Heimatstadt, schien sie zu mögen – was ihr aber nicht allzu viel ausmachte. Sie konnte die meisten ebenfalls nicht besonders leiden. Sie stellte recht hohe Ansprüche an die Menschen, mit denen sie sich umgab, und wenn sie einmal von jemandem verschmäht wurde, den sie mochte, ließ sie auch das nicht an sich heran. Jemand, der die Verblendung besaß, sie abzuweisen, war ihrer Aufmerksamkeit wahrscheinlich ohnehin nicht wert.
Bei Emilia hingegen verhielt es sich anders. Auf ihre Gegenwart konnte Maria unmöglich verzichten. Sie kannte sie erst seit einer Woche, und doch konnte sie sich ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. Sie wollte sie immer um sich herum haben, was auch passierte.
Unter diesen Umständen – und besonders wenn Emilia sie so wie jetzt auf diese erhabene Weise ansah – hätte Maria ihr letzten Endes wohl alles vergeben, selbst wenn die sie versetzt hatte, nur um die Zwillinge flachzulegen. Wenn sie genauer darüber nachdachte, war das ein weiterer Grund, warum ihre Gefühle für sie solch unbezwingbare Ausmaße angenommen hatte: Sie strahlte stets eine unverkennbare Würde aus, eine Art herrschaftlicher Eleganz, die sie von allen anderen abhob. Sogar jetzt, inmitten einer Toilettenzelle und das Gesicht gezeichnet von Irritation, bewahrte sie diese vorneheme Gelassenheit.
Damit war Marias Entscheidung gefallen.
»Hey«, sagte sie leise, noch immer durch das Loch in der Wand linsend, »du siehst nicht so aus, als würdest du die Art Erleichterung suchen, für die man normalerweise hierher kommt. Also wenn der Druck, der dich hertreibt, eher mit einer anderen Körperflüssigkeit zu zun hat, könnte ich dir dabei helfen, ihn abzulassen. Dazu mußt du nur deinen Schwanz durch das Loch stecken.«
Die Erwähnung dieses von anderen bei Emilia wohl weniger vermuteten Geschlechtteils ließ sie nicht in Entsetzen verfallen, allenfalls vertiefte sich ihr leichtes Stirnrunzeln etwas, das sich über sie gelegt hatte, als sie erkannt hatte, daß sie beobachtet wurde. Das sprach für die Richtigkeit von Marias Annahme, daß sie gewußt hatte, was sie erwarten würde, allerdings ließ die Tatsache, daß sie nun abermals zögernd überlegte, einige Zweifel aufkommen. Wenn sie dieses Angebot vorhergesehen hatte, warum sollte sie dann erst noch lange nachdenken müssen, ob sie es auch annehmen sollte?
Aber vielleicht hatten sie ja plötzlich moralische Bedenken überkommen, jedenfalls fragte sie jetzt: »Und das würde dir nichts ausmachen?«
»Aber nein«, sagte Maria, »im Gegenteil, es wäre mir sogar eine Freude.« Und das stimmte. Sie konnte es sich selbst nicht erklären, aber aus irgendeinem Grund machte es ihr Spaß, sich so um diese hermaphroditischen Mädchen zu kümmern. Obwohl sie dabei keine direkte Stimulation erfuhr, machte es sie nichtsdestotrotz ungalublich an. Dabei war es mit Sicherheit nicht angebracht, immerhin kannte sie diese neuen Schülerinnen erst seit weniger als einer Woche, und sich dann innerhalb so geringer Zeit von einer solchen Menge von ihnen in den Mund spritzen zu lassen, war nachgerade ein Höhepunkt der Verruchtheit.
Im Nachhinein war sie nicht einmal mehr sicher, warum sie überhaupt dieses Loch in die Trennwand gebohrt hatte. Die Idee dazu war ihr vor drei oder vier Wochen, mitten in den Ferien, gekommen, als sie im Internet zufällig einen Porno entdeckt hatte, in dem eine Frau sich eine Stunde lang vor einer ganz ähnlichen Öffnung – die, wie sie anhand des Titels hatte ableiten können, als Glory Hole bezeichnet wurde – zur Verfügung gestellt und währenddessen etliche Mengen Sperma geschluckt hatte. Zum Glück war sie auf der Suche nach neuen Masturbationsvorlagen auf dieses Video gestossen, sodaß sie ohnehin gerade vorgehabt hatte, sich selbst zu befriedigen, denn bei diesem Anblick konnte sie gar nicht anders als sich die Hose sofort bis zu den Knien herunterzureissen. Die Vorstellung, selbst diese Frau zu sein und unzählige Schwänze von völlig fremden Männern zu lutschen, hatte sie vor Lust einfach vollkommen überwältigt.
Danach hatte eine kurze Recherche ergeben, daß es solche Orte wirklich gab und dieser Umstand der denkbaren Realität, daß es vielleicht sogar hier in ihrer Heimatstadt auf der Bahnhofstoilette einen solchen gab, den sie benutzen konnte, um diese Phantasie wahr werden zu lassen, steigerte die Intensität der unmittelbar nachfolgenden erneuten Besänftigung ihrer Begierde bis ins fieberhafte. Sie hatte sich so lange befingert, bis sie buchstäblich nicht mehr konnte und für diesen Tag vor Erschöpfung ganz wackelig auf den Beinen war. Einen nicht unbeträchtlichen Teil der restlichen Sommerferien hatte sie dann vor dem Computer gesessen. Sie war es bereits zuvor gewohnt gewesen, es beinahe täglich entweder allein oder mit jemand anderem zu tun, wenn sich eine geeignete Gelegenheit auftat, doch in der nächsten Zeit hatte sie es sich gemacht, als wolle sie unbedingt einen Weltrekord überbieten.
Aber woher kam ihre Vorliebe für diesen abstrusen Auswuchs der menschlichen Sexualität so plötzlich? Natürlich konnte der erhebliche Anstieg ihres Verlangens, sich ihrer Erregung hinzugeben, damit zusammenhängen, daß sie Zuhause einzig auf Onanie zurückgreifen konnte. Das erste Mal, als ihre Eltern sie mit einem Jungen erwischten, war sie auf das Internat verbannt worden, sie wollte gar nicht wissen, was beim zweiten Mal passieren würde. Der alleinige Auslöser konnte das jedoch nicht sein, dazu hatte sie Material dieser Art zuletzt viel zu häufig als Vorlage genutzt. Außerdem hatte sich dieser Gedanke sogar in eigentlich unverfänglichen Situationen in ihrem Kopf festgesetzt und war erst wieder daraus verschwunden, nachdem sie ihm Genugtuung verschafft hatte.
Alles, was sie wußte, war, daß sie sich nach Frau Ferrias vorzeitigem Rücktritt in den Ruhestand unendlich einsam gefühlt hatte. In ihren Armen war sie sich zum ersten Mal seit langer Zeit endlich wieder geliebt und geborgen vorgekommen. Zuletzt hatte sie so etwas bei ihren Eltern empfunden, als sie noch sehr viel jünger gewesen war, nur schien das inzwischen Äonen her zu sein. Sie waren schon immer schwer mit der Führung ihres Unternehmens beschäftigt gewesen, doch überließen sie Maria immer weiter sich selbst, je mehr sie auf eigenen Beinen stehen konnte, und ihre Affäre mit Michael war ja schon wieder beendet gewesen, noch bevor sie richtig angefangen hatte.
Wenn man es von der Seite betrachtete, war es vielleicht ein bißchen seltsam, daß sie sich ausgerechnet mit Lilly und Lisa angefreundet hatte, waren sie doch schließlich für das Verschwinden der vorigen Schulleiterin verantwortlich, aber sie waren nun einmal auch die einzigen, mit der sie über diese ganze Sache reden konnte. Abgesehen von Frau Flimm natürlich, doch die wurde zunehmend von ihren neuen Pflichten vereinnahmt. Demgemäß hatte sie sich oft mit den zwei getroffen, um mit ihnen über das Erlebte zu sprechen, wobei Lilly sich nach und nach mehr öffnete und einige Details ihrer schrecklichen Vergangenheit preisgab; Dinge, zu denen Frau Ferria sie gezwungen, oder die sie ihr angetan hatte, die Maria sich nicht einmal vorzustellen getraute. Zwar hatte sie bereits gleich nach dem vermeintlichen Tod ihrer Mutter eine kleine Übersicht der Landkarte ihrer mentalen Narben gegeben, doch verständlicherweise hatte es etwas gedauert, bis sie sich wieder sicher genug fühlte, tiefer in den Kosmos ihres inneren Schmerzes vorzudringen, und obwohl Maria dabei von Taten erfuhr, die sie vor Abscheu erzittern ließen, weigerte sich ein Teil von ihr, der nichts mit ihrem Verstand oder Bewußtsein zu tun hatte, zu akzeptieren, daß Frau Ferria sie begangen haben sollte. Sie hatte doch einen so einfühlsamen und geistreichen Eindruck gemacht, wie sollte sie da ein dermaßen scheußliches Monster sein?
Irgendwann jedoch heilte die Zeit alle Wunden, selbst die rein psychische, festzustellen, daß die Person, zu der man sich hingezogen fühlte, in Wahrheit ein verabscheuungswürdiges Miststück war, und als Maria sich diesen Sachverhalt endlich eingestanden hatte, geschah das sogar erstaunlich schnell. Dafür waren nicht nur ihre langen Gespräche mit Lilly und Lisa verantwortlich, auch der Unterricht trug dazu bei, allerdings eigentlich nur der in Philosophie. Es war aber nicht auschließlich der Lehrstoff, der sie so sehr von ihrem Kummer über nicht nur verlorene, sondern sogar zerschmetterte Liebe ablenkte, daß sie allmählich darüber hinwegkam, es war vor allem der Lehrer selbst.
Herr Klein war kein junger Referendar mehr, tatsächlich war er so alt, daß er ihr Vater hätte sein können. Wie dieser hatte er kurzes, dunkles Haar, an den Schläfen mit etwas Grau durchsetzt, und legte ein distinguiertes Verhalten an den Tag. Ansonsten glich er ganz dem etwas verschrobenen Bild, das man sich von einem Philosophielehrer so machte: Er besaß eine offensichtliche Vorliebe für einfarbige Hemden, die er mit eher langweiligen Jacketts kombinierte, wirkte ständig in Gedanken versunken und gab bei jeder sich bietenden Gelegenheit tiefschürfende Zitate von sich, die er irgendwo gelesen hatte. Obwohl er offensichtlich kein sehr sportlicher Mensch war, hatte er doch eine durchschnittliche Figur. Mit seinen markanten Gesichtszügen und den tiefblauen Augen konnte man ihn sogar durchaus als schön bezeichnen.
Maria fand ihn jedenfalls unwiderstehlich.
Als sie eines Tages bei ihm im Unterricht saß und einem seiner Vorträge über Kants kategorischen Imperativ lauschte, beschloß sie, ihn zu verführen. Das gestaltete sich allerdings schwieriger, als sie zunächst gedacht hätte. Weder die Rundungen ihrer Hüfte noch die ihrer Brüste waren bislang besonders ausgeprägt, doch die Reize, die sie besaß, wußte sie einzusetzen. Von nun an trug sie jeden Dienstag und Freitag, immer wenn Philosophie auf dem Stundenplan stand, die kürzesten Röcke und engsten Tops, die sie finden konnte, himmelte ihn ununterbrochen an und tat alles, um ihm auf möglichst subtile Weise nahezulegen, daß sie auf ihn stand, trotzdem schien er nichts davon mitzubekommen. Nicht einmal als sie alle Zurückhaltung hinter sich ließ und sie ihm mitten in der Stunde heimlich unter dem Tisch einen Einblick zwischen ihre Beine gewährte, genau an dem Tag, an dem sie zufälligerweise vergessen hatte, einen Slip anzuziehen, zeigte er irgendeine erkennbare Reaktion.
Als ihr Flirten nach vier Wochen selbst mit einem deratig offensivem Mittel fehlschlug, blieb sie nach Schulschluß einfach noch in der Klasse und sprach ihn an. Wie sich dabei herausstellte, war ihre aufkeimende Zuneigung Herrn Klein nicht verborgen geblieben, nur hielten ihn ethische Beweggründe davon ab, auf sie einzugehen. Eigentlich seltsam, wenn man bedachte, daß Sokrates oder Platon nichts gegen so eine Verbindung einzuwenden gehabt hätten, und daß eben dieser Umstand Herrn Klein dazu bewogen hatte, sich Nietzsches Ablehnung eines allgemeingültigen Wertesystems anzuschließen, auch wenn sie bei ihm dem Unglauben an dessen Möglichkeit entsprang, statt der vereinheitlichenden Wirkung, die es auf die Masse haben mochte. Doch dieser Nihilismus bedeutete nicht, jedwedes Verhalten gutzuheißen, es sei lediglich Ausdruck einer ganz eigenen Vorstellung von Sittlichkeit, und er könne es einfach nicht mit diesem vereinbaren, auf die erotischen Avancen eines unschuldigen Kindes einzugehen.
An dieser Stelle zeigte sich wieder einmal Marias Fähigkeit, sich in Szene zu setzen. Entgegen ihrer üblichen Art, sich auf Zurückweisung mit Arroganz zu verteidigen, fragte sie ihn, die Augen schüchtern niedergeschlagen, ein tieftrauriges Beben in der Stimme, ob er sie denn nicht schön fände. Möglicherweise hatte sie unbewußt in seinen Beteuerungen des Gegenteils einen Hinweis darauf entdeckt, daß er Unschuld sehr wohl als anziehend empfand, entsprach ihre Äußerung doch ganz der Naivität, die mit dieser einherging. Aber wie dem auch immer gewesen sein mochte, sie zeigte zumindest die erhoffte Wirkung. Herr Klein erschrak regelrecht und meinte, er fände sie sogar über alle Maßen attraktiv, sowohl körpelich als auch geistig, er dürfe es eben nur nicht zulassen. Maria, noch immer in der Rolle des unbedarften Schulmädchens, fiel ihm wie vor Erleichterung um den Hals, wobei sie deutlich seine Latte spürte, die sich gegen ihren Bauch drückte. Sie war eben wirklich ausgesprochen gutaussehend, und ihr Wille, mit ihm zu schlafen, war eine Verheißung, der sich sein Körper nicht widersetzen konnte.
Spätestens jetzt sollte eigentlich klar sein, wie der Rest des Nachmittags verlaufen war. Zwar unternahm Herr Klein noch einige vage Versuche, das Unausweichliche zu verhindern, doch als Maria anfing, seine Einwände mit Aphorismen zu kontern, die sie nicht von ihm gelernt hatte, sondern sich selbst erarbeitet hatte, sah auch er ein, daß es sinnlos war. Er begann wirklich, sich in Maria zu verlieben.
Was in den nächsten Tagen folgte, war eine Periode höchsten Glücks. Sie hörte ihm gerne zu, wenn er über das moralische Dilemma sprach, in dem er buchstäblich steckte, und wenn sie keine philosophische Diskussion führten, trieben sie es hemmungslos miteinander. Leider währte diese Zweisamkeit aber nur sehr kurz. Rückblickend betrachtet war es wohl auch nicht unbedingt die beste Idee gewesen, ihm nach der letzten Stunde noch im Klassenzimmer einen zu blasen. Sie hatte sich an ihn herangemacht, noch ehe er Gelegenheit bekommen hatte, die Tür zu verschließen, und so hatte das Schicksal seinen Lauf genommen. Eine Schülerin war noch einmal zurückgekehrt, weil sie etwas vergessen hatte, und so Maria mit Herrn Kleins Schwanz im Mund überrascht – der entgegen seinem Namen übrigens gar nicht mal schlecht bestückt war.
Das machte ihn für das Internat natürlich untragbar. Zwar hatte die Schülerin sich direkt an Frau Flimm gewandt, die alles in ihrer Macht stehende getan hatte, um den Vorfall geheim zu halten, doch waren weiterführende Maßnahmen unerläßlich gewesen. Maria hatte behauptet, daß es allein ihre Schuld gewesen sei, daß Herr Klein nichts Unrechtes getan habe, aber die Direktorin hatte ihr zu verstehen gegeben, daß eine Versetzung bereits das allermindeste war, was der Lehrer für sein Fehlverhalten zu erwarten habe. Er könne froh sein, daß sie nur ihr zuliebe kein Strafverfahren einleitete. Die vergeßliche Schülerin hatte sich unterdessen einverstanden erklärt, Stillschweigen über diese Angelegenheit zu bewahren, doch selbstverständlich drang auf die eine oder andere Weise immer etwas nach außen. So jedoch blieb es nur ein Gerücht über Maria, keine offene Anschuldigung.
Herr Klein wurde also unter einem Vorwand auf ein Jungeninternat berufen und Maria war wieder allein.
Trotz ihrer offensichtlichen Mißbilligung dieser Beziehung versuchte Frau Flimm ihr die Trennung so gut es ging zu erleichtern. Sie erneuerte ihr Versprechen, daß Maria sie jederzeit besuchen könne, um zu reden, teilte ihr als einzige ein Einzelzimmer zu und bot ihr an, ein paar Tage dem Unterricht fernzubleiben, doch nichts davon half. Das einzige, was ihren Schmerz etwas erträglicher machte, war, als Frau Flimm sie zum Trost fest in die Arme geschlossen hatte.
Nach dieser wohltuenden Fürsorgebezeugung hatte sie einige Zeitlang nicht mehr den Wunsch verspürt, mit jemandem zu schlafen, doch hatte er sie irgendwann unweigerlich wieder überkommen, nur daß ihr diesmal ziemlich egal war, wer sich für diese Aufgabe fand. Sie war eines Nachmittags einfach mit dem Bus in die Stadt gefahren und hatte sich dort einen Jungen geangelt, der motivationslos vor dem Kino herumgelungert hatte. Als sie bei diesem ersten Abschleppversuch merkte, wie leicht es war, tat sie es von da an immer öfter, und obwohl sie ausnahmslos Jugendliche ansprach, die schon deutlich älter waren als sie – Marias Vorliebe lag in diesem Fall zwischen 18 und 20 Jahren – hatte keiner von ihnen Gewissensfragen zu überwinden gehabt. Insgeheim enttäuschte Maria das. Irgendwie hatte sie es als sehr erregend empfunden, Herrn Klein erst von der Richtigkeit ihres Tuns überzeugen zu müssen. Später, nachdem sie sich erst einmal einen gewissen Ruf erarbeitet hatte, kamen manchmal sogar Jungs von sich aus auf sie zu.
Als sie dann in den Ferien die Idee mit dem Glory Hole gehabt hatte, wäre es nur logisch gewesen, es irgendwo zu platzieren, wo sie eine männliche Zielgruppe für ihre Gefälligkeiten hätte erreichen können, doch war es beinahe zu einer Obsession geworden, sich vorzustellen, wie es wäre, wenn sie es hier im Internat täte. Lilly hatte ihr ja von ihrem Plan erzählt, alle minderjährigen Halbdämoninnen, die sie nur finden konnte, an dieser Schule zu versammeln, um sie schützen zu können, sodaß Maria wußte, daß es hier bald mehr als genug potentielle Kandidatinnen für ihre ausgefallenen Dienstleistungen geben würde, und der abstruse Gedanke, sie diesen hermaphroditischen Wesen zukommen zu lassen, hatte sie sogar noch weitaus mehr angemacht, als sie irgendwelchen fremden Männern anzubieten.
Letzten Sonntag dann, dem Tag bevor der Unterricht wieder begann, hatte sie Hugo, Portier und Hausmeister in Personalunion, nach einer Bohrmaschine gefragt. Sie hatte behauptet, von Frau Flimm geschickt worden zu sein, weil sie ihn nicht mit solch einer Kleinigkeit, wie einem Bild aufzuhängen, belästigen wolle; eine durchaus glaubhafte Ausrede, wenn man die Schulleiterin näher kannte, und Hugo hatte an jenem Tag ohnehin alle Hände voll zu tun gehabt. Zum Glück hatte sich unter den Einsätzen auch eine passende Lochfräse befunden, sodaß sie keine Schwierigkeiten gehabt hatte, ihr Vorhaben umzusetzen.
Nun saß sie hier also, auf dem Boden einer Schultoilette, wo sie heute bereits zweien ihrer Klassenkameradinnen einen geblasen hatte und kurz davor stand, sich einer dritten zu widmen. Das war schon keine einfache Promiskuität mehr, das grenzte beinahe an einen Gangbang. Bevor sie diese spezielle Perversion für sich entdeckt hatte, war genau das immer ihre bevorzugte Masturbationsphantasie gewesen. Seit sie damals hereingeplatzt war, als Frau Flimm von drei Dämoninnen genommen wurde – erzwungenermaßen, doch das war Maria an diesem Punkt noch nicht klar gewesen – war ihr dieser Gedanke nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Es war ihre geheimste Sehnsucht geworden, einmal alleiniger Mittelpunkt einer ganzen Gruppe von Männern zu sein, die alle darum rangen, es mit ihr zu treiben, es gar nicht mehr erwarten konnten und sich schließlich gleichzeitig auf sie stürzten.
Leider hatte sie diesen Traum bisher nicht verwirklichen können. Sie hatte sich nie getraut, mehr als einen Jungen anzusprechen, und nachdem das geschafft war, bot sich kaum eine Gelegenheit, ihn zu fragen, ob er nicht noch ein paar seiner Freunde einladen wolle. Jetzt hatte sie zumindest einen Weg gefunden, in den Genuß einer Abwandlung dieses erhofften Erlebnisses zu kommen, dazu mußte Emilia nur endlich ihr Ding durch das Loch stecken, doch die zierte sich scheinbar nach wie vor.
»Was ist, willst du nicht?«, fragte sie in der tonlosen, leisen Stimme, mit der sie versuchte, ihre wahre Identität zu verbergen. Eine geraume Weile passierte nichts; keine Antwort drang durch das Holz der Trennwand hinüber und wie Maria durch die Öffnung darin erkennen konnte, bewegte Emilia sich auch nicht.
»Doch, schon«, ließ sie sich letztlich vernehmen, »ich weiß nur nicht, ob ich sollte.«
»Ethisch gesehen, meinst du?«
Obwohl Maria nicht hoch genug blicken konnte, um es mit absoluter Gewißheit beurteilen zu können, erkannte sie anhand des Auf und Abs der Arme des Mädchens ein Schulterzucken. »Weniger wegen einer objektiven Bestimmung von Anstand, als wegen eigener Ansichten, wie man sich benehmen sollte.« Einen Moment lang hielt Emilia inne, bevor sie hinzufügte: »Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich das mit mir selbst vereinbaren kann. Einerseits wäre ich schon, äh... bereit, ehrlich gesagt sind Teile von mir sogar regelrecht versessen darauf, aber es ist gerade viel passiert und... ich weiß allgemein überhaupt nicht mehr, was ich tun soll.«
Maria war vollkommen klar, daß Emilia es unmöglich mitbekam, trotzdem nickte sie verständnisvoll. Zwar hatte sie keine Ahnung, was kürzlich im Leben ihrer Freundin vorgefallen war, doch konnte sie ihre Gefühle nur allzu gut nachvollziehen. Schon seit langem befand sie sich in einer ähnlichen Lage. Alles, was sie früher einmal für unumstößlich gehalten hatte, war über den Haufen geworfen worden, und hatte sie in einem Chaos unaufhörlicher Verwirrung und Unsicherheit zurückgelassen.
»Naja, ich fürchte, dann kann ich dir wohl nicht besonders weiterhelfen. Der beste Rat, den ich dir geben könnte, ist wahrscheinlich nicht mehr als eine banale Plattitüde, aber mir hat der Spruch eigentlich immer gefallen: Hör auf dein Herz. Sei einfach du selbst und der Rest kommt schon von allein.«
Emilia stieß einen tiefen Seufzer aus; einen Laut, der viel zu komplex war, als daß Maria ihn gänzlich hätte ergründen können. Ergebenheit, Schmerz, Lust, Geringschätzung und widerstrebende Bewunderung waren gleichermaßen darin enthalten. So klischeehaft Marias Ratschlag ihrer eigenen Befürchtung nach auch gewesen sein mochte, schien er Emilia doch zu einer Entscheidung verholfen haben. Mit dem langgezogenen Hauch, in dem ihr wortloser Ausdruck so gegensätzlicher Gefühle endete, begann sie, ihre Hände um den Saum ihres Kleids zu legen und ihn langsam anzuheben.
Seit sie sich eingestanden hatte, daß sie Emilia auch körperlich unsagbar reizvoll fand, hatte Maria viel Zeit damit verbracht, sie sich nackt vorzustellen, insbesondere was ihren Penis anbelangte. Bis sie am vorigen Dienstag Isabelle durch dasselbe Loch beobachtet hatte, durch das sie auch jetzt schaute, hatte sie angenommen, daß sich die Geschlechtsteile von Halbdämoninnen – im Gegensatz zu denen von vollwertigen Dämonen, wie sie aus ihren Erfahrungen mit Frau Ferria wußte – nicht von menschlichen unterschieden. Zwar hatte sie nur mit denen von Lilly nähere Bekanntschaft gemacht, doch die waren in dieser Hinsicht nicht weiter ungewöhnlich, wie sie mittlerweile ohne jeden Zweifel beurteilen konnte.
Als sie im Laufe der darauffolgenden Tage mit Hilfe der anderen Neuzugänge der Schule erfassen durfte, wie sehr sie voneinander abwichen, beflügelte das ihre Phantasie in Bezug auf Emilias drastisch. In ausgiebigen Tagträumen stellte sie unaufhörlich die wildesten Vermutungen darüber an, und nun stand sie kurz vor der Lösung dieses Rätsels. Stück für Stück hob sich der verdeckende Schleier von Emilias Kleid und gab den Blick auf ihren Slip frei. Der war nicht besonders ausgefallen. Es war ein ganz einfaches, schmuckloses Modell, ohne jegliche Verzierungen wie Rüschen, gehalten in ihrer offensichtlichen Lieblingsfarbe: makellosem Weiß. Das einzige, was an ihm außergewöhnlich war, waren die heftigen Bewegungen, die darunter erkennbar vor sich gingen, was Maria aber als natürliche Ausschläge eines sich versteifenden Schwanzes abtat. Bei der Menge an praktischem Wissen, das sie zuletzt angesammelt hatte, gab es wohl kaum mehr ein Phänomen männlicher primärer Geschlechtsmerkmale, mit dem sie nicht vertraut gewesen wäre.
Während Emilia mit einer Hand ihr Höschen herabzog und mit der anderen ihr Kleid oben hielt, wich Maria von ihrem Beobachtungsposten zurück. Das tat sie ganz automatisch, immerhin sollte die Öffnung in der Wand, die gerade als Guckloch diente, gleich völlig anders genutzt werden. Vielleicht lag es unbewußt auch ein wenig daran, daß sie sich die Vorfreude nicht verderben wollte. Nun würde das Mädchen, an das sie seit kurzem in jeder freien Minute dachte, jeden Augenblick ihren Penis zu ihr hindurchschieben, dann gäbe es Gelegenheit genug, ihn in Ruhe ganz aus der Nähe zu betrachten, mehr noch ihn sogar anzufassen und in allen Einzelheiten zu erforschen. Kein Grund zur Eile also.
Nach kurzem Warten war es endlich so weit. Emilia hatte es geschafft, ihr Ding aus seinem engen Gefängnis zu befreien und es zu ihrer Seite der Trennwand hindurchzustecken. Unwillkürlich erstarrte Maria. Sie hatte in der Zwischenzeit schon so einige Schwänze begutachten dürfen, doch so ein Riesenteil war ihr bisher noch nicht untergekommen. Sie hatte den Durchmesser des Spalts bereits recht großzügig gewählt, trotzdem füllte Emilias Penis ihn komplett aus, und so wie Maria davorkniete, das Gesicht auf Höhe seines Ansatzes, hing er beinahe bis zu ihrem Bauchnabel hinab. Auch sonst besaß er nur wenige Übereinstimmungen mit denen, die Maria begegnet waren. Im Gegensatz zu ihnen lief er über seine gesamte Länge hinweg spitz zu, ganz ohne weitere Konturen. Eine Eichel war nicht auszumachen, der Schaft setzte sich einfach übergangslos zu einer zylindrischen Kuppel fort, an dessen Scheitel sich wie üblich ein kleines Loch befand. Mit seiner grünlichen glatten Haut und dieser Form hatte er vielmehr Ähnlichkeit mit einer Gurke – einer sehr großen Gurke.
Allerdings hing er nicht reglos herab, wie es üblicherweise zu erwarten stand, stattdessen hob er sich in einer fließenden aber gemächlichen Bewegung von der Wand ab in die Luft, wobei seine Spitze sich nach allen Richtungen neigte, genau wie eine Schlange, die suchend umherzüngelte. Was auch immer das zu bedeuten hatte, es ging jedenfalls weit über die normalen Zuckungen einer beginnenden Erektion hinaus. Staunend verfolgte Maria diesen Vorgang, während dem Emilias dicker langer Schwanz sich so stetig wie unmerklich immer weiter ihrem Gesicht näherte.
Irgendwann trat das Unausweichliche ein und er streifte ihre Wange. Dabei hinterließ er einen nassen Fleck, den sie warm auf ihrer Haut spüren konnte, doch war ihm das offensichtlich nicht genug. Angelockt von dieser ersten zufälligen Berührung schnellte er sofort zurück, hin zu dem weichen Fleisch, das er soeben entdeckt hatte. Das erkundete er nun ausschweifend. Unaufhörlich tatete er Maria ab, fuhr über ihre Stirn, den Hals hinab und auf ihre Schulter, nur um sich mit dem brennenden Verlangen, das ihm innewohnte, gleich wieder hinaufzuschwingen. Jede Stelle ihres Körpers, mit dem er in diesem wilden Taumel auch nur flüchtig zusammentraf, benetzte er mit dieser klebrigen Substanz; Vorsamen, wie Maria wußte. Seltsamerweise beschränkte sich diese Flüssigkeitsabgabe nicht auf sein Ende, den Teil, den sie als Eichel anerkannte. Auch wenn sie sich dort konzentrierte, schien er über und über in dieses Sekret getaucht zu sein.
Maria entzog sich diesem Bad nicht, so schleimig es auch war. Darin sah sie keinen Sinn, überhaupt mußte sie zugeben, daß es ihr sogar gefiel. Heiß fühlte sie die Besudelungen an sich haften und sämig hinunterrinnen, während immer weitere hinzukamen, als der monstöse Penis beständig über sie hinwegstrich. Auf diese Weise patschte er unablässig in seinen eigenen Saft hinein, ihn immer weiter über ihr verteilend, sodaß ihr Gesicht bald vollständig von ihm überzogen war.
Schließlich fand der ruhelos umherstreifende Schwanz, was er wohl gesucht hatte. Bei der Sorgfältigkeit, mit der er jede ihrer Unebenheiten erkundete, war es nur eine Frage der Zeit, bis er über ihren Mund stolperte. Diesmal gab es kein vorübergehendes Zurückzucken, wie bei seiner ersten Annäherung an ihren Körper. Sobald der samennasse Penis sich auf ihre Lippen gelegt hatte, drang er auch schon zwischen sie. Begehrlich aber nicht ohne Rücksicht schob er sich tiefer in ihren Mund, schmiegte sich sanft an ihre Zunge und verweilte dort, während er sich in wellenförmigen Bewegungen an ihr rieb.
Unbekümmert ließ Maria es geschehen. Es war ohnehin nichts anderes als das, was sie selbst vorgehabt hatte, nur daß jetzt Emilia, oder deren von Lust getriebenes Geschlechtsorgan, die Initiative übernahm. Als sie merkte, daß sie nichts weiter zu tun hatte und der Schwanz des Mädchens von allein seine Erlösung in ihr finden würde, solange sie ihm nicht die Körperöffnung vorenthielt, in die er sich so stürmisch schlängelte, machte sie es sich ein wenig bequemer. Zuvor hatte sie erwartungsvoll dicht vor dem Loch in der Wand gehockt, doch das war nicht länger nötig. Zwar hatte sie bei ihren früheren Besuchen dieses Orts bereits gelernt, daß die Latten von Halbdämoninnen jede nur erdenkliche Form haben konnten, trotzdem hatte sie damit nun wirklich nicht gerechnet, weder mit dieser erstaunlichen Länge, noch damit, daß er von sich aus in sie stoßen würde.
In den nunmehr sechs Tagen seit Bestehen dieser Möglichkeit, hatte sie hier nicht nur allen ihren Klassenkameradinnen einen geblasen, die die entsprechenden Voraussetzungen dazu mitbrachten, sondern auch einigen Schülerinnen anderer Jahrgänge, von denen sie nicht einmal ihre Namen kannte. Als sie hier gewartet und in die andere Kabine gespäht hatte, ob vielleicht eine geeignete Kandidatin auftauchen würde, hatte sie einfach zufällig entdeckt, wer noch einer solchen Abstammungslinie entsprang und bisher hatte sich noch niemand geweigert, zumindest nicht nach ein paar zutraulichen Worten. Natürlich hätte sie auch Lilly fragen können, aber das erschien ihr zu auffällig. Die Information, wer aus ihrer Klasse dazugehörte, hatte sie im Zuge der Offenheit, mit der sie ihr gegenüber ihren Plan besprach, selbst preisgegeben. Wie Maria sie dazu bringen sollte, ihr zu verraten, wie es um die übrige Schülerschaft bestellt war, ohne daß sie etwas ahnte, hatte sie sich nicht ausdenken können.
Letztendlich war das gar nicht nötig gewesen, sie hatte auch so genug ausfindig machen können, um ihre Gelüste mehrmals am Tag zu befriedigen, zumal sie es erst in diesem Moment geschafft hatte, das letzte verbliebene, ihr bekannte Mitglied dieser Gemeinschaft herumzukriegen. So viele ganz unterschiedliche Schwänze zu haben, die ihr zur freien Verfügung entgegengestreckt wurden, war mit Abstand das Schönste, was sie je erlebt hatte. Der von Fantasma zum Beispiel glich völlig denen der Jungs aus dem Dorf, die Maria flachgelegt hatte, außer daß er um einiges kleiner war. Er war so kurz geraten, daß nicht mehr viel von ihm herausragte, nachdem Fantasma ihn ihr durch die Wand hindurch hingehalten hatte, und da sie trotz all ihrer sich selbst herabsetzenden Taten doch Vorbehalte hatte, das Innere einer Toilettenzelle mit den Lippen zu berühren, war es ziemlich anstrengend gewesen, ihn zum Abspritzen zu bringen, so bedächtig wie sie dabei hatte vorgehen müssen.
Dieses Problem bestand jetzt nicht. Sie hatte sich gemütlich auf ihre untergeschlagenen Beine gesetzt und den Rücken durchgebogen, während Emilias Penis sich von allein in ihrem Mund umherwand. Für sie war es das erste Mal, daß beim Blasen jemand anderes den ausführenden Teil übernahm. Natürlich besaß sonst wohl auch niemand einen solch lebhaften Ständer und hier vor einem Loch in der Wand war es wahrscheinlich sehr viel einfacher, wenn sie es selbst tat, doch schon zuvor, bei ihren flüchtigen Bekanntschaften aus der Stadt in der Nähe des Internats, hatten die Jungs immer stillgehalten, als Maria sie auf diese Weise bedient hatte.
Obwohl sie kein Problem damit hatte, die mühsamere Rolle auf sich zu nehmen und schon lange eine besondere Faszination für diese Spielart der Lust hegte, weshalb sie ja auch diesen Platz geschaffen hatte, an dem sie ihr ebenso sorglos wie anonym nachgehen konnte, erregte es sie aus irgendeinem Grund noch weitaus mehr als jemals zuvor, daß es nun anders war. Es hatte etwas seltsam erfüllendes an sich, schlicht dazusitzen und den stetig in sie fahrenden Schwanz gewähren zu lassen, wie er sich in ihrem Körper von sich aus befriedigte. Das war nicht nur die simple Freude an etwas neuartigem, nein, das sprach etwas tief in ihr an, das sie sich zwar nicht erklären konnte, dem sie sich jetzt aber trotzdem willenlos hingab. Es war nicht einmal die unbestimmte Neigung dazu, sich zu unterwerfen, da war sie sich ziemlich sicher, oder die Erinnerung an den sie doch eigentlich auf sehr viel unmittelbarere Weise stimulierenden Geschlechtsverkehr an sich, bei dem sie bei ihren Eroberungen auch nur ruhig auf dem Rücken zu liegen hatte, während sie sich in ihr ergingen. Es lag einzig daran, daß er sich so verlangend in sie zwang, was sie im höchsten Maße aufreizte; es war der unwiderlegbare Beweis, wie sehr Emilia sich nach ihr und dem, was sie zu bieten hatte, verzehrte.
Dieser Umstand hatte eine so unwiderstehliche Wirkung auf sie, daß sie noch immer am Boden hockend die Beine spreizte und sich mit einer Hand in den Schritt griff. Sonst onanierte sie nicht, wenn sie es jemandem mit dem Mund machte. Für gewöhnlich reichte ihr die Gewißheit, demjenigen absolute Ekstase zu verschaffen, daß sie ebenfalls ihren Spaß dabei hatte, wenn sie auch nicht selbst zum Orgasmus kam. Doch jetzt konnte sie nicht anders. Sie hatte das Gefühl, vor lauter angestauter Geilheit platzen zu müssen, wenn sie ihr nicht so wenigstens ein bißchen Erleichterung verschafft hätte.
Also zog sie den Reißverschluß ihrer Hose herunter, ohne sie jedoch aufzuknöpfen, dann ließ sie zwei Finger hineingleiten und streichelte mit ihnen über den Stoff des Höschens hinweg ihren Schlitz. Diese Art der Selbstbefriedigung hatte sie für sich in Situationen entdeckt, wenn sie in Gefahr stand, dabei erwischt zu werden. Manchmal, etwa während der Pause in einem unverschlossenen Klassenzimmer, war es besser, vorbereitet zu sein und schnell so tun zu können, als beschäftige man sich gerade mit völlig unverfänglichen Dingen statt dem, dessen man sich tatsächlich widmete. Hin und wieder überfiel sie dieses Verlangen eben ganz unvermittelt, völlig egal wo sie sich aufhielt. In diesen Fällen blieb ihr gar keine andere Wahl, als etwas verstohlener zu Werke zu gehen und es durch ihre noch immer angezogenen Kleider zu tun.
Irgendwann hatte sie allerdings bemerkt, wie aufreizend diese Methode war. Zwar war der Slip danach bis zur Unbrauchbarkeit durchtränkt, doch das war es allemal wert. Diese verhüllte Berührung ließ ihre Haut darunter heftiger kribbeln, als es direktere Zuwendungen vermochten. Woran auch immer das lag, ob nun an dem Gefühl der Verdorbenheit, das es mit sich brachte, oder daran daß durch die Unebenheit des Gewebes die Wirkung verstärkt wurde, auf jeden Fall ließ es sie jedesmal vor Lust erbeben, wenn sie es sich auf diese Weise machte.
Ebenso wie jetzt. Sachte pulsierte die Scheide unter ihren reibenden Fingern, während Emilias biegsamer Schwanz sich weiterhin in ihrem Mund vor und zurück schob. Durch die Unbändigkeit, mit der er sich an ihr Inneres drängte, hatte sich schnell sein Geschmack in ihr ausgebreitet. An sich unterschied der sich nicht weiter von dem anderer Penisse, die sie bisher hatte kosten dürfen, ob menschlich oder dämonisch. Im Grunde schmeckten sie alle gleich, ein wenig als würde man an einem Finger nuckeln, nach warmer Haut und der Begierde, die sie verströmten, nur deutlich süßlicher. Obwohl er nahezu völlig in ein glitschiges Sekret getaucht war, schien das nichts zu dieser Vielfalt beizutragen. Es war kaum zu bemerken, außer das seine Konsistenz übermäßig zu spüren war. In dieser Hinsicht verhielt es sich wie der Vorsamen, der nun ebenfalls ununterbrochen in Maria hineinregnete. Als Nuance in einem Gemenge blieb es unmerklich, doch legte es sich zäh um die Zunge, wo es hartnäckig haften blieb.
Als sie sich selbst befingernd in Erinnerungen an ihre bisherigen Erlebnisse auf diesem Gebiet versank, kam ihr wieder ihr Abenteuer mit Lilly an diesem Vormittag in den Sinn. Es war ausgesprochen komisch gewesen, ihr nach alldem einen zu blasen. Zwar hatte sie auch schon mit ihr geschlafen, doch war das auf Befehl Frau Ferrias passiert und außerdem geschehen noch bevor sie irgendetwas von Lillys Herkunft oder Schicksal gewußt hatte. Zu diesem Zeitpunkt war Maria geradezu vollkommen ahnungslos gewesen, und obwohl das erst wenige Monate her war, kam es ihr wie eine Ewigkeit vor. Inzwischen hatte sie nicht nur viel mehr über Lilly erfahren, sondern sich sogar mit ihr angefreundet, was auch der Grund für ihr Unbehagen gewesen war, als sie es ihr vorhin hier besorgt hatte. Nachdem sie sich näher kennengelernt hatten, war Maria klargeworden, daß sie das offensichtlich ausschließlich in Schwarz herumlaufende Mädchen mehr mochte, als sie zunächst gedacht hätte. Nicht so sehr, daß sie mehr als Sympathie für sie empfunden hätte, aber immerhin konnte sie Lisas Gefühle für sie jetzt nachvollziehen.
Dennoch hatte sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen können. Als sie gesehen hatte, wie Lilly dort mit offener Hose stand, hatte sie sich einfach nicht zurückhalten können. Es war ihr durchaus schon vorher klar gewesen, daß es seltsam sein würde, jemanden zu beglücken, dem man so nahestand wie sie beide, doch dieses Wissen beeinträchtigte ihren Drang keineswegs. Auch wenn sie sich nicht zu Lilly hingezogen fühlte, hatte sie in Marias erotischen Träumen doch hin und wieder eine Rolle gespielt. Sie konnte noch nicht einmal behaupten, daß sie nicht bemerkt hätte, wie gut sie aussah. Unter ihrer Blässe und der unvorteilhaften Kleidung, die sie immer trug, verbarg sich eine Schönheit, die nicht zu übersehen war. Wahrscheinlich hatten diese widersprüchlichen Empfindungen auch den Grundstein dafür gelegt, daß sie nun Halbdämoninnen als Objekt zur Auslebung ihrer Triebe diente statt irgendwelchen wahllosen Zufallsbekanntschaften und vor allem dafür, daß sie endlich zu sich selbst gefunden hatte, daß sie ihr Innerstes akzeptiert hatte, indem sie ihre Liebe zu Emilia akzeptiert hatte.
Abgesehen davon war ihre Nummer mit Lilly nicht weiter ungewöhnlich gewesen. Sie war genauso verlaufen wie die zahlreichen übrigen Gunstbezeugungen, die sie hier geleistet hatte. Ganz anders als jetzt. Natürlich war Emilias Schwanz nun wirklich nicht als gewöhnlich zu bezeichnen, sonst hatte wohl niemand einen, der sich aus eigenem Antrieb in die ihm dargebotenen Körperöffnungen schlängelte, doch das war es gar nicht, was diese Sache für Maria so besonders machte. Es war der Penis des Mädchens, in das sie sich entgegen aller Konventionen verliebt hatte, der sich gerade in ihrem Mund vergnügte, und schon alleine deshalb war es für sie unvergleichlich. Den Gedanken, daß andere sie für hübsch hielten, hatte sie schon immer als sehr erregend erachtet, daß es später so weit ging, daß Männer wie Dämoninnen sie dermaßen begehrten, daß sie ihnen einen Höhepunkt verschaffen konnte, war nur die logische Konsequenz daraus. Diesmal jedoch würde es ihre heimliche Angebetete sein, die ihr heißes Sperma in sie spritzte, diesen Nektar der Liebenden, unverkennbares Anzeichen höchster Anziehung. Daß Emilia nicht wissen konnte, daß es sich dabei um sie handelte, der diese Hingabe galt, machte in ihrem in tiefste Lust versunkenen Verstand keinen Unterschied. Es wäre immer noch ihr allein geschuldet, wenn sie sich in ihr erleichtern durfte.
Von dieser Vorstellung befeuert ließ sie ihre Hand ungestümer über ihren Schritt wandern. Die Finger durch den heruntergezogenen Reißverschluß ihrer Hose gesteckt, rieb sie hektisch ihre vom Slip eingehüllte Scheide. Zuvor hatte sie es ruhig angehen lassen, hatte sanft über ihren Schlitz hinweggestrichen, vom unteren Ende bis hinauf zum Kitzler und wieder zurück. Zuweilen hatte sie sogar kurz innegehalten, um die Kuppe ihres Zeigefingers in diese Öffnung hineinzudrücken. Selbstverständlich drang sie nicht wirklich ein, aber darum ging es ihr auch gar nicht. Sie hatte sich beim Masturbieren ohnehin schon immer lieber auf die äußeren Teile ihres Geschlechts konzentriert. Zweifellos war es ebenfalls berückend, sich etwas einzuführen, doch nicht auf eine so unmittelbare Weise, als wenn sie sich einfach streichelte. Das Gefühl, ausgefüllt zu werden, war irgendwie warm und angenehm, trotzdem wirkte es mehr auf ihren Geist als den Körper.
Jetzt hingegen fehlte ihr der Sinn für solche Feinheiten. Während Emilias beweglicher Schwanz sich weiterhin von selbst in ihrem Mund austobte, spielte Maria rückhaltlos an sich herum. Obwohl sie sich dabei nach wie vor auf ihre Schamlippen und die Klitoris beschränkte, kam es ihr so vor, als wäre ihr gesamter Intimbereich miteinbezogen. Mitgerissen von der rasanten Geschwindigkeit ihrer eigenen Handschläge verschob sich der dünne weiche Stoff ihres Höschens, glitt über ihren Venushügel, die Hinterbacken und die entlegeneren Gebiete ihrer Scham, wo er überall auf ihrer Haut ein leichtes Kitzlen auslöste, als würde sie dort jemand kaum merklich berühren. Wie sie vorhergesehen hatte, war er mittlerweile vollständig von ihrem Saft durchnäßt, doch wußte sie, daß sich der breite Fleck auf der Vorderseite schon bald noch vergrößern würde. Ihr Orgasmus stand kurz bevor und würde ohne Frage einen weiteren Schub Flüssigkeit mit sich bringen.
Plötzlich war es so weit. Noch ehe sie damit gerechnet hatte, sackte sie in sich zusammen, als sich sämtliche ihrer Muskeln auf einmal zu verkrampfen schienen. Beinahe sofort darauf lösten sie sich wieder in einem weißen Blitz, der ihren Leib und ihr Bewußtsein gleichermaßen durchzuckte. Helle Sterne tanzten vor ihren geschlossenen Lidern und ein vernehmbares Stöhnen drang trotz des sie versiegelnden Schwanzes zwischen ihren Lippen hervor, während sie sich allmählich wieder entspannte. Die an ihrer Scheide herumflitzende Hand verlor erst ihre Zielstrebigkeit, dann ließ sie sich endgültig kraftlos fallen. Es war ein restlos erfüllender Höhepunkt, auch wenn sie wußte, daß dieser Frieden nicht lange vorhalten würde. Pure Ekstase raste durch sie hindurch, erschütterte sie geradezu und ließ sie erschöpft zurück.
Während sie reglos dasaß, eine Hand schlaff zwischen ihren Beinen hängend, und Emilias riesiger Penis sich weiter stetig in ihren Mund quetschte, beschloß Maria, ihr einen ebenso berauschenden Genuß zu verschaffen, wie sie ihn gerade gehabt hatte. Sie wußte genau, was sie zu tun hatte, um das zu erreichen, immerhin konnte sie auf einige Erfahurng diesbezüglich zurückgreifen. Die junge Halbdämonin hatte sich schon lange genug in ihr verausgabt, daß sich eine entsprechende Menge Lust in deren Lenden angestaut haben mußte, nun fehlte nur noch eine letzte zusätzliche Sensation, damit sie sich mit solcher Nachdrücklichkeit entlud.
Ihre erste Maßnahme war, die Lippen enger um den Schwanz in ihrem Mund zu ziehen. Bislang hatte sie ihm einfach bereitwillig diese feuchte Höhle entboten und ihn dann darin sich selbst überlassen, nun jedoch würde sie ihre Gastfreundschaft aufmerksamer zur Geltung bringen. Marias Lippen, die sich fest um seine konisch zulaufende Spitze preßten, mußten die Gefühle, die er bei seinen unablässigen Stößen in sie empfand, um ein Vielfaches intensivieren, hinderten ihn aber daran, die Wucht seiner Bewegungen aufrechtzuerhalten. Zuvor hatte er sich mühelos in sie hinein und hinaus geschlängelt, jetzt mußte er in einem weiten Bogen ausschlagen, um nur ein Stückchen in sie vorzudringen, dafür wand sich der Teil des wimmelnden Geschlechts, den sie in sich aufgenommen hatte, mit noch mehr Kraft umher. Um das auszugleichen, drückte sie ihm ihre Zunge entgegen, umfing mit ihr die wild herumtastende Eichel und umspielte sie zärtlich.
Die erwartete Reaktion erfolgte umgehend. Leise hörte Maria das Mädchen auf der anderen Seite aufkeuchen und ein weiterer, erstaunlich großer Schwall Vorsamens ergoß sich in sie. Gleichzeitig wurde Emilias Penis immer schneller und raste nun mit ungeahnter Vehemenz zwischen die sich dicht an ihn schmiegenden Lippen. Maria liebte es, wenn die jungs, denen sie einen blies, sich irgendwann vor lauter Leidenschaft nicht länger zurückhalten konnten und ihr Becken unwillkürlich zu zucken begann, und auch wenn an dieser speziellen Hermaphroditin alles noch etwas außergewöhnlicher war als bei den anderen, denen sie so nahegekommen war, vermutete sie dennoch, daß es sich um dasselbe Prinzip handelte. Jedenfalls hatte sie genug Schwänze gelutscht, um mit Sicherheit sagen zu können, daß Emilia nicht mehr lange durchhalten würde.
Diese Annahme stellte sich schon bald als richtig heraus. Nur ein paar Mal noch warf sich ihr der eigenwillige Penis entgegen, dann kam es ihm. Heiß spürte Maria den Samen in ihren Mund schießen und sich darin verteilen. In einem nicht enden wollenden, ununterbrochenen Strahl floß er in sie hinein, legte sich auf ihre Zunge und wogte darauf dickflüssig umher. Sie hielt Sperma nicht für grundsätzlich ansprechend oder wohlschmeckend, aber trotz seiner eher unangenehmen Eigenschaften hatte es irgendetwas an sich, das sie stets erregte, wenn sie damit in Kontakt kam. Sie fand es einfach hinreißend, wie sich ihr Mund immer weiter mit dem glibberigen Zeug anfüllte, bis sich sogar ihre Wangen aufblähten.
Schließlich war er so voll, daß nicht einmal der kleinste Tropfen mehr hineinpaßte, doch hielt der Strom noch immer an. Zwar war der einigermaßen langsam aber überraschend kraftvoll, sodaß der überschüssige Samen hinausgepreßt wurde und über ihre Lippen schwappte. Als das geschah, ließ sie den nun reglosen Schwanz aus sich hervorgleiten, ergriff ihn mit einer Hand und hielt ihn sich vor das Gesicht. Den Mund nach wie vor mit Ejakulat überladen spritzte der fortlaufende Samenerguß immer mehr davon auf sie hinab; Stirn, Wangen und Lippen großflächig benetzend. Sie genoß es, wie es warm an ihrer Haut herabrann, doch war das nicht der Grund, aus dem sie sich nun äußerlich von ihm beschmutzen ließ. Obwohl sie heute bereits zwei Ladungen übermenschlichen Ausmaßes in sich aufgenommen hatte, stellte sich für sie gar nicht die Frage, ob sie Emilias ebenfalls noch schlucken wollte. Selbstverständlich würde sie das tun, nur wollte sie es auch in allen Einzelheiten auskosten können. Immerhin war das hier nicht irgendein weiterer Penis, den sie beglückte, sondern das erste Mal, daß sie die Sahne ihrer heimlichen Geliebten probieren durfte.
Sie in sich spürend, wichste sie Emilia behutsam, bis die Flut schließlich versiegte. Der letzte Rest der ausklingenden Fontäne bedeckte noch ihr Handgelenk mit der klebrigen Nässe, dann quoll ein einzelner Faden hervor, der träge vom Loch an der Eichel herabhing. Der Schwanz, der sich während seines langanhaltenden Auslaufens so steif gemacht hatte, wie man es von ihm die ganze vorige Zeit über hätte erwarten können, erschlaffte nun in ihrer Hand. Als sie ihn losließ, baumelte er untätig wie jede nachlassende Erektion von der Wand herab, und obwohl Maria ihn merklich schrumpfen sah, blieben seine Länge sowie sein Umfang gewaltig. Es mußte ebenso merkwürdig wie himmlisch sein, ihn ihre Scheide einzulassen, doch das würde sie wohl oder übel erst einmal hintenanstellen müssen.
Emilias Verlangen offenbar befriedigt und das eigene Gesicht voll mit deren Sperma sah sie zunächst die Gelegenheit gekommen, die Kostprobe davon in ihrem Mund entsprechend zu würdigen. Mit der Zunge rührte sie ein wenig darin herum, um Beschaffenheit und Aroma in sich aufzusaugen, bevor sie tief einatmete und endlich schluckte. Wie schon in ihren Wangen rann die schleimige Flüssigkeit nur sehr schwerfällig hinab. Zäh wälzte es sich ihren Hals entlang, und sie glaubte, es dabei umherwabern zu spüren, als wäre es ein sich langziehendes Gemisch aus verschiedenen Säften und Sirup. Sie mußte erneut schlucken, um alles hinunterzubekommen, aber selbst danach kam es ihr so vor, als wären Rückstände davon überall in ihr zurückgeblieben.
Abgesehen von der schieren Menge, die es diesmal zu bewältigen galt, war das alles jedoch nichts neues für sie. Nicht nur der Samen der übrigen Halbdämoninnen, auch der der Jungs aus der naheliegenden Ortschaft war ganz ähnlich geartet gewesen. Trotzdem konnte Maria nicht anders als still sitzenzubleiben und die ganze Situation an sich voll auszuschöpfen. Der warme Nektar auf ihrer Haut, dessen Geschmack auf ihrer Zunge, der Anblick des besänftigten Geschlechts vor sich; in diesem Moment fühlte sie sich nicht nur begehrt, sie fühlte sich geliebt. Auch wenn es Emilia wahrscheinlich nur um die schnelle Beschwichtigung ihres Triebs gegangen war, für sie war es ein Akt der Liebe gewesen.
Während sie verträumt dasaß, hörte sie auch ihre Freundin auf der anderen Seite noch eine Weile schwer vor sich hin atmen, ehe sie ihren Penis aus dem Loch in der Wand zog. Sie räusperte sich, schien aber nicht recht zu wissen, was sie sagen sollte. So war es den meisten ergangen, die Maria hier auf diese Weise überrascht hatte.
»Danke«, brachte Emilia schließlich hervor, »das war sehr schön, aber ich, äh, denke, ich sollte jetzt lieber gehen.«
»Schade«, sagte Maria, ihre Stimme beinahe zu einem Seufzen verklärt. »Aber du kannst ruhig wiederkommen. Ich bin öfter hier.«
»Ich schätze, das werde ich.«
Ein vernehmbares Rascheln verriet Maria, daß sie ihre Kleidung ordnete und glattstrich, dann verließ Emilia ihre Kabine. Draußen angekommen gesellte sie sich zu ihren Clubmitgliedern, die in einiger Entfernung bei den Waschbecken warteten.
»Hey«, hieß Fantasma sie willkommen zurück, »was hat denn so lange gedauert? Weißt du, für den Beweis hätte es völlig gereicht, wenn sie gefragt hat, du hättest nicht unbedingt darauf eingehen müssen.«
Unbeteiligt zuckte Emilia mit den Schultern. »Ich wollte eben lieber ganz sicher gehen.«
»Und?«, fragte Fantasma lächelnd. »Bist du dir jetzt sicher?«
»Ja. Es ist eindeutig das Mädchen, das wir suchen.«
»Gut«, übernahm nun Emma wieder die Führung. Ermittlungen waren immerhin ihre Profession. Mit festen Schritten ging sie auf die Kabine zu, in der sich die Denunziatin aufhielt. Sie pochte gegen die verschlossene Tür, rief aber ohne eine Antwort abzuwarten gleich hindurch: »Okay, du kannst aufmachen. Wir wissen, daß du da drin bist.«
Hinter der Abtrennung blieb alles still.
»Komm schon, wo willst du denn hin? Wir können hier das ganze Wochenende über warten.«
Abschätzig beobachtete Emilia Emmas weitere Versuche, das Mädchen zum Öffnen der Tür zu überreden. Obwohl deren Argumente durchaus einleuchtend waren, bezweifelte sie, daß sie Erfolg haben würden. Wer auch immer in dieser Zelle saß, wollte offenbar nicht erkannt werden, was Emilia gut nachvollziehen konnte. Nachdem diese Person ihnen allen einen geblasen hatte, ohne daß sie untereinander darüber Bescheid wußten, wäre es unermeßlich peinlich gewesen, ihnen jetzt unter die Augen zu treten. Das zu verhindern war auch gar nicht weiter schwierig, dazu mußte sie nur weiterhin dort bleiben, wo sie war. Zwar hatte Emma Recht, sie saß darin fest, doch zu ihr hinein konnte auch niemand, und was sollte sie daran hindern, so lange darin zu bleiben, bis sie einfach irgendwann gehen mußten?
Inzwischen hatte Emilia allerdings selbst ein Interesse daran, deren Identität in Erfahrung zu bringen. Konnte es wirklich sein, daß es Maria war? Dieses so erhabene, ehrfurchteinflößende Mädchen? Die Vorstellung jedenfalls hatte ihren ohnehin schon bröckelnden Widerstand, als sie vorhin in der Kabine gestanden und überlegt hatte, ob sie die Offerte annehmen sollte oder nicht, endgültig gebrochen. Sogar die Stimme, auch wenn sie fraglos verstellt gewesen war, hatte wie sie geklungen.
Letztendlich gab es nur eine Möglichkeit, alle Zweifel auszuräumen: Sie mußten die betreffende Schülerin dazu bringen herauszutreten, und Emilia hatte auch schon eine Idee, wie sich das bewerkstelligen ließe. Während Emma ihr Klopfen mittlerweile eingestellt hatte und die Tür stattdessen finster anstarrte, als wäre sie allein dadurch zum Aufschwingen zu bewegen, dah sie sich in dem Raum um. Ein Fenster gab es nicht, das einzige Licht kam von den hellen Deckenlampen. Ein Schalter war ebenso wenig zu entdecken. Emilia hatte sich noch nie Gedanken darüber gemacht, aber wahrscheinlich brannte in Schultoiletten wohl ständig das Licht, so lange noch jemand anwesend war, und da sie sich hier in einem Internat befanden, war die Bedingung stets gegeben, daß jemand diese Örtlichkeiten aufsuchen wollte.
So sehr sie das verstand, für ihren Plan war das ein Hindernis, denn auch wenn Emma etwas anderes vermutet hatte, war ihr damals Marias Reaktion nicht entgangen, als in der Aula vor Frau Flimms Ansprache unvermittelt das Licht gelöscht worden war. Das Nachtlich in ihrem Zimmer war lediglich ein weiterer Hinweis. Allerdings war dieses Hindernis nicht unüberwindbar. Erneut blickte sie zu den Lampen hinauf und konzentrierte sich auf sie. Es war schwer, beinahe unmöglich, aber schließlich gelang es ihr. Erst flackerten die Leuchtstoffröhren, dann erstarben sie völlig. Die Finsternis, die plötzlich auf sie herabfiel, war absolut, und obwohl Emilia sie nur einige Sekunden lang aufrechterhalten konnte, reichte es. Jeder in dem Raum erschrak, doch nur dem Mädchen in der Kabine entfuhr ein schrilles Keuchen, das schon fast einem unterdrückten Aufschrei gleichkam.
Als das Licht wieder anging, trat Emilia vor die verschlossene Tür, die verwirrten Blicke ihrer Freundinnen konsequent ignorierend. Mit einer Handbewegung bedeutete sie Emma beiseitezutreten, lehnte sich dicht an die dünne Abtrennung aus Spanholz und flüsterte so leise, das es selbst in der nun herrschenden Stille nicht mehr als eine dahingehauchte Zärtlichkeit war: »Maria? Komm raus. Ich weiß, daß du das bist.«
Trotz der sanften Bestimmtheit ihrer Stimme regte sich zunächst nichts in der Kabine. Die Zeit, in der sie alle schweigend herumstanden, zog sich immer weiter in die Länge, bis endlich doch ein Klacken zu hören war. Die Tür wurde entriegelt und langsam schwang sie auf.