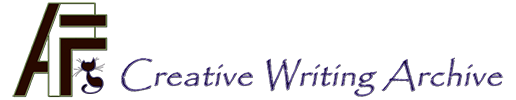Liebe und Verdammnis - Des Desasters dritter Teil
Königin der Schatten
~5~
Königin der Schatten
Während Isabelle also der Wächterin zu den Stallungen folgte, um dort ihre geheimsten Wünsche zu ergründen, setzten die nunmehr verbliebenen Mitglieder des Freak-Clubs ihren Weg zum Palast fort. Sie steuerten direkt auf das große Tor zu, ein doppelflügeliges Portal aus schwerem, mit Eisen beschlagenem Holz, das in die dicken Mauern aus grob behauenem Felsgestein eingelassen war. Rechts und links davon hingen Fackeln in dafür vorgesehenen Halterungen, die abgesehen vom schwachen Leuchten der Gestirne am Himmel die einzigen Lichtquellen in der Nähe darstellten. Ihr flackernder Schein erhellte jedoch kaum den kleinen Vorplatz um die Tür herum, stattdessen verstärkte er eher noch den Eindruck, dass sie in der Dämmerung einer aufziehenden dunklen Nacht durch ein verwunschenes Moor schritten.
Unter den Fackeln standen zwei Wächterinnen, die je eine Seite des Tors bewachten. Sie verlangten aber keine ungehörigen Dienste für den Durchlass. Sie hatten gesehen, wie die Mädchen von Semia kontrolliert worden waren, und nahmen deshalb an, dass mit ihnen alles in Ordnung war. Nach einer oberflächlichen Erkundigung nach dem Grund ihres Hierseins, bei der sie erfuhren, dass es sich bei ihnen um die neuen Hausmädchen handelte, die im Zuge des momentan sprunghaft angestiegenen Personalbedarfs spontan hinzugezogen worden waren, öffneten sie den jeweiligen Flügel des Tors an ihrer Seite und ließen sie hindurch.
Auch das Innere des Palasts erinnerte an eine mittelalterliche Burg. Durch das Tor gelangten sie in eine große runde Halle, die zwar entsprechend der niedrigen Architektur keine höher gelegene Decke hatte, aber sehr weitläufig war. Eine Menge Türen führten von hier tiefer in das Gebäude hinein, jede bewacht von einer Wächterin in der ihnen mittlerweile bekannten schwarzen Uniform. An den Wänden waren Fenster noch Fackeln zu entdecken, trotzdem wurde die gesamte Halle von einem gespenstischen grünlichen Leuchten erfüllt. Neugierig sahen sich die Mädchen nach seinem Ursprung um, doch dauerte es ein wenig, bis sie ihn gefunden hatten: die Decke war von einem seltsamen Geflecht überzogen, wie von miteinander verwobenen Kletterranken, die ein sanftes Phosphoreszieren ausstrahlten.
Staunend betrachtete Fantasma diese fremdartigen Pflanzen. Für sie war das der endgültige Beweis, dass sie sich in einer magischen Welt befanden, dem Wunderland, wo phantastische Begebenheiten zur Normalität gehörten, wo es werwolfähnliche Wesen gab und Pflanzen eben von einem unheimlichen Glühen durchdrungen waren. Leider war Isabelle ja gerade anderweitig beschäftigt, ansonsten hätte sie Fantasma erklären können, dass das gar nicht so sonderbar war, wie sie dachte. Schließlich gab es auch auf der Erde einige Arten biolumineszenter Pilze, die denen hier ganz ähnlich waren. Es war gar nicht verwunderlich, dass die Dämoninnen, die mit ihren Kräften nie auf Technik angewiesen waren, sich dieser Pilzkultur bedienten, um dieses dunkle Gemäuer zu erhellen, wo es mit Fackeln schnell ein Problem mit dem nötigen verfügbaren Sauerstoff gegeben hätte. Vielleicht wurden sie im Limbus sogar gezüchtet und in jedem Haus und an öffentlichen Plätzen angesiedelt. An dieser Stelle hätte Isabelle wahrscheinlich gleich einen ganzen Vortrag über Luciferine, Photoproteine und Superoxiddismutase gehalten, den wir unter den gegeben Umständen aber wohl auslassen können.
Im Gegensatz zu Fantasma zeigte Emilia sich wenig beeindruckt. Sie war nämlich mit ihrer damaligen Schulklasse in einem Aquarium gewesen, und die Lichtstimmung hier unterschied sich für sie nicht großartig davon; außerdem war sie einfach zu praktisch veranlagt, um sich von so etwas verzaubern zu lassen, während sie im wahrsten Sinne des Wortes umzingelt war von einem Haufen Wächterinnen, die sie misstrauisch beäugten.
»Wo müssen wir jetzt lang?«, wisperte sie unauffällig Lilly zu und versuchte dabei, ihre Lippen so wenig wie möglich zu bewegen.
»Geradeaus. Lisa scheint genau in der Mitte des Palasts zu sein«, antwortete Lilly ohne zu zögern. Sie musste sich nicht einmal konzentrieren, um das zu spüren. Auf diese Entfernung war die Präsenz ihrer Freundin für sie wie das Wirken eines Magnets, der sie unaufhörlich zu sich zog.
»Dann lasst uns gehen«, sagte Emilia leise und ging voran. Sie gab sich größte Mühe, einen selbstbewussten Eindruck zu machen, als sie auf die Tür gegenüber zulief, baute sich vor der Wächterin auf und sagte: »Wir sind die neuen Hausmädchen. Wir sollen zu, äh…«
»Zu Juvi? Der Haushälterin?«, half die Wächterin ihr aus.
»Äh, genau.«
Die Wächterin nickte. »Dritte Tür rechts«, sagte sie, öffnete die Tür für die Mädchen und winkte sie hindurch.
»So weit, so gut«, seufzte Emilia auf, nachdem sich die Tür hinter sich ihnen geschlossen hatte. »Und was jetzt?«
»Jedenfalls sollten wir nicht die dritte Tür rechts nehmen«, sagte Fantasma, während sie sich in dem Gang umsah, den sie nun betreten hatten. Er war breit und verlief ein ganzes Stück schnurgerade vorwärts mit Türen zu beiden Seiten, bis er am Ende auf einen quer angelegten Korridor stieß.
Lilly zuckte mit den Schultern. »Erst mal müssen wir hier lang.« Zügig lief sie den Gang hinab, bis die steinerne Mauer ihren weiteren Weg blockierte, dann blickte sie zweifelnd in beide Richtungen. Es schien keinen Unterschied zu machen, wo sie weitergingen. Die zwei Hälften dieses Korridors sahen exakt gleich aus und wirkten auch nicht anders als der, den sie gerade genommen hatten. Ihrer Intuition folgend entschloss sie sich, links entlang zu gehen, hielt allerdings sofort wieder an der ersten Tür, die nach rechts führte.
»Tja«, sagte sie, »in Luftlinie müssten wir hier lang. Was meint ihr? Sollen wir es versuchen?«
Die Zwillinge und Fantasma begegnetem diesem Vorschlag offenbar mit einigen Vorbehalten, doch Emilia war nicht bereit, hier erst lange das Für und Wider mit ihnen auszudiskutieren. Das war immerhin einer der Hauptkorridore eines Palasts, der würde bestimmt nicht ewig so ruhig daliegen wie jetzt. Mit jeder Sekunde, die sie weiter vergeudeten, stieg die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine der Türen öffnete und sie dabei überrascht wurden, wie sie als Fremde in nicht ganz unauffälliger Weise an einem mit Sicherheit strategisch wichtigem Knotenpunkt herumlungerten. Kurzerhand streckte sie selbst die Hand nach der Klinke aus, stieß die Tür auf und trat ein. Was sollte denn schon hinter dieser Tür liegen? Ihrer Ansicht nach standen die Chancen ziemlich gut, dass es nur ein weiterer langer Gang war, an dessen Ende sie vielleicht sogar ihr Ziel erreichten, und selbst wenn dort ein Raum war, so war es mit ein wenig Glück eine Abstellkammer oder etwas in der Art, und sollten sie doch auf eine Dämonin treffen, konnten sie immer noch behaupten, sich verirrt zu haben. Das war allemal besser als die Alternative.
Doch was sie letztlich erblickte, als sie so unüberlegt in den Raum platzte, ließ sie schnell zu dem Schluss gelangen, dass sie einen großen Fehler begangen hatte. Es war keine Abstellkammer, über deren Schwelle sie in diesem Moment trat, und es war auch kein Raum, den sie ohne Weiteres nur mit einer dahingemurmelten fadenscheinigen Ausrede wieder verlassen konnte. Das hier war eine riesige Halle, der harte Steinboden war zu großen Teilen mit weichen Matten ausgelegt, vor den mit biolumineszenten Pilzen überzogenen Wände standen einige von Waffen verschiedenster Art bestückter Ständer aufgereiht und überall waren Dämoninnen in Zweiergruppen verteilt. Sie trugen nicht die üblichen Uniformen, trotzdem war unverkennbar, dass sie alle Wächterinnen waren. Sie waren sichtbar sportlich, keine von ihnen hatte Haare, die länger als bis zum Kinn reichten und sie alle waren gekleidet in etwas, das wohl ein einheitlicher Trainingsanzug war. Er bestand aus einem luftigen schwarzen Stoff, der zwar nicht so eng geschnitten war, dass er auf der Haut auflag, aber auch nicht so weit, dass er störend flatterte.
Es war nicht zu übersehen, dass sie hier in eine Übung hineingestolpert war; die ganzen Wächterinnen waren gerade dabei, sich in einer kompliziert choreographierten Abfolge von Blockaden und Konterattacken gegenseitig abzuwehren, doch ls sich nun unerwartet die Tür geöffnet hatte, und dieses fremde Mädchen eintrat, hielten sie sofort alarmiert inne und wandten sich ihr zu, noch immer in Kampfhaltung und jede ihrer Bewegungen mit starrem Blick verfolgend. Sich jetzt einfach wieder umzudrehen war keine Option mehr. Sie erschien den versammelten Wächterinnen offenbar bereits suspekt genug; wenn sie jetzt ohne triftigen Grund kehrtmachte, würde das nur noch mehr Verdacht auf sich ziehen. Sie würden ihr folgen und damit unweigerlich die übrigen Mitglieder des Freak-Club entdecken. Das durfte sie nicht riskieren, schließlich ging es hier um die Rettung von Lisa.
Somit blieb ihr wohl nur noch die Flucht nach vorn. Sie drehte sich für einen winzigen Moment um, vorgeblich um die Tür hinter sich zu schließen, doch nutzte sie die Gelegenheit, einen kurzen Augenkontakt zu ihren Freundinnen herzustellen und mit einem Rucken des Kopfs den Korridor entlang zu weisen. »Verschwindet! Ich komm klar«, zischte sie ihnen zu, dann warf sie eilig die Tür ins Schloss und wandte sich wieder zu den Wächterinnen. »Äh, hallo«, begann sie ein wenig unsicher, bevor sie sich zusammenriss und mehr Souveränität in ihre Stimme legte. »Ich bin das neue Dienstmädchen und sollte mich hier melden.«
Bei diesen Worten kam eine der Wächterinnen auf sie zu, die sich rein äußerlich zwar nicht sonderlich von den anderen unterschied, aber allein schon durch ihre aufrecht würdevolle Haltung deutlich machte, dass sie hier das Kommando hatte. Emilia konnte es selbstverständlich nicht wissen, doch es war die Staffelleiterin, die zuvor Emma überrascht hatte, als sie gerade den beiden Wächterinnen am Tor einen abgelutscht hatte. Nachdem sie dabei bevorzugt behandelt worden war, hatte sie schnell wieder gehen müssen, weil dieses Kampftraining angesetzt gewesen war, und sie es angesichts der Bedrohung durch eine Usurpatorin nicht hatte ausfallen lassen wollen.
Dass nun dieses neue Dienstmädchen zu ihnen geschickt worden war, beruhigte ihr schlechtes Gewissen, dass sie wegen dieser Sache hatte. Offenbar hatte das Mädchen, das Arel und Sivil aufgegriffen hatten, die Wahrheit gesagt, es waren einige neue Palasthilfen angeworben worden, und es war schlicht vergessen worden, sie darüber in Kenntnis zu setzen. Natürlich hatte sie sich ohnehin nichts zuschulden kommen lassen. Sie hatte ihre Pflicht nicht vernachlässigt und sich erst vergewissert, dass von dem Mädchen keine Gefahr ausging, bevor sie erlaubt hatte, dass sie weiter dem nachging, was ihr anscheinend als Vertrauensbeweis aufgetragen worden war. Sie war jedenfalls keine Tochter der Königin, das hätte die Staffelleiterin gespürt, und sie war auch nicht mächtig genug, um wirklich Schaden anrichten zu können, aber es war gut zu wissen, dass sie nicht versucht hatte, sich unbefugt Zutritt zu verschaffen.
Insgeheim war die Staffelleiterin zutiefst erleichtert über diesen unangekündigten Besuch. Auch wenn sie vorhin endlich einmal wieder etwas Druck hatte ablassen können, war die letzte Zeit äußerst stressig gewesen. Sinistra hatte sie ununterbrochen dazu angehalten, genau darauf zu achten, dass die Vorschriften unbedingt eingehalten wurden, und dass alle die ihnen übertragene Verantwortung so ernst wie möglich nahmen. So war sie immer in Bewegung gewesen, war von einer Wachposition zur nächsten gewechselt, um sicherzugehen, dass alles seine Ordnung hatte, und hatte nebenbei noch mit den Wächterinnen, die keinen Dienst hatten, Übungen veranstaltet oder war mit ihnen Pläne durchgegangen.
Das hatte nicht nur dazu geführt, dass die Staffelleiterin eine ganze Reihe von Überstunden einlegen musste, sondern hatte sie auch mit einer stetig wachsenden Anspannung erfüllt, die sie lange nicht hatte abbauen können. Vorher hatte sie sich beinahe täglich mit einer der Wächterinnen oder einem Dienstmädchen vergnügt; sie sah ganz gut aus und kam gut mit Leuten zurecht, weshalb es nie einen Mangel an willigen Partnerinnen gab, doch jetzt war ihr das verwehrt geblieben. Wenn ihr Dienst erst einmal um gewesen war, hatte sie gar nicht mehr die Energie gehabt, sich noch nach jemandem umzusehen, mit dem sie die Nacht hätte verbringen können. Die kleine Ablenkung, die sich eben am Tor gegönnt hatte, war nett gewesen, hatte aber bei weitem nicht ausgereicht, um sie endgültig zu befriedigen. Sie fühlte sich noch immer, als stünden ihre inneren Geschlechtsorgane wegen komprimierten Spermas kurz vorm Platzen, und sie hatte keinen Zweifel, dass die ihr unterstellten Wächterinnen ein bisschen Entspannung ebenso dringend nötig hatten wie sie.
Allerdings war sie sich nicht ganz sicher, ob dieses Mädchen allein den zahllosen Anforderungen überhaupt gerecht werden konnte, die hier an sie gestellt würden. Immerhin war das hier die Hälfte der Staffel, die sie leitete, ein Sechstel der Palastwache an sich, insgesamt fünfundsiebzig Dämoninnen in konstitutioneller Hochform, die es kaum noch erwarten konnten, sich über sie herzumachen, dabei war sie so blass und zierlich, dass sie fast schon anämisch wirkte, als würde ein starker Luftzug genügen, um sie wie trockenes Laub davonzuwirbeln. Es war sehr ungewöhnlich, dass nur ein einziges Hausmädchen damit betraut wurde, sie alle zu bedienen, aber bei der Hektik, die derzeit im Palast herrschte, waren wohl nicht mehr verfügbar. Nun, da war es wohl das Mindeste, sich zu vergewissern, dass sie zumindest wusste, worauf sie sich einließ.
»Du bist ganz allein hier?«, fragte sie.
»Äh, ja«, antwortete Emilia schnell. »Es wurde eine Freiwillige gesucht, die euch, ähm … eine Weile Gesellschaft leistet, und ich fand, das klang nach Spaß.«
»Ah«, machte die Staffelleiterin verstehend. Das kam hin und wieder vor, dass sich Dienstmädchen bei ihnen meldeten, deren Traum es war, von so vielen Dämoninnen genommen zu werden wie möglich, nur waren die für gewöhnlich nicht so jung. Aber die Staffelleiterin verbat sich dahingehend ein Urteil. Letztendlich hatte jede von ihnen ihre spezielle Phantasie, Semia zum Beispiel trieb es am liebsten mit ihren Belua, Dubia war heillos in ihre eigene Schwester, die Königin, verliebt, und sie selbst hatte sich schon seit ihrer Jugend zu älteren Frauen hingezogen gefühlt, sodass sie schon als Kind mit mehreren Müttern ihrer Freundinnen im Bett gelandet war, also wer war sie denn schon, irgendjemandem vorschreiben zu wollen, worauf sie zu stehen hatte und worauf nicht? »Na, wenn das so ist, dann sei bitte unser wertgeschätzter Gast«, sagte sie und machte mit der Hand eine einladende Geste in den Raum hinein.
Emilia folgte diesem Wink und die Staffelleiterin führte sie, eine Hand sacht auf ihren Ellenbogen gelegt, tiefer in die Halle herein.
»Wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du also eine schöne Zeit mit uns verbringen, ja?«, fragte die Staffelleiterin im Gehen. Sie wartete ein fast schüchternes Nicken von Emilia ab, dann fügte sie hinzu: »Mit allen von uns?«
Wieder nickte Emilia scheu. »Ja.«
»Und was hast du dir vorgestellt? Ich meine, möchtest du einzeln von uns verwöhnt werden oder sollen wir uns alle zusammen um dich kümmern?«
Das wäre für Emilia natürlich die Gelegenheit gewesen, diese Sache mit vergleichsweise wenig Aufwand abzuhandeln. Um sich ihr ganz zu entziehen, war es wohl etwas spät, das hätte bloß Zweifel an ihrer Person aufkommen lassen, aber sie hätte die Wächterinnen immer noch einzeln ranlassen können. Dabei wäre es vermutlich weitaus weniger zügellos zugegangen, und sie hätte nach ein paar in sie erfolgten Ergüsse behaupten können, dass sie zu erschöpft wäre, um noch weiterzumachen, dennoch zögerte sie nur einen kurzen Augenblick, ehe sie sagte: »Zusammen.«
Ihr Entschluss stand bereits fest, und der hatte, wie sie zugeben musste, nicht ansatzweise so pragmatische Gründe, die sie hätte vorschieben können. Ihr war eines klar geworden: wenn sie sich schon selbst in diese abstruse Situation hineinmanövriert hatte, konnte sie diese Fügung des Schicksals auch gleich dazu nutzen, ihre Neugier in Bezug eines Themas zu stillen, das ihr schon länger im Kopf herumschwirrte, aber gerade heute erst wieder von Neuem Bedeutung für sie erlangt hatte. Immerhin galt all ihre Liebe Maria, einem Mädchen, das schon lange davon geträumt hatte, sich einmal im Zentrum der Aufmerksamkeit eines Gangbangs wiederzufinden, bevor Emilia sie überhaupt kennengelernt hatte, und das nun froh war, einem Club anzugehören, in dem ihr dieser Wunsch nur zu gerne erfüllt wurde, wann immer es sich anbot.
Für Emilia hatte das nie ein Problem dargestellt. Alles, was sie wollte, war, Maria glücklich zu sehen, und wenn das beinhaltete, dass sie sich von Zeit zu Zeit sämtliche ihrer Löcher von einem Großteil ihrer Klassenkameradinnen stopfen ließ, war ihr auch das recht. Bislang war Emilia immer zufrieden damit, nur eine von vielen zu sein, die sich mit ihrer Freundin amüsierten, doch war ihr mittlerweile immer öfter der Gedanke gekommen, es selbst einmal ausprobieren zu wollen. In ihrem Club war es dazu einfach noch nicht gekommen, und sie war sich auch nicht sicher, ob sie diese Umstände für ein solches Experiment wählen würde.
Natürlich wäre es unvoreingenommen betrachtet am angenehmsten gewesen, so etwas mit denen zu tun, die man gut kannte und mochte – immerhin würde Vertrauen dabei eine wichtige Rolle spielen, das Gefühl, in sicheren Händen zu sein –, allerdings war Emilia nun einmal mit dem immerwährenden Gefühl aufgewachsen, nicht dazu zu gehören. Ihre früheren Mitschüler hatten sie missachtet, die einzige Freundin, die sie damals gehabt hatte, war ihr später in den Rücken gefallen und sogar in der Welt an sich hatte sie nie wirklich den Eindruck gewonnen willkommen zu sein. Sie war sich immer wie ein Fremdkörper vorgekommen, ausgeschlossen, isoliert und abgeschoben, und obwohl ihr Verstand wusste, dass ihre jetzigen Freundinnen ihr so etwas nie antun würden, hatten diese Erfahrungen eben einen unterschwelligen Einfluss auf ihre Persönlichkeit gehabt, der sich jetzt nicht so ohne Weiteres rückgängig machen ließ. Für den Moment jedenfalls erschien es ihr leichter, sich diesen völlig Fremden hinzugeben, denen gegenüber sie keine Verpflichtungen besaß und die sie sowieso nie wieder sehen würde, als ihre geheimsten Sehnsüchte mit denen zu teilen, die ihr tatsächlich etwas bedeuteten, zu denen sie aber gerade erst Anschluss gefunden hatte und somit das Risiko eingehen würde, dass sie sich ebenfalls von ihr abwandten. So gesehen war es also die unbewusste Angst vor erneuter Ablehnung, ihr wahres Wesen vor ihrem sozialen Kreis versteckt zu halten und ihre Hemmungen lieber vor diesen anonymen Wächterinnen zu verlieren.
Dennoch war ihr Verlangen, von dieser Horde Dämoninnen zugleich bestiegen zu werden, aber gar nicht so sehr sexueller Natur. Vielmehr war es für sie ein Weg, Maria noch näher zu sein, als sie es bereits war. Auch wenn Emilia jeder ihrer Clubkameradinnen schon einen geblasen hatte, war in ihre Scheide bisher noch kein anderer Schwanz eingedrungen als ihr eigener, und ihr Hintern war sogar völlig unberührt geblieben. Verglichen mit Maria war sie also fast noch unschuldig, und das begann sie allmählich zu stören. Sie wollte alles nachvollziehen können, was Maria getan hatte, sie wollte fühlen, was sie fühlte, dieselbe Vorfreude wie sie empfinden und dieselbe Erfüllung, wenn es vorüber war.
Dabei ging es ihr jedoch nicht darum, Marias Obsession für sich zu rechtfertigen, sondern sie schlicht zu verstehen. Emilia kam wunderbar damit zurecht, dass sie beide ihre kleinen absonderlichen Vorlieben hatten, mit denen der andere nichts anfangen konnte, und auch dass die Meisten Marias Standpunkt diesbezüglich bestenfalls als Perversion ansehen dürften, störte sie nicht weiter. Sie waren eben von Grund auf verschieden; während Maria nicht nur hinsichtlich ihres Lustgewinns, sondern in schlichtweg allen Belangen gerne im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses stand, wäre es Emilia lieber gewesen, sich sehr viel mehr im Hintergrund halten zu können, was mit ihrem aufsehenerregenden Erscheinungsbild aber eher schwierig war. Stattdessen wollte sie einfach nur erfahren, was ihre Liebste so an dieser Abseitigkeit faszinierte, dass sie immer wieder auf sie verfiel.
Vor allem erhoffte sie sich davon, Marias ganzes Wesen besser erfassen zu können. Natürlich war Emilia nicht der Meinung, dass irgendwelche Präferenzen, egal welcher Art, einen Charakter definierten, trotzdem verrieten sie oft etwas über die jeweilige Person, das sie selbst gar nicht begriffen, weil der Grund, warum sie etwas Bestimmtes taten, tief in ihrem Unterbewusstsein vergraben lag. Es konnte zweifellos viel über jemanden offenbaren, wenn man herausfand, warum diese Person gerade das mochte, was sie eben mochte, und wie sollte man schon dahinterkommen, wenn man es nicht selbst versuchte? Letzten Endes war Emilia also begierig darauf, ihre ohnehin schon unerschütterliche Verbindung zu Maria noch weiter zu stärken, und so seltsam das auch klingen mochte, glaubte sie, das am besten zu vollbringen, indem sie alle der hier hier anwesenden Dämoninnen fickte.
Während Emilia all dies durch den Kopf ging, hatte die Staffelleiterin sie immer weiter in die Mitte der Halle geführt, genau in die Ansammlung verschwitzter durchtrainierter Wächterinnen hinein, die nur still dastanden und erwartungsvoll ihre Offizierin ansahen. Die hielt nun mit Emilia genau vor einer der großen Matten, die den Boden bedeckten, beugte sich ein wenig zu ihr herab und fragte flüsternd: »Wie heißt du eigentlich?«
Diese Frage traf Emilia doch einigermaßen unerwartet. Sie hatte nicht damit gerechnet, nach ihrem Namen gefragt zu werden, bevor sie hier als Abmelkstation herhalten sollte, und dementsprechend hatte sie sich noch keine Gedanken darüber gemacht, wie sie antworten sollte. Zwar wurde prinzipiell nur nach Lilly gesucht, da Sinistra natürlich nicht ahnen konnte, dass sie inzwischen einige sehr enge Freundinnen gefunden hatte, doch war es trotzdem nicht auszuschließen, dass die Wächterinnen wussten, dass ihre Herrscherin eine zweite Tochter namens Emilia hatte, weshalb sie es für keine besonders gute Idee hielt, die Wahrheit zu sagen. Es entstand eine kleine Pause, von der sie hoffte, dass sie nicht groß auffiel, während sie überlegte, wie sie sich stattdessen nennen könnte, aber sie wusste einfach zu wenig über die Kultur des Limbus, um sich ein glaubwürdiges Pseudonym einfallen zu lassen.
»Äh … Mia«, verwendete sie schließlich ihren Spitznamen. Das sollte wenigstens unverfänglich sein, auch wenn sie nicht genau sagen konnte, ob er in dieser Welt überhaupt bekannt war. Falls es ein Edikt gegeben hatte, auf Mädchen in ihrem Alter zu achten, an denen irgendetwas merkwürdig war, hätte sie wohl ernsthafte Schwierigkeiten bekommen.
Doch die Staffelleiterin schien er zumindest nicht zu irritieren. Sie nickte nur, dann richtete sie sich wieder auf, sah reihum in die Gesichter der ihr Untergebenen, die sich vor ihr versammelt hatten, und verkündete mit der lauten festen Stimme von jemandem, der es gewohnt war, Befehle zu erteilen, nun aber unerwarteterweise eine freudige Überraschung bekannt geben durfte: »Aufgepasst, Leute! Das ist Mia. Sie ist neu hier und würde gerne von uns eingewiesen werden. Nun, ich bin mir sicher, dass es euch eine große Freude sein wird, sich ihr anzunehmen und ihr zu zeigen, wie kameradschaftlich die Wächterinnen sind, nicht wahr?«
Begeistertes Kopfnicken und ein paar johlende Rufe verdeutlichten die Zustimmung der Menge. Die Staffelleiterin ließ ihnen diesen Moment, in dem sich die Erleichterung über die bevorstehende Entladung ihrer aufgestauten Frustration aus ihnen Bahn brach; erst als sich die Aufregung allmählich legte, klopfte sie dem Mädchen neben sich auf die Schulter, um sie zu ermutigen und gleichzeitig zu beruhigen.
»Nur zu«, sagte sie leise zu ihr. »Du brauchst keine Angst zu haben, niemand hier wird etwas von dir verlangen, dass du nicht tun willst, aber du kannst dich ganz nach Lust und Laune austoben. Fang einfach an, wenn du bereit bist, und tu, was du willst.«
Emilia nickte und betrachtete die Wächterinnen vor sich genauer. Sie waren alle gut in Form, schlank und drahtig. Als sie Emilias Blick traf, versuchten einige von ihnen, sich in ein besseres Licht zu rücken, streckten die Brust raus, damit ihre Oberweite größer wirkte, oder ballten die Hände zu Fäusten, sodass die Muskeln an ihren Armen hervortraten, andere lächelten ihr gewinnend zu, aber Emilia fiel besonders eine Dämonin auf, die ihre Augen im Gegensatz zu ihnen schüchtern niedergeschlagen hatte und nervös von einem Bein aufs andere hüpfte, beide Hände lose vor den Schritt gelegt. Sie schien die Jüngste hier zu sein, nur ein paar Jahre älter als Emilia, und obwohl sie mit ihren kantigen Gesichtszügen nicht unbedingt eine anstehende Schönheitskönigin war, war sie doch auf eine gewisse raue Art gutaussehend. Ihr Haar war noch kürzer als das der meisten anderen, gerade einmal zwei Fingerbreit lang, und stand ihr in wirren Stacheln vom Kopf ab.
Doch es war nicht nur die unbestreitbare Attraktivität, die Emilia zu ihr hinzog, vielmehr noch war es ihre scheue Art. Es war nicht zu übersehen, dass sie schon jetzt mit einer so prallen Latte zu kämpfen hatte, dass es schon schmerzhaft war, alleine durch die Ankündigung dass sie bald zum Schuss kommen würde, gleichzeitig war es ihr peinlich, wie geil sie bereits war und versuchte, das unzweifelhaft hervorstehende Anzeichen dieser Tatsache zu verbergen. Da lag wohl ein schwerer Fall von Samenstau vor. So gequält wie sich wand bei der Vorstellung, es endlich einmal wieder tun zu können, war klar, dass das letzte Momentum in dieser Beziehung schon einige Zeit zurück lag, und sie nun dermaßen unter Druck stand, dass ihre Säfte ganz von allein überzubrodeln drohten. Aber ihr Unvermögen, Emilia in die Augen zu blicken oder sich auch nur anmerken zu lassen, wie sehr sie von Vorfreude erfüllt war, wiesen unmissverständlich darauf hin, wie unsicher und verletzlich sie sich fühlte. Sie musste also eher zurückhaltend sein, und wahrscheinlich hatte sie Erfahrungen mit Ausgrenzung gemacht. Diese Indizien waren kaum falsch zu interpretieren; wer solche Angst vor der Beurteilung anderer hatte wie diese junge Wächterin, hatte einen Grund dafür, nämlich dass sie in der Vergangenheit immer wieder das Opfer von Anfeindungen geworden war.
Das nahm Emilia sofort für sie. Dass sie im Freak-Club gelandet war, war mehr ein irrsinniger Zufall gewesen, aber wenn sie ehrlich war, musste sie zugeben, dass sie dort genau richtig aufgehoben war. Immerhin war sie selbst ihr ganzes Leben lang eine Außenseiterin gewesen, und auch wenn sie sich oft darüber lustig machte und ernste Zweifel am Erfolg ihres sozialen Engagements hatte, waren die Statuten des Clubs für sie doch von unschätzbarer Bedeutung. Sie wusste, wie kalt und grausam die Welt gemeinhin war, da kam sie eben nicht umhin, sich von diesen Werten angesprochen zu fühlen, Ungerechtigkeit zu bekämpfen und sich für die Belange der Ausgestoßenen einzusetzen. Außerdem waren ihr alle grundsätzlich sympathisch, die unter denselben Vorbehalten zu leiden hatten wie sie selbst.
Damit stand fest, um wen sie sich als erste kümmern würde.
Langsam aber nicht zögerlich, sondern mit den gemessenen Schritten einer feierlichen Prozession ging sie auf die junge Wächterin zu. Die blickte überrascht auf, als Emilia ihr immer näher kam und über ihr Gesicht huschte ein angedeutetes Lächeln, irgendwo zwischen Dankbarkeit und der niederschmetternden Befürchtung, sie könnte einfach an ihr vorbei zu der Dämonin hinter ihr gehen.
Doch Emilia ging nicht an ihr vorbei. Stattdessen blieb sie genau vor der schwarzhaarigen Wächterin stehen, so dicht, dass sie die Hand nur ganz leicht hätte anzuheben brauchen, um sie zu berühren, aber keine von beiden wagte es, der anderen wirklich in die Augen zu schauen. Ihre Blicke streiften sich nur kurz, bevor sie einander lieber auf die untere Gesichtspartie starrten. Einen Moment lang standen sie einfach so da, während Emilia überlegte, wie genau sie fortfahren sollte, aber schließlich ging sie bloß in die Knie, noch immer ohne irgendetwas zu sagen. Erst um Erlaubnis zu bitten, ehe sie der Wächterin die Hose öffnete und an ihrem Teil herumspielte, erschien ihr in diesem speziellen Fall überflüssig.
Sie schlug also die Beine unter und ließ sich mit dem Po auf sie sinken. Nachdem sie das getan hatte, befand sich ihr Gesicht annähernd auf einer Höhe mit dem Schritt der Wächterin; eine bequeme Position, um es ihr mit dem Mund zu machen. Zwar war es Emilias erklärtes Ziel, die passenden Gegebenheiten zu schaffen, damit möglichst viele der Dämoninnen sich auf sie stürzten und sie mit ihren Schwänzen bedrängten, doch war ja noch genug Zeit, um dieses Vorhaben zu verwirklichen. Fürs erste fühlte sie sich aber am wohlsten damit, sich auf das zu beschränken, was sie schon kannte. Letztendlich war es wohl ein fast schon regressiver Entschluss, eine Flucht in etablierte Verhaltensmuster, die sie für Situationen dieser Art entwickelt hatte, bevor sie sich mit dem Unbekannten auseinandersetzen musste, das noch folgen sollte, aber im Grunde war das doch auch kein schlechter Beginn. Es gab jedenfalls Kandidatinnen im Überfluss, die bestimmt allzu gern bereit waren, ihr diesen Wunsch zu erfüllen, und ihnen erst einmal eine Probe ihrer oralen Fertigkeiten zu gönnen, erschien ihr ein probates Mittel, sie in Stimmung dazu zu bringen.
Mit einer sanften Berührung schob Emilia die Hände der Wächterin beiseite, die sie noch immer schützend vor ihren Intimbereich gehalten hatte. Als sie sich nun Stückchen für Stückchen wegbewegten, kam unter ihnen, wie nicht anders zu erwarten, eine riesige Beule unter dem leichten Stoff der Hose zum Vorschein. Emilia hielt sich nicht lange damit auf, sie zu begutachten, lieber wollte sie das echte Ding in all seiner Pracht bestaunen.
Entschlossen streckte sie die Hände aus, hakte ihre Finger unter den Saum der Sporthose und zog sie mit einem Ruck herunter. Sinistra hatte ihr immer viel über den Limbus erzählt, wie schön es dort war, welch wundersame Kreaturen es dort gab und wie sich das gesellschaftliche Leben gestaltete, aber irgendwie war die Sprache dabei nie auf Unterwäsche gekommen. Deshalb wusste Emilia nun nicht, ob dieses Konzept hier überhaupt Verbreitung gefunden hatte, doch falls dem so war, hatte die Dämonin vor ihr zumindest darauf verzichtet. In demselben Augenblick, in dem der Hosenbund die Wölbung überwunden hatte, sprang auch schon der Penis darunter hervor. Er war groß, zwar nicht annähernd so gewaltig wie ihr eigener, der ihr angeschwollen bis zu den Knien hing, aber auf jeden Fall recht beeindruckend. Er war mit Sicherheit etwas mehr als zwei Handbreit lang und zudem so dick, dass Emilia ihn nur mit Mühe hätte umfassen können. Für eine Dämonin, die im Allgemeinen durch die fahlen Lichtverhältnisse auf ihrem Planeten übermäßig blass waren, hatte sie eine außergewöhnlich dunkler Haut, in etwa wie helles lasiertes Buchenholz, dort jedoch, wo der Unterleib in das vorstehende Gemächt überging, verfärbte sich der Teint in ein verwaschen wirkendes Grau, sodass der Penis wie ein fleischiges eingefettetes Stahlrohr aussah. Der Schaft beschrieb eine leichte Krümmung nach unten und wies an seinem Ende offenbar eine knubbelige Eichel auf, die aber von der überlappenden Vorhaut verdeckt wurde.
Das machte Emilia nur noch neugieriger. Sie wurde nicht so obsessiv davon angezogen wie Emma, doch sie musste zugeben, dass eine sichtbare Eichel und eine sie umhüllende Vorhaut ein faszinierendes Mysterium darstellten. Immerhin waren das Dinge, mit denen sie nicht allzu vertraut war. Da sie selbst keines von beiden besaß, erschien ihr das ganze zugrunde liegende Prinzip ein wenig seltsam, und auch wenn sie bereits an den Ständern der Zwillinge oder dem von Fantasma Erfahrungen damit gesammelt hatte, war das nichts, womit sie sich viel beschäftigt hätte. Früher oder später hatte es sich eben immer so ergeben, dass Emilias umherpeitschender Schwanz die Aufmerksamkeit auf sich zog, und es endete unweigerlich damit, dass sie selbst das Angebot bekam, einen wegstecken zu dürfen. Nun jedoch, da sie sich bereit erklärt hatte, die Beine gleich für einen ganzen Trupp Wächterinnen breit zu machen, kam es ihr nur vernünftig vor, sich wenigstens einen der unzähligen Schwänze, die kurz davor waren, in sie geschoben zu werden, genauer zu untersuchen.
Mit einem Blick hinauf in das Gesicht der jungen Wächterin, als befürchtete sie, diese Inspektion könnte ihr zu nahe treten, streckte Emilia den Daumen und Zeigefinger spitz aus, zupfte behutsam an der überhängenden Vorhaut und lugte so darunter. Das reichte zwar nicht für ein abschließendes Urteil, doch so weit sie erkennen konnte, unterschied sich die Eichel nicht merklich von der Vorstellung der Norm, die sie durch Bilder und Ähnlichem gewonnen hatte. Zumindest die Farbe war dieselbe: durch den spärlichen Einblick, den ihr der Mantel aus Haut gewährte, konnte sie einen rosa Schimmer erkennen, wie von einem Rubin, der in einer dunklen Höhle funkelte.
Damit war Emilia aber noch nicht zufriedengestellt. Nun, da sich ihr diese Frage aufgedrängt hatte, musste sie erst noch einmal überprüfen, ob die Eichel in ihrer Form wirklich so gewöhnlich war, wie es den Anschein hatte, ehe sie ihre eigentliche Aufgabe in Angriff nehmen konnte. Dazu legte sie Daumen und Zeigefinger oben und unten an die Spitze des Penis – wozu sie ihre Finger so weit spreizen musste, wie es nur ging, so dick war der Schaft – und zog die Vorhaut sanft zurück. Obwohl das ohne Anstrengung vonstatten ging, konnte Emilia beobachten, wie die aneinanderklebenden Hautschichten sich nur schwerfällig und in einem schrittweise verlaufenden Prozess wieder lösten. Es kam ihr sogar vor, als würde sichtbare Hitze von dem freigelegten Stück Rohr aufsteigen, wie das Flimmern über Asphalt an einem schwülen Sommertag, doch schrieb sie das letztlich nur ihrer Einbildung zu.
Dennoch ließ sich nicht bestreiten, wie viel Erleichterung sie der Wächterin mit dieser noch nicht wirklich Ekstase verheißenden Behandlung verschaffte, diesem bloßen Abstreifen der Vorhaut. Das leise genussvolle Stöhnen, das sich ihr dabei entrang, war in dieser Hinsicht bereits unmissverständlich; dass sie gleichzeitig den Kopf in den Nacken warf und ein Beben ihren Körper durchlief, waren da nur noch mehr Hinweise, die es nicht unbedingt gebraucht hätte. Als Emilia dieses Gestänge nun in vollem Glanz bewundern konnte, verstand sie auch, warum dem so war. Die Eichel pulsierte bereits heftig in freudiger Erwartung jeder Berührung, die ihr zuteil würde, und aus der Spitze quollen immer wieder so dicke Wollusttropfen hervor, dass sich das Loch dabei sichtlich weitete. Wie große durchsichtige Perlen, die sich durch einen Riss in einem samtigen dehnbaren Stoff hervorwanden, traten sie daraus hervor, hingen dort für eine kurze Weile herab, bis ihr Gewicht der Kraft der Gravitation nicht länger trotzen konnte, und fielen schließlich, einen langen glitzernden Faden hinter sich herziehend, einem Kometen gleich zu Boden.
Das Fleisch, das unter der Vorhaut geschützt gelegen hatte, war tatsächlich übermäßig warm, stellte Emilia nun fest, als sie ihre Finger in diesen Bereich zurückwandern ließ, aber sie nahm an, dass das nicht sonderlich anomal war. Immerhin hatte die Wächterin bis gerade eben noch an einem Training teilgenommen, in dem sie sich zweifellos schwer verausgabt hatte. Das merkte man ihrer Latte auch in anderen Belangen an. Zum einen war sie beinahe triefend nass, als wäre sie von oben bis unten mit einer klebrigen Flüssigkeit überzogen – offenbar hatte der Schweiß unter der Vorhaut keine Möglichkeit gehabt, sich zu verflüchtigen und hatte sich so immer weiter angesammelt –, zum anderen stieg von ihr ein durchdringender Duft auf, der jedoch keineswegs unangenehm war. Zwar roch er ein wenig abgestanden, aber auch sehr süßlich; er erinnerte vielmehr an die stickige Luft in einem Raum, in dem allmählich ein Strauß Blumen verwelkte.
Auf einmal fiel ihr auf, dass die Wächterin verschreckt zu ihr hinabsah, als hätte sie Angst, der ungewaschene Penis würde sie anekeln, doch Emilia lächelte ihr nur beruhigend zu. Die Wächterin konnte ja nichts dafür, dass sie ausgerechnet in diesem unpassenden Moment hereingeplatzt war und nun zur Ablenkung beschlossen hatte, es ihr und ihren Kameradinnen zu besorgen. Demgemäß sah sie jetzt keinen Grund, sich zu zieren. Kurzerhand beugte sie sich vor, öffnete den Mund und nahm den mit Schweiß und Vorsamen beschmutzten Schwanz in sich auf. Sobald die Wächterin das spürte, wie sich die Lippen zärtlich über ihre Eichel schoben und die warme feuchte Mundhöhle sie umschloss, entfuhr ihr ein weiteres aufgeregtes Stöhnen und ihr wurden wohl sogar die Knie ein wenig weich, denn ihre Beine begannen zu zittern, und sie sank etwas in sich zusammen. Im selben Augenblick wurden Emilias Sinne auch vom Geschmack des mit seinen Säften beschmierten Ständers überwältigt. Nachdem sie schon sämtlichen ihrer Freundinnen einen geblasen hatte, hielt der allerdings keine Überraschungen mehr bereit. Es war die gleiche bitter-süße Mischung, die ihr mittlerweile so vertraut war, allenfalls war sie nun noch intensiver, da der Penis in ihrem Mund von so vielen aromatragenden Flüssigkeiten verklebt war.
Davon ließ Emilia sich aber nicht beirren, sondern begann damit, rhythmisch ihren Kopf vor und zurück zu bewegen, doch selbst das gestaltete sich sehr viel schwieriger als sie es bisher kannte. Die Eichel war so riesig, dass Emilia ihren Mund bis zum äußersten aufreißen musste, nur damit sie überhaupt hineinpasste, und nicht einmal dann schaffte sie es, wenigstens einen Zoll des Schaftes in sich zu quetschen. Die Eichel füllte sie einfach vollständig aus, von allen Seiten schmiegte sie sich dicht an ihr Inneres, an ihren Gaumen, an ihre Zunge und an ihre Wangen, ohne dass die geringste Aussicht bestanden hätte, sie nicht ein Stückchen tiefer in sich zu bekommen. Es war, als hätte sie eine gewaltige Kugel aus Knetgummi im Mund, die sie nun nicht mehr herausbekam. Sie konnte kaum noch schlucken, so fest drückte ihr der Schwanz die Kiefer auseinander.
Das war ein ganz neues Gefühl für sie. Von den Mitgliedern des Freak-Clubs konnte niemand mit den Ausmaßen des Ständers zwischen ihren Lippen mithalten, und obwohl sie sich auch schon mehrfach selbst einen geblasen hatte, lief ihr eigenes Ding über seine gesamte Länge hinweg konisch zu, sodass die Spitze, die dabei letztendlich in ihr steckte, trotz des ausufernden Umfangs an seinem Ansatz, eher dünn war. Da war es sowohl bei ihr selbst als auch bei ihren Freundinnen immer leicht gewesen, sich die Schwänze wie aufgeweichte massige Lakritzstangen in den Mund zu schieben und sie dort beständig ein und aus gleiten zu lassen, doch nun musste Emilia einsehen, dass das hier schlicht unmöglich war.
Nach ein paar wenig Erfolg versprechenden Versuchen gab sie es schließlich auf und ging stattdessen dazu über, hingebungsvoll an der Eichel zu lutschen, die Unterseite – so gut dass mit ihrem vollgestopften Mund umzusetzen war – mit der Zunge zu lecken und mit aller Macht an ihr zu saugen, als würde sie Sirup durch einen übergroßen Schlauch aufschlürfen. Diese Umgewichtung in ihrer Vorgehensweise schien der Wächterin aber nichts auszumachen. Ganz im Gegenteil, ihr zuvor sinnliches Stöhnen wurde auf einmal zu einem atemlosen, heillos überfordert klingenden Schnaufen, und das langsame Tröpfeln des Vorsamens wandelte sich beinahe in einen nicht enden wollenden Strom. Das hätte Emilia eigentlich auf das vorbereiten sollen, was als nächstes geschah, aber das tat es nicht. Sie fing gerade an, sich an die Fremdartigkeit dieser Situation zu gewöhnen und ganz in der von ihr übernommenen Aufgabe aufzugehen, in der Empfindung, wie die Eichel ihren Mund aufzwang, wie sie in ihr pochte und sich von Zeit zu Zeit noch ein wenig mehr aufzublähen schien, jedes Mal wenn eine neue Woge an Präejakulat aus ihr hervorschoss, als diese sich aufbauende Routine plötzlich unterbrochen wurde, indem sich ein mächtiger Strahl Sperma in sie ergoss.
Für Emilia kam das völlig unerwartet. In diesem Moment schmiegte sich die Spitze des Schwanzes so eng an ihre Kehle, dass es ihr unmittelbar in den Hals spritzte. Emilia war so überrascht, dass sie sich daran verschluckte, keine Luft mehr bekam und sofort ein Stück zurück wich. Das bedeutete aber natürlich noch lange nicht, dass die Wächterin sich bereits fertig entleert hatte. Gerade hatte Emilia es geschafft, die vor Lust bebende Eichel zwischen ihren bis zu ihren Grenzen gestrafften Lippen herauszuziehen, schnellte bereits ein weiterer Schwall aus dem kleinen Loch hervor und landete in ihrem noch immer geöffneten Mund. Das verbesserte Emilias Lage nicht unbedingt, aber sie konnte sich auch nicht wirklich darum kümmern. Sie wurde von einem unwillkürlichen Keuchen durchgeschüttelt und sah sich abgesehen davon außer Stande, sich auch nur im Geringsten zubewegen. Weder konnte sie ihren nach Atem japsenden Mund schließen noch sich abwenden und so blieb ihr nichts anderes übrig als zuzulassen, wie diese zweite Ladung auf ihre Zunge flutete, während sie noch immer damit beschäftigt war, die erste auszuhusten. In mächtigen Schüben sammelte sich das Zeug in ihr an, doch da sie gerade absolut nicht in der Lage war, es zu schlucken, trat es sofort wieder über ihre Lippen heraus, wo es wie ein unendlich zäher Wasserfall aus weißem Schleim herabstürzte und prasselnd auf den Boden klatschte.
Emilias Hustenanfall ging dabei unvermindert weiter. Krächzend stieß sie die Luft aus und sog sie scharf wieder ein. Es kam ihr vor, als würde sie damit buchstäblich Tropfen der Samenflüssigkeit aus ihrer Kehle spucken, denn mit jedem Husten stieg deren salziger Geschmack in ihr auf, und entfaltete sich wie die sich allmählich öffnenden Blüte einer Seerose, wenn sie vom Licht der Sonne erwärmt wurde. Sie hatte ihre Atmung noch immer nicht wieder unter Kontrolle, als die dritte Welle an Ejakulat über sie hereinbrach. Inzwischen hing der wild zuckende Schwanz nicht mehr unmittelbar vor ihrem Mund; Emilia hatte sich ein wenig aufgerichtet, um besser Luft holen zu können, doch hob sich die Spitze beim Entladen so hoch an, dass sie das Sperma erneut in voller Breitseite abbekam. Dieses Mal traf es sie sogar oberhalb des Mundes, dicht neben der Nase, wo der Strang in aller Heftigkeit zerplatzte und sich über ihr gesamtes Gesicht verteilte. Heiße Spritzer regneten wie ein Nieselschauer auf ihre Wange, auf ihre Stirn und ihre Lippen, liefen in kitzelnden Bahnen über ihre Haut und tropften ihr letztlich sämig vom Kinn.
Die Wächterin wurde noch von zwei weiteren Krämpfen erfasst, in denen der Samen aus ihr hervorfloss, doch blieben diese Eruptionen weit schwächer als die vorangegangenen. Sie beschrieben nur einen sehr kurzen Bogen, ehe sie unvermeidlich niedergingen und auf Emilias weißes Kleid fielen, auf dem sie sich in dicken klumpigen Flecken festsetzten. Als schließlich die letzten Tropfen dieser zähen Soße ihr Knie benetzten, hatte auch Emilia sich wieder gefangen. Ihr Mund war noch voller Speichel und den Resten des Spermas, das die Wächterin in ihr abgeladen hatte, aber nun, da sie wieder ruhig atmen konnte, schluckte sie ein paar Mal schwer, bis sie alles hinabbekommen hatte – alles außer diesem komischen Nachgeschmack versteht sich, der ihr jetzt wie immer nach solchen Begebenheiten scheinbar endlos lange in ihr nachhallte.
Noch während sie von diesem Gefühl eingehüllt dahockte, dass der Samen in ihr prickelte, hob sie den Kopf. Sie hatte immerhin eine ganze Kompanie Wächterinnen vor sich, die nur darauf warteten, sich mit ihr vergnügen zu dürfen, da sollte sie wohl nicht allzu viel Zeit verlieren, bevor sie sich der nächsten widmete. Doch ehe sie weitere Schritte dahingehend einleiten konnte, fiel ihr auf, wie die Wächterin, die sie gerade abgefertigt hatte, unverwandt zu ihr hinab schaute. Ihr Blick war ebenso schuldbewusst wie verlegen, und die geduckte Körperhaltung mit den schützend vor dem erschlaffendem Penis verschränkten Händen machte den Eindruck, als könnte sie nicht entscheiden, ob sie sich erst entschuldigen sollte, oder lieber gleich beschämt davonstürmen, um jede möglicherweise aufkommenden Anschuldigungen von Vorneherein aus dem Weg zu gehen. Natürlich waren diese Befürchtungen aus ihrer Sicht nicht unbegründet, war sie doch nicht nur fast sofort gekommen, sobald ihr Schwanz erst einmal im Mund des Mädchens steckte, sondern sie hatte ihr auch noch ohne Vorwarnung so ungünstig in den Hals gespritzt, dass ihr das Sperma in die Luftröhre geraten war, aber um ehrlich zu sein störte sich Emilia gar nicht daran. Sie war froh, dass sie der Wächterin hatte behilflich sein können, und dass es ihr anscheinend so gut gefallen hatte, dass ihr Orgasmus sie völlig unvorbereitet getroffen hatte, zumal ihre Reaktion jetzt keinen Zweifel daran ließ, wie unangenehm es ihr war.
Unbewusst fuhr sie sich mit dem Handrücken über den Mund, wie um die ihrer Meinung nach unnötigen Bedenken der Wächterin wegzuwischen, dann strahlte Emilia mit einem warmen Lächeln und blitzenden Augen zu ihr hinauf. »Danke«, hauchte sie, ihre Stimme noch immer rau vom Husten, »das war ein guter Anfang und ich hoffe, dass es genau so weitergeht.« Auffordernd sah sie nach links und rechts, wo sich die übrigen Wächterinnen versammelt hatten, um eine bessere Sicht auf diese Sensation zu haben, wie Emilia versucht hatte, sich den riesigen Schwanz in den Mund zu schieben. Bisher hatte noch keine von ihnen ihren eigenen Ständer herausgeholt, was wohl auch nicht weiter verwunderlich war, so kurz wie die Wartezeit gewesen war, bis die erste von ihnen sich verausgabt hatte, aber in sämtlichen Hosen zeichneten sich deutlich sichtbare Beulen ab, und einige der Umstehenden streichelten sogar ihre Geschlechter durch den sich über ihnen spannenden Stoff. »Also«, fragte Emilia unschuldig in diese verruchte Gesellschaft herein, »meint ihr, es finden sich noch ein paar Freiwillige, die mir geben könnten, was ich brauche?«
Einen Augenblick lang tat sich nichts, als diese neue Information erst einmal bis in die von Lust umnebelten Gehirne der Palastwachen vordringen musste und dort verarbeitet werden konnte, dann jedoch brach eine unvorhergesehene Hektik aus. Eilig rissen sie sich die Kleidung vom Körper, jede wollte die Erste sein, die bereit war, um als Nächste in den Genuss dieser Behandlung zu kommen, und kaum dass Emilia auch nur blinzeln konnte, war sie umgeben von Penissen der unterschiedlichsten Arten, die ihr von allen Seiten voll Ungeduld entgegengehalten wurden. Es gab große und kleine, dicke und dünne, in den schillerndsten Farben und den ungewöhnlichsten Formen. Einer war blassgrün, doch schimmerten unter seiner Haut lilafarbene Adern, die so fest hervortraten, dass es den Eindruck machte, als könnten sie jeden Moment aufplatzen; ein anderer war so wulstig, dass gar nicht richtig zu erkennen war, ob er überhaupt schon steif war, und manche hatten gleich so wenig Ähnlichkeit mit den herkömmlichen Erscheinungsbildern von Fortpflanzungsorganen, dass man sie auch für die bizarren Auswüchse von Parasiten hätte halten können. Doch trotz aller Divergenz gab es viele Gemeinsamkeiten: die meisten sonderten bereits ihren schmierigen Vorsamen ab, sie zitterten, pulsierten oder hüpften im Takt des Herzschlags ihrer Besitzerinnen, und die Luft war erfüllt von ihrem schweren blütenartigen Geruch.
Wohin Emilia ihren Blick auch wandte, überall um sie herum waren nur nackte Unterkörper zu sehen, die sich immer dichter an sie drängten. Nun hatte jede der Wächterinnen ihren Schwanz in der Hand und bearbeitete ihn mit Wichsbewegungen, die eher etwas Aufreizendes an sich hatten als wirklich Zügelloses. Hier und dort erklangen nasse Laute, und heiße Tropfen von Körperflüssigkeiten flogen umher, von denen einige Emilias Gesicht und Brust trafen, die sich nun einmal genau im Zentrum dieser unzähligen auf sie gerichteter Rohre befand. Ein paar der Wächterinnen begannen in ihrer Aufregung sogar, noch etwas verlangender zu werden; sie stupsten ihre Wange mit der Eichel an, rieben den Schaft an ihr, ließen die gummiartige Stange auf ihre Haut klatschen und drückten sie auf Einlass pochend an ihre Lippen. Dabei legten sie so viel Enthusiasmus an den Tag, dass Emilia beschloss, ihnen einfach zu gewähren, wonach sie sich so nachdrücklich sehnten. Dazu bedurfte es ja auch nicht viel, sie öffnete nur den Mund, und sofort rutschten die beiden Penisse, die sich in sie zu zwängen versucht hatten, hinein.
Damit stand Emilia wieder vor demselben Problem wie zuvor. Zwar waren diese Schwänze nicht annähernd so massig wie der vorige, doch mit gleich zwei von dieser Sorte in ihrem Mund war ihr Bewegungspotenzial mindestens genau so stark begrenzt. Das hielt die Wächterinnen aber nicht davon ab, ihr eigenes vollständig auszunutzen. Es begann, indem die Wächterin links von Emilia sich ein Stück aus ihr zurückzog. Als die andere es ihr dann gleichtat, schob sich die Erste wieder tiefer hinein, und so fanden die beiden schnell zu einem erprobt wirkenden, stetigen Rhythmus, mit dem sie Emilias Mund ausfüllten. Immer abwechselnd stießen sie mit ihren Latten tiefer in sie vor, in einer unablässigen, fehlerfrei ablaufenden Choreographie, wobei sie sich gegenseitig Platz schafften, wenn sie ein wenig aus dem Loch herausglitten, und kamen dennoch in den Genuss einer berauschenden Enge, die nicht möglich gewesen wäre, hätte nur eine von ihnen den Weg hinein gefunden.
Auf diese Weise fickten die zwei Wächterinnen ihren Mund, wie Emilia es sonst mit den ihr dargebotenen unteren Körperöffnungen ihrer Clubkameradinnen tat. So blieb ihr nicht viel anderes übrig, als stillzuhalten und sich von den Wächterinnen benutzen zu lassen, und zu ihrem eigenen Erstaunen fand sie immer mehr Gefallen daran. Sie hatte nie etwas dagegen gehabt, ihren Freundinnen einen zu blasen, das hatte in ihr immer ein warmes Gefühl absoluter Verbundenheit ausgelöst, doch war es ihr trotzdem lieber gewesen, alleine mit Maria zu sein, sie zu umarmen und zu küssen, während sie sich einander hingaben. Diese Situation hingegen war natürlich etwas grundlegend anderes. Hier gab es keinen Zusammenhalt zwischen ihr und den Dämoninnen, an deren Ständern sie lutschte, hier gab es nur reine Lust.
Dementsprechend haltlos ging es nun auch zu. Die beiden Wächterinnen schräg vor ihr rammten ihr hart ihre Geschlechter zwischen die geöffneten Lippen, während die übrigen, die sich noch gedulden mussten, bis sie zum Zug kamen, ihre steifen nassen Penisse an ihrem Gesicht rieben und sie dabei noch mehr mit ihren Säften beschmierten. Überhaupt wunderte es Emilia wie wenig Berührungsängste die Dämoninnen untereinander hatten. Da waren ja nicht nur die beiden, die dicht gedrängt vor ihr standen und sich in ihrem Mund ergingen, wobei sie es wie selbstverständlich hinnahmen, dass ihre Glieder unablässig übereinander hinwegstrichen, da waren auch noch die Wartenden, die sich in der Zwischenzeit damit begnügten, sich an ihr zu schubbern, ohne darauf zu achten, dass jeder Flecken Haut in Emilias Gesicht ebenso von den Lusttropfen aller anderen besudelt war wie auch von den Resten des Spermas der jungen Wächterin, die sich zuerst in ihr hatte ergießen dürfen. Diese glitschigen Rückstände hafteten noch immer überall an ihr, das konnte sie ganz deutlich spüren, besonders natürlich an ihren Lippen und ihrem Kinn, wo das Zeug an ihr herabgelaufen war, aber im Grunde hatten sich umherfliegende Sprenkel davon bis in die letzten Winkel ihres Gesichts verteilt, und jetzt suhlten die Wächterinnen eben unweigerlich ihre Schwänze in diesen schwammigen Ablagerungen.
Andererseits war es wohl kein Wunder, dass Dämoninnen kein Problem damit hatten, wenn ihre Penisse miteinander in Kontakt kamen oder mit deren Sekreten, immerhin waren sie alle Zwitter, wie sollte sich da so etwas wie Homophobie entwickeln? Zwar konnte die Angst vor der eigenen Sexualität vielfältige Gründe haben, doch in dieser Welt zählte die unbewusste Furcht davor, sich zum gleichen Geschlecht hingezogen zu fühlen, mit Sicherheit nicht dazu. Außerdem wusste Emilia aus Sinistras Erzählungen, dass zwanglose sexuelle Gefälligkeiten hier allgegenwärtig waren, und der unter den Wächterinnen zweifellos herrschende Gemeinschaftsgeist tat wohl auch sein übriges dazu. Wahrscheinlich war die gerade stattfindende Orgie noch harmlos im Vergleich zu denen, die sie üblicherweise veranstalteten.
Allerdings schweiften ihre Gedanken nur kurz zu den soziologischen Zusammenhängen innerhalb des Limbus ab; dazu wurde sie zu sehr von den Myriaden an Eindrücken abgelenkt, die unaufhörlich auf jeden ihrer Sinne einprasselten. Die beiden Schwänze in ihrem Mund dehnten ihre Lippen so weit auseinander, dass deren Winkel leicht zu schmerzen begannen, gleichzeitig konnte Emilia so aber auch sämtliche Einzelheiten in der Anatomie der Penisse wahrnehmen. Das Netz der Adern, das sich fest um sie spann; die sanften Biegungen, die ihre Schäfte ein wenig abknickten; die Textur ihrer haut und das ungestüme Pochen, das sie durchlief, all das konnte Emilia genauestens einschätzen, und das nur anhand dessen, wie sich ihre Oberfläche an sie presste.
So ausgefüllt, wie ihr Mund, war und so hemmungslos wie auf ihn eingestürmt wurde, konnte Emilia natürlich nicht schlucken. Mittlerweile war ihr Mund bis zum Überlaufen voll mit einem Gebräu aus Speichel, dem Präejakulat der beiden Wächterinnen, die gerade mit ihr zugange waren, und den klebrigen Beschmutzungen, die der vorige Erguss in ihr hinterlassen hatte. Sie konnte hören, wie die zwei Penisse schlammige Geräusche verursachten, während sie sich mit zunehmender Geschwindigkeit in sie quetschten, wobei dicke Spritzer dieser heißen Suppe in alle Richtungen davonflogen, und nicht nur Emilia selbst mit schaumigen Flecken überzog, sondern auch die beiden Dämoninnen, die dafür verantwortlich waren, ebenso wie ihre Kameradinnen, die sich bisher lediglich damit zufrieden geben mussten, sich im Rausch von Emilias unmittelbarer Nähe einen abzuschütteln und ihre harten Ständer gelegentlich an ihrer warmen Haut zu reiben. Bei der Begeisterung, mit der sie hier angegangen wurde, konnte Emilia auch nicht verhindern, dass die ausgelaufene Flüssigkeit in ihrem Mund ihr nach und nach über die Lippen trat. Jede Bewegung der Schwänze in ihr verdrängte einen Teil dieser Säfte, die sich dann wie wogende Flutwellen, die über die ihnen gesetzten Dämme hinausstiegen, aus ihr hervorquollen und langsam an ihrem Kinn entlang zu Boden flossen, doch das bemerkte sie eigentlich kaum. Bei all den triefend nassen Penissen, die unablässig über ihr Gesicht wischten und dabei ihre Absonderungen weiter verschmierten, fielen diese zusätzlichen Besudelungen kaum noch auf.
Ohnehin gab es mehr als genug erregende Details an dieser ganzen Sache, die ihre Aufmerksamkeit viel direkter auf sich zu ziehen versuchten. So gingen die beiden Dämoninnen, die ihren Mund für sich beansprucht hatten, nun nicht mehr so geordnet vor. Hatten sie zuvor noch in einem gleichmäßigen beherrschten Rhythmus zugestoßen, konnten sie jetzt offenbar nicht länger so viel Selbstkontrolle aufbringen. Sie zogen sich so schnell und ungezügelt aus Emilia zurück, dass sie dabei jedes Mal beinahe aus ihr herausrutschten. Zwar waren die Verhältnisse in der Körperöffnung, die sie sich teilten, so eng, dass das nicht geschah, dennoch merkte Emilia immer wieder, wie die breiten Eichelränder von innen gegen ihre Lippen schlugen und sie sogar ein Stück nach außen wölbten. Im Umkehrschluss bedeutete das, dass sie ihre Schwänze noch tiefer und härter in sie hinein hämmerten, sodass Emilia kaum noch Luft bekam. Es war, als würde ihr pausenlos eine dicke aufgeschwemmte Zuckerstange bis in den Hals gerammt werden, die ihr so fest die Kehle verschloss, dass sie nur in den kurzen Momenten atmen konnte, wenn sie ihr gerade nicht am Gaumen lag.
Zum Glück stellte sich jedoch heraus, dass beide Wächterinnen diese leidenschaftliche Vehemenz nicht lange aushielten. Sie schafften nur noch ein paar fahrige Beckenschwünge, mit denen sie ihre Ständer so weit wie möglich in Emilias Mund schoben, und bei denen sie bereits laut stöhnten, bevor es ihnen auch schon kam. Mit einem Mal schoss so viel Sperma in sie, dass ihr ein Laut der Überraschung entfuhr, der jedoch in den Fluten, die nun über sie hinwegspülten, unterging. Die zwei Wächterinnen hatten ihren Höhepunkt nahezu im selben Augenblick erreicht, in einem Abstand, der nicht ausgereicht hätte, um wirklich beurteilen zu können, welche von ihnen zuerst so weit war, Emilia konnte nur spüren, wie in ihren von den beiden Schwänzen aufgesperrter Mund, der bereits zuvor übervoll gewesen war mit Speichel und den verschiedensten anderen Körperflüssigkeiten, eruptionsartig Samen hineingepumpt wurde.
Innerhalb eines Herzschlags nahm er schon jeden verfügbaren Platz in ihr ein und musste sich so neue Wege suchen, um in sie zu gelangen. Emilias Backen blähten sich auf von dem Druck, der sich in ihnen ausbreitete, sein Salz brannte ihr in der Nase und schien wie ein dunstiger Nebel in ihr aufzusteigen, als winzige Tropfen davon sogar in ihren Rachenraum gerieten, so als wäre sie im Meer geschwommen und sie hätte eine gewaltige Welle genau in den Mund bekommen, und trotz des wirksamen Knebels, den die zwei Penisse in ihr bildeten, schaffte es ein nicht unbeträchtlicher Teil an ihnen vorbei über ihre Lippen zu schwappen. Doch die immer größer werdende Kompression spritzte das Sperma regelrecht zwischen ihnen hervor, sodass es aussah, als hätte sie versehentlich geronnene Milch trinken wollen, die sie nun angewidert in hohem Bogen ausspuckte. Immerhin floss hier gerade nicht nur die doppelte Menge in sie wie bei einem – für dämonische Verhältnisse – üblichen Erguss, sondern auch noch doppelt so schnell. Wenn Emilia einer ihrer Freundinnen einen geblasen hatte, war ihr aufgefallen, das die meisten von ihnen in einem ganz bestimmten Takt ejakulierten. Es war mehr eine in Schübe unterteilte Entladung, unterbrochen von einem unwillkürlichen Voranstürmen des Beckens, bei dem jedes Mal ein weiterer Schwall Sperma aus der Eichel schoss.
So war es auch jetzt, doch da sich nun eben zwei Schwänze in ihr tummelten, riss der Strom an heißer Sahne, der in sie geleitet wurde, auch nicht ab. Immer wenn sich der eine zurückzog und kurzzeitig nicht weiter auslief, grub sich sofort der andere tiefer in sie, wobei er einen neuerlichen Strahl entließ, der glibschig über ihre Zunge legte. Emilia hatte den Eindruck, dass es ewig so ging, dass ohne Unterlass mehr Samen in sie rann, der heiß und wabernd in ihr brodelte wie die Lava in einem aktiven Vulkan, genau so immer höher in ihr stieg, und schließlich in schaumig-weißen Bächen aus ihr hervorsprudelte wie der Quell eines Geysirs. Die beiden Penisse wirkten dabei mit ihren nun allmählich nachlassenden Fickbewegungen wie Fördertürme. Ohne dass es sich verhindern ließ, zogen sie die zähe Masse mit sich hinaus, wo sie zunächst einmal jedoch an ihnen hängen blieb. Sie wurde zwischen ihnen verrieben, bis die zwei Schäfte vollständig von der dicklichen öligen Flüssigkeit umhüllt waren, sodass es aussah, als wären sie mit Zuckerwatte übergossen worden. Erst nach und nach lösten sich einige Kleckse, fielen von den Schwänzen wie geschmolzenes Wachs von einer schräg gehaltenen Kerze und landeten platschend auf dem Boden.
Irgendwann ließ das unbeugsame Aufzucken der nun langsam schlaffer werdenden Ständer nach und zugleich verebbte auch stete Zulauf an Sperma in Emilias Mund, doch davon ließen sich die beiden Dämoninnen offenbar nicht weiter stören. Schwelgerisch zogen sie ihre Penisse noch eine Weile durch die warme Tunke, die sie in dem ihnen bereitgestellten Loch abgelassen hatten, wobei sie noch mehr davon verteilten, bevor sie letztlich ein zufriedenes Seufzen von sich gaben und sich mit einem Ruck aus Emilia zurückzogen.
Sofort wälzte sich die von ihnen hinterlassene Brühe aus Körpersäften über ihre Lippen und klatschte wie ein zerplatzender, mit Wasser gefüllter Ballon auf ihre Knie. Keuchend beugte sie sich vor, damit ihr kein Samen in die Luftröhre lief, während sie versuchte wieder zu Atem zu kommen, allerdings blieb ihr keine Zeit zum Verschnaufen. Ihr hingen noch immer Speichelfäden und die schmierigen Rückstände der vorigen Wächterinnen vom Kinn, die sich in ihr entleert hatten, als ihr wie aus dem Nichts auch schon die nächste Latte in den Mund geschoben wurde. Emilia fand gerade noch Gelegenheit für ein überraschtes Gurgeln, dann war ihr Mund bereits wieder zur Gänze ausgefüllt von einem massigen Schwanz. Dieser hier war jedoch ein wenig anders als die, die sie zuvor bedient hatte. Die Dämonin war eine von denen, die sich zuvor an ihrem Gesicht gerieben hatten, und hatte nun wohl alles daran gesetzt, als nächste an die Reihe zu kommen. Dabei hatte Emilia ihren Penis jedenfalls schon sehen und auch spüren können. Er war vollkommen weich und glitschig wie ein Pilzgewächs, das in einer feuchten Höhle wucherte. Da hatte er nicht den Eindruck gemacht, als wäre er so groß, wie er ihr jetzt vorkam, vielmehr schien er eher klein gewesen zu sein, doch sobald er Emilias Lippen passiert hatte, war er offensichtlich so weit angeschwollen, bis er allen Raum, der ihn umgab, komplett ausnutzte. Vermutlich war er amorph, er hatte keine feste Form, sondern dehnte sich immer so aus, wie es die Maße des Spalts erlaubten, in den er gesteckt wurde.
Diese These bestätigte sich, als die Wächterin nun begann, ihr Geschlecht in Emilia ein und aus gleiten zu lassen. Es wurde dünner, wenn es zurückgezogen wurde und sich an den engen Lippen vorbeidrängen musste, plusterte sich aber sofort wieder auf, es tiefer in ihren Mund gedrückt wurde, wo es sich matschig an ihre Zunge und den Gaumen schmiegte. Es war, als hätte man ihr einen mit Wasser vollgesogenen Schwamm zum lutschen gegeben, der in ihr bloß noch weiter aufquoll.
Auch diese Dämonin hatte kein Problem damit, in ein reibungsloses Verfahren zu finden. Mit kurzen effizienten Bewegungen drückte sie ihren Schritt Emilias Gesicht entgegen, sodass ihr Schwanz bis zum Anschlag zwischen die Lippen sank. Das fühlte sich ein wenig so an, als würde Emilia eine schmelzende Schokoladenstange an die Wölbung ihres Rachens gepresst, trotzdem kam es ihr wundervoll vor. Sie brauchte nichts weiter zu tun, sondern konnte es nur genießen, wie sich die Wächterin aus eigenem Antrieb Erleichterung verschaffte, und so verschroben es vielleicht auch sein mochte, schenkte es ihr selbst eine seltsame Art der Befriedigung hier auf den Knien zu hocken und sich von dieser Meute völliger Fremder nach deren Willen benutzen zu lassen.
Das nahm sie sogar so sehr gefangen, dass sie darüber ihre eigentliche Aufgabe vergaß. Eine Zeit lang saß sie einfach nur ergeben da und empfing bereitwillig den in ihren Mund fahrenden Penis, bis sie sich endlich wieder darauf besann, wie viele Dämoninnen hier noch anstanden wie bei der beliebtesten Attraktion in einem Freizeitpark, um von ihr beglückt zu werden. Überall um sie herum tänzelten sie unruhig von einem Bein auf das andere, während sie es sich selbst machten oder sie mit ihren Ständern anstupsten, und als Emilia sah, wie sehr es sie auch nur nach der kleinsten Aufmerksamkeit verlangte, beschloss sie, ihnen die Wartezeit zumindest ein wenig zu versüßen.
Also hob sie die Hände, mit denen sie sich bisher abgestützt hatte, und legte sie um die beiden nächstbesten Schwänze, die ihr von allen Seiten entgegengestreckt wurden. Dabei erwischte sie offenbar zwei Wächterinnen, die es ganz besonders nötig hatten, es mal wieder besorgt zu bekommen, jedenfalls schoss aus ihnen beiden fast augenblicklich das Sperma hervor. Der einen kam es schon, als sich Emilias bloß Hand um ihre Stange schloss, der anderen nur einen Moment später, nachdem die Faust zwei Mal an ihr auf und ab geführt worden war. Beide Samenstränge waren so kraftvoll, dass die erste Schliere bis in ihr Gesicht heranreichte, wo sie sich mit den zahllosen anderen Besudelungen vermengte, der Rest ergoss sich auf Schulter, Arme und Hände.
Doch davon ließ Emilia sich nicht aus dem Konzept bringen. Es standen noch zu viele andere Schlange, als dass sie großartig Zeit zu vertrödeln hatte. Ohne sich die Hände an ihrem Kleid abzuwischen, langte sie einfach mit ihren spermabedeckten Fingern nach den nächsten Penissen und masturbierte diese. Im weiteren Verlauf bemühte sie sich, die Dämoninnen, die in die Gunst kamen, es von ihr mit der Hand gemacht zu bekommen, häufig durchzuwechseln, sodass nach Möglichkeit jede einmal an die Reihe kam, wobei die Samenflüssigkeit an ihren Fingern ganz seine Wirkung als Gleitmittel entfalten konnte. Ihre Hände flogen förmlich an den Rohren entlang, benetzten sie mit dem Ejakulat ihrer Kameradinnen und und wandten sich dann einer der anderen zu.
Das klappte so gut, dass sich schnell eine gewisse Routine herausbildete. Sie wichste immer wieder eine neue Wächterin, während die mit dem pilzähnlichen Ding sich selbstständig in ihrem Mund austobte. Allerdings wurde sie bald aus ihrer Konzentration gerissen, als sich plötzlich eine Hand auf ihre Seite legte, die sich langsam, beinahe fragend in Richtung ihrer rechten Brust herantastete. Schließlich erreichte sie sie, strich kitzelnd an ihrem Ansatz vorüber und bedeckte sie endlich völlig mit ihrer Fläche. Dort umschmeichelte sie sie mit einem zärtlichen kreisenden Streicheln, obwohl es da an sich nicht viel gab, womit man hätte spielen können.
Emilia war sich sehr wohl bewusst, dass im Gegensatz zu ihrem Geschlechtsteil ihre Brust doch ziemlich unterentwickelt war. Wo bei ihren Freundinnen immerhin schon die Andeutung von Rundungen zu erkennen waren, war sie bisher noch so gut wie flach. Es waren allerhöchstens kaum wahrnehmbare, winzige Erhebungen, die sanft ansteigend ihre Brustwarzen umgaben, doch daran störte die Wächterin sich offenbar nicht, ebenso wenig wie an der Tatsache, dass ihr Kleid an dieser Stelle völlig durchnässt war von Speichel und Sperma. Ohne innezuhalten kneteten ihre Finger das unmerkliche Hügelchen, streifte über den vom Stoff des Kleids bedeckten Nippel und zeichneten dessen Umriss nach. Das alles tat sie mit solcher Vorsicht, das Emilia sich genötigt sah, ihr auf irgendeine Weise ihre Erlaubnis zu erteilen. So sehr sie zärtliche Berührungen auch begrüßte, wäre es ihr in dieser Situation lieber gewesen, mit etwas mehr Nachdruck behandelt zu werden. So weit sie es konnte, wandte sie ihr Gesicht der Dämonin neben sich zu und schaffte es trotz des Schwanzes in ihrem Mund ihr aufmunternd zuzunicken.
Das hatte sofort den erwünschten Effekt. Nicht nur festigte sich der Griff der Wächterin rechts von ihr, anscheinend fühlten sich dadurch noch mehr der Umstehenden ermutigt, sie zu betatschen, denn unversehens waren überall an ihrem Körper Hände zu spüren. Ihre linke Brust wurde jetzt ebenso befummelt wie die auf der anderen Seite, es gab Finger, die die Fläche ihres Busens rieben und solche, die in dem Bereich darunter liebkosten, ein paar von denen, die hinter ihr standen und keinen Platz mehr an ihrer Brust fanden, begnügten sich damit, ihre Schulter oder ihren Rücken zu streicheln. Bei all dem hörte aber keine von ihnen auf, ihre Ständer an ihr zu reiben. Sie beugten sich bloß ein wenig zu ihr herab, um sie dort zu betasten, wo immer es nur ging, während Emilia weiterhin damit beschäftigt war, ihnen reihum einen runterzuholen und gleichzeitig ihren Kopf stillhielt, damit die eine von ihnen sich mit ihrem Mund amüsieren konnte.
Diese Kombination war für einige von ihnen jedoch bereits zu viel. Auf einmal durchzuckte ein sichtbarer Schauder eine der beiden Dämoninnen, denen Emilia gerade den Schwanz molk und die ihr im Gegenzug die Brust massierte, kurz bevor sie auch schon laut stöhnend kam. Sie stand eigentlich so weit entfernt, dass Emilia bequem ihre Hand über deren wie von Seife überzogene Stange hatte führen können, und ihrer Erfahrung nach überbrückte umherfliegendes Sperma nur selten eine solche Distanz, aber diese Wächterin hier hatte diese Form der Entspannung offensichtlich ebenso dringend nötig gehabt wie die beiden zuvor, die sie als erstes mit der Hand befriedigt hatte, und da Emilias Kopf sich nun einmal notwendigerweise genau auf einer Höhe mit den unzähligen ihr entgegengehaltenen Penissen befand, schoss ihr der Samen dennoch mitten ins Gesicht. Ein dicker Strahl milchiger Flüssigkeit nach dem anderen spritzte machtvoll aus der Dämonin heraus und legte sich wie eine warme, in Brackwasser getränkte Decke über ihre Nase, den Mund und die Wangen. Selbstverständlich wurden dabei auch die Schwänze der übrigen Teilnehmerinnen dieser Orgie, die sich gerade in irgendeiner Weise mit ihrem Gesicht befassten, mit Schlieren von Sperma bedeckt, doch wie schon entdeckt löste das keineswegs Abscheu aus, vielmehr schienen sie sich zu freuen, dass die mit dieser schmierigen Substanz gesprenkelte Haut nun noch glitschiger geworden war. Mit noch mehr Enthusiasmus als zuvor zogen sie ihre Rohre über sie hinweg, sodass sich der Glibber immer weiter über sie verteilte.
Als Tropfen davon ihre Wangen herabrannen, als wäre sie unvermittelt in einen strömenden Regen geraten, zahllose Hände sie überall begrabschten bis hinunter zu ihrem Po und ihr von allen Seiten begierig zitternde Penisse ins Gesicht gehalten wurden, verstand sie besser, warum Maria so angetan davon war, sich von sämtlichen ihrer Bekannten zugleich durchnehmen zu lassen. Es hatte schon etwas ungeheuer Aufregendes an sich, wenn so viele Dämoninnen es mit einem treiben wollten. Sogar in dieser völlig abstrusen Entgleisung, zu der sie sich nur bereit erklärt hatte, um ihre Freundinnen nicht zu verraten, und in der sie von einer ganzen Kompanie an Wächterinnen mehr oder weniger zu einem Objekt degradiert wurde, das einzig ihrer Befriedigung diente, kam sie nicht umhin sich einzugestehen, wie sehr sie das anmachte. Immerhin war sie nie beliebt gewesen, sie war immer verlacht und ausgegrenzt worden, es hatte ja nicht einmal einen Ort gegeben, an dem sie sich wirklich willkommen gefühlt hatte.
Sogar bei sich zu Hause war sie eher ein wenig fehl am Platz gewesen. Das Verhältnis zu ihren Eltern war eben bestenfalls als ambivalent zu beschreiben. Ihre menschliche Mutter war ihr gegenüber zwar meist liebevoll gewesen, doch hatte es auch immer wieder Momente gegeben, in denen sie Emilia angesehen hatte, als wäre sie ein Monstrum, und das war ihr gar nicht vorzuwerfen, war ihr Kind doch aus einer Vergewaltigung hervorgegangen. Emilias dämonische Mutter hingegen hatte sie nie mit einem solchen Blick bedacht, und obwohl sie oberflächlich betrachtet durchaus zärtlich zu ihrer Tochter war, schien das nicht bis in ihr Inneres vorzudringen, als sei das nur eine Rolle, die sie einstudiert hatte und sich jederzeit überstreifen konnte. In ihren Augen war Emilia wohl nichts weiter als ein Werkzeug gewesen, ein Mittel zum Zweck; das war zumindest anzunehmen, bezog man mit ein, wie sehr sie Emilia manipuliert hatte, und sie letztlich auf eine Mission geschickt hatte, um Lilly auszuspionieren. Wie hätte sie unter solchen Umständen auf den Gedanken kommen sollen, sie wäre es wert gewesen, dass man sich um sie kümmerte?
Doch das alles war jetzt plötzlich ganz anders. Jede der Dämoninnen in diesem Raum sehnte sich danach, das Privileg zu gewinnen, von ihr berührt zu werden, sie konnten es kaum erwarten, bis es endlich so weit war und rissen sich förmlich um ihre Aufmerksamkeit. Dieses Gefühl linderte einen Schmerz in ihrer Seele, den sie selten bewusst wahrnahm, der unterschwellig aber unaufhörlich in ihr gewütet hatte.
Damit war sie auf ihrer Suche nach Antworten allerdings noch nicht am Ende angelangt. Das mochte der Grund sein, warum Maria dieser Obsession verfallen war, aber diese Erkenntnis reichte Emilia noch nicht. So hatte sie es nur geschafft, sich in sie hineinzuversetzen, und obwohl es immer ihr größtes Verlangen gewesen war, Verständnis für sich zu erlangen – ein Wunsch, der erst in Erfüllung gegangen war, als sie Maria kennengelernt hatte –, war es ihr in diesem Fall ein Bedürfnis, darüber hinauszugehen. Sie musste selbst erfahren, wie es war, wenn alle ihre Löcher in Beschlag genommen wurden. Das kam ihr nur angemessen vor. Sonst hatte sie immer mitgemacht, wenn Maria sich dem ergab, nun, fand sie, war es an der Zeit, dass sie herausfand, wie das für ihre Freundin war.
Doch wie es aussah, musste sie dazu den ersten Schritt tun. Sie hatte bereits sechs der hier versammelten Wächterinnen zu einem Höhepunkt verholfen, und die, die sich gerade an ihrem Mund abarbeitete, ebenso wie ein paar von denen, die onanierend um sie herum standen, machten den Eindruck, als würden sie nicht mehr lange durchhalten. Wenn das so weiterging, würden ihr bloß wieder alle in den Mund spritzen, und so sehr sie das auch mochte, hatte sie das schon oft genug erlebt, obwohl es diesmal natürlich deutlich mehr wären als üblicherweise. Trotzdem stand ihr Entschluss fest. Heute würde sie die ihr bisher verborgen gebliebenen Abgründe von Marias Psyche erforschen, indem sie sich genau für das hergab, was diese für gewöhnlich übernahm.
Mit dem sich seiner Umgebung anpassenden Schwanz in ihrem Mund, der sich dort so sehr verdickt hatte, dass Emilia sich vorkam, als wäre er ohne jede Rücksicht mit nasser Watte ausgestopft worden, hätte sie keinen einzigen Ton herausbringen können, also behalf sie sich mit der unmissverständlichsten wortlosen Aufforderung zu dem, was ihr vorschwebte, die ihr einfiel: Sie hob ihren Hintern an, nahm ihre Hände von den Schwänzen, die sie gerade masturbierte und setzte sie vor sich auf dem Boden auf, sodass sie nun wieder auf Händen und Knien dahockte. Anschließend griff sie hinter sich und zog ihren Rock so weit hoch, bis er ihren Po freilegte.
Das war nun Anreiz genug. Sobald die Wächterinnen das sahen, wie das Mädchen dort posierte, am Penis einer ihrer Kameradinnen saugend, den Rock ihres Kleids erwartungsvoll beiseite geschoben und ihnen den erhobenen Hintern darbietend, konnten sie sich nicht länger zurückhalten. Sofort spürte Emilia, wie sie auch dort ausgiebig befingert wurde. Mehrere Hände streichelten ihr über die Backen, ein paar Finger legten sich auf ihre von dem Slip bedeckte Scheide, auf dem sich mittlerweile ein feuchter Fleck gebildet hatte, strichen die Länge ihres Schlitzes entlang und rückten sich, so weit der verhüllende Stoff das zuließ, sogar ein wenig hinein. Eine der Wächterinnen war aber offensichtlich von etwas anderem fasziniert, denn sie langte von hinten zwischen Emilias gespreizte Schenkel und betastete das wie von einem Sturm erfasst hin und her schwingende Zelt, das ihr Schwanz in dem Höschen errichtet hatte. Der war inzwischen nämlich zu seiner vollen Größe angewachsen und schlängelte sich seiner Natur gemäß wild umher. Diese sich windende Bewegung weckte vielleicht die Neugier der ihre Kehrseite bewundernden Dämonin, oder vielleicht erkannte sie auch endlich von sich aus, dass ihr nicht grundlos der entblößte Hintern so einladend hingehalten wurde, jedenfalls wurde Emilia der Slip nun kurzerhand herabgezogen.
Als der hinuntergleitende Stoff immer mehr nackte Haut sichtbar werden ließ, glaubte sie hinter sich ein fast schon andächtig klingendes Gemurmel zu hören wie von Besuchern einer Kathedrale, die die Kunstfertigkeit der leuchtenden Bleiglasfenster und der ornamentenreichen Architektur bestaunten ohne die an diesen Orten herrschende Kontemplation stören zu wollen. Doch wenn dem so war, konnte Emilia es sich nicht erklären. Wie ihre Brüste war auch ihr Hinterteil eher wenig imposant. Sie war einfach zu zierlich und ihre Statur zu kindlich, als dass es besonders Aufsehen hätte erregen sollen. Emma zum Beispiel war nicht wirklich schlank, aber genau das machte ihr Äußeres so anziehend. Ihre breiten Hüften gingen in ein Gesäß über, das geradezu perfekt war: rund und voll und weich, wie geschaffen dafür, um sich in eine streichelnde Handfläche zu schmiegen. Das von Emilia dagegen stand kaum vor; alles, was sie aufzubieten hatte, war dieser kümmerlich ausgeformte, in der Mitte gespaltene Hügel, der sie noch unreifer erscheinen ließ, als es ihre zarte Gestalt ohnehin schon tat.
Die hinter ihr knienden Wächterinnen schienen dennoch einigen Gefallen an dem zu finden, was sich vor ihnen auftat. Natürlich war Emilia klar, dass bei ihrem hochgereckten Hintern auch die Scheide zwischen ihren Beinen hervortreten musste, aber die war an sich ja genauso unscheinbar wie der Rest ihres Körpers – wenn man einmal von ihrem glänzend weißem Haar und der unterschiedlichen Färbung ihrer Augen absah. Da ihre äußeren Schamlippen dicht aneinanderstießen und ihr infantil wirkender Intimbereich noch keine Spur von Behaarung erkennen ließ, war sie nicht viel mehr als ein glatter schmaler Schlitz, der sich durch die Wölbung ihres Venushügels zog. Es war nicht einmal eine Ahnung des pinken Inneren auszumachen, die darunter lag.
Wahrscheinlich war es genau dieser Umstand, der nun die Neugier der Dämoninnen weckte. Wenigstens lag diese Vermutung nahe, als sich ihr sachte ein einzelner Finger auf die Scham legte. Der Penis, der in der Wärme ihres Mundes aufgegangen war wie ein Hefeteig, hinderte Emilia daran, sich umzudrehen und die Wächterin anzusehen, aber welche von ihnen es auch sein mochte, sie ging bei ihrer Erkundung mit einer solchen Vorsicht vor, als würde sie eine unermesslich wertvolle, zerbrechliche Skulptur begutachten. Zunächst beschränkte sie sich darauf, die dünne Linie der Spalte sanft mit der Fingerkuppe nachzuzeichnen, und allein dieses kitzelnde Streicheln ließ Emilias Po bereits unwillkürlich vor Unruhe auf und ab wackeln, doch bald wurde die Dämonin etwas wagemutiger. Sie übte nur ein ganz klein wenig mehr Druck aus, aber so feucht wie Emilia mittlerweile war, reichte das, damit die Spitze des Fingers zwischen die äußeren Schamlippen sank.
Kaum war das geschehen, fing er wieder an, sich zu bewegen. Aufreizend langsam glitt er vom untersten Punkt der Scheide bis hinauf zum Kitzler, wo sich dicht über ihm Emilias Schwanz wellenartig hin und her warf, dann fuhr er wieder zurück, sodass die ihn umschließenden Labien sich vor ihm teilten und sich hinter ihm wieder vereinten, gleich den Wasserwirbeln, die entlang eines den Ozean durchpflügenden Schiffes entstanden. Sie konnte fühlen, wie sie stetig feuchter wurde, und so passierte es schließlich fast von selbst, dass der Finger gänzlich in sie drang. Sogar das war für Emilia trotz aller ausschweifender Clubtreffen, an denen sie teilgenommen hatte, ein absolutes Novum. Bisher hatte ihr einfach noch nie jemand auch nur einen Finger eingeführt, nicht einmal Maria. Dabei konnte Emilia gar nicht so genau sagen, woran das lag. Dass es nicht im Zuge einer aus dem Ruder gelaufenen Veranstaltung innerhalb ihres Clubs dazu gekommen war, konnte sie sogar noch verstehen. Sie wusste ja, dass sie ein wenig unnahbar wirkte, und da die anderen zu sehr von ihrem abnormen Schwanz eingenommen waren, um auf den Gedanken zu kommen, sie flachzulegen, war es wohl nicht weiter verwunderlich, dass sie auch nicht darauf gekommen waren, ihr irgendetwas anderes in die Möse zu stecken.
Nur dass Maria das nie versucht hatte, erschien ihr im Nachhinein doch etwas merkwürdig, so vertraut wie sie miteinander waren. Sie hatten über ihre abartigsten Phantasien geredet, sie waren ganz offen zueinander und führten ihre Beziehung auf eine recht libertäre Weise, aber so verquer es auch sein mochte, hatte ihr weibliches Geschlechtsteil nie viel Beachtung gefunden. Zwar hatte Maria sie dort schon nebenbei mitgeleckt, wenn sie ihr einen geblasen hatte, oder sie gestreichelt, wenn sie Liebkosungen miteinander getauscht hatten, doch war Maria nie in der einen oder anderen Form in sie eingedrungen. Dennoch war ihr das Gefühl an sich nicht fremd; es hatte durchaus schon Gelegenheiten gegeben, in denen sie den eigenen Finger in sich gespürt hatte, es hatte nur noch niemand anderes getan.
Zwar befasste sie sich beim Onanieren auch selbst vor allem mit ihrem Schwanz, schon alleine, weil sie zwei Hände brauchte, um seiner ganzen Länge adäquat gerecht zu werden, doch war sie eben von Natur aus neugierig, und nachdem sie sich mehr oder weniger versehentlich selbst gefickt hatte und dabei feststellte, wie befriedigend es war, wenn ihr Kanal so weit wie möglich ausgefüllt wurde, hatte es keinen Grund mehr für Zurückhaltung gegeben. Von da an hatte sie regelmäßig masturbiert, indem sie zwei Finger in sich ein und aus fahren ließ und gleichzeitig mit der Faust der anderen Hand eine Höhle gebildet hatte, in der ihr umherschlagender Penis nach seiner Fasson verhandeln konnte, wenn sie nicht gleich der Versuchung erlag, ihn in sich aufzunehmen, was ihr die stärksten und schönsten Höhepunkte verschaffte, die sie bis dahin erlebt hatte, aber eben auch mit einem schlechten Gewissen ihrer Perversion wegen, sowie von der Gefahr sich selbst zu schwängern, verbunden war.
Die Dämonin, die jetzt in Emilias Spalte herumstocherte, schien jedoch nicht vorrangig das Stillen einer Begierde im Sinn zu haben. Dazu bewegte sie ihren Finger nicht fordernd, nicht leidenschaftlich genug, stattdessen schob sie ihn so zögerlich vor und zurück, als wäre das vornehmlich eine wortlose Frage, ob Emilia mit diesem Vergnügen einverstanden war. Falls diese Vermutung zutraf, werteten die übrigen Wächterinnen ihr leises Stöhnen und das Zucken ihres Beckens offenbar als Zustimmung, denn schon bald spürte sie den Finger einer zweiten Dämonin, der sich behutsam in sie drückte, dann noch einen dritten und schließlich einen vierten, die alle gemeinsam das Innere ihres Tunnels erkundeten. Anders als die beiden Dämoninnen, die zu zweit Gebrauch von ihrem Mund gemacht hatten, gingen sie dabei aber völlig unkoordiniert vor. Jede von ihnen hatte ihre eigene Geschwindigkeit und ihr eigenes Maß an Kraft, mit dem sie den Finger in sie bohrten. In unregelmäßigen Abständen und unabhängig voneinander stießen sie immer wieder vor und zurück, sodass es Emilia vorkam, als würde sie von einem Schwanz gefickt, der beständig seine Form und seine Länge änderte. Das war erstaunlich erregend, allerdings hielt diese lustvolle Behandlung nicht lange an. Plötzlich und aus für sie nicht ersichtlichen Gründen wurden sämtliche Finger aus ihr herausgezogen und ihre sich nach weiteren Zuwendungen sehnende Scheide blieb verlassen.
Nun heißt es bei solchen Vorkommnissen in Romanen ja oft, dass es wie auf einen stummen Befehl hin geschah, um die unvorhergesehene Synchronizität der Ereignisse zu betonen, doch in diesem speziellen Fall geschah es tatsächlich auf einen stummen Befehl hin. Da der dicke pilzähnliche Penis in ihrem Mund es noch immer nicht zuließ, dass sie ihren Blick großartig drehen konnte, hatte sie es nicht mitbekommen, aber die Staffelleiterin war mittlerweile ebenfalls hinter sie getreten und hatte die ihr unterstellten Wächterinnen mit einem kurzen Handwedeln davongescheucht. Zu sehen, wie Emilia hier einer Dämonin nach der anderen einen absaugte, hatte sie immer geiler werden lassen, bis sie dachte, dass sie vor angestautem Begehren platzen würde, wenn sie nicht endlich zum Zug kam, und sich dazu ausführlich an dem Geschlecht dieses Mädchens zu erfreuen, kam ihr genau richtig vor. Ihre Hose hatte sie bereits heruntergelassen, jetzt ging sie in die Knie und brachte sich hinter Emilia in Stellung.
Ihre spitz zulaufende Eichel über den vor Feuchtigkeit glitzernden Schlitz ziehend fragte sie leise: »Ist es in Ordnung, wenn ich mich hier selbst bediene, während du beschäftigt bist?«
Geknebelt von dem zwischen ihre Lippen aufgequollenen weichen Schwanz konnte Emilia ihre Einwilligung nicht in Worten zum Ausdruck bringen; alles, was sie unter diesen Umständen herausbekam, war ein gedämpftes Gurren, wie das wohlige Schnurren einer Katze, die sich im gleißenden Sonnenlicht räkelt, aber das war genug, um der Staffelleiterin einen Eindruck davon zu vermitteln, wie sehr das ihren Wünschen entsprach.
Trotzdem ließ die sich nun Zeit damit, ihren Penis in das ihr zugesicherte Loch tauchen zu lassen. Obwohl in ihrer Brust ein hoch aufloderndes Verlangen brannte, hatte sie ja immerhin schon ein wenig Druck ablassen können, als ihr vorhin das Mädchen am Tor einen geblasen hatte, nur war das viel zu schnell gegangen, um sie wirklich zu befriedigen. Es war eher ein Notbehelf gewesen, mit dem ihre mittlerweile kaum noch zu beherrschenden Triebe wenigstens oberflächlich besänftigen konnte, sodass sie nicht allzu sehr überhand nahmen. Mit diesem Phänomen war sie leider gut vertraut; wenn sie zuvor so scharf gewesen war, dass sie fast sofort zum Orgasmus gelangte, war ihre Lust danach immer noch nicht versiegt, sie schnürte ihr weiterhin die Brust zu und ließ sie den ganzen Tag mit einem Halbsteifen herumlaufen. Da half es nur, es noch ein zweites Mal zu tun, das dann lange genug dauerte, um die Sache wirklich zu einem Abschluss zu bringen, und da der Ausnahmezustand im Palast nun scheinbar offiziell vorüber war, wollte sie diese Gelegenheit auskosten so gut es ging.
Sie stand nicht unbedingt auf so junge Gespielinnen wie es Sinistra unzweifelhaft tat – sie amüsierte sich viel lieber mit den reiferen Damen des Hofstaats, wenn es sich irgendwie einrichten ließ –, dennoch musste sie zugeben, dass dieses neue Dienstmädchen trotz des Fehlens jedweder Kurven außergewöhnlich süß war. Mit ihrem weißen Haar, den zweifarbigen Augen und der zierlichen Figur, die aber unübersehbar von einem starken Geist beseelt war, wirkte sie fast wie eine übernatürliche Erscheinung, vielleicht eine Wassernymphe, die einen geheimen, von einem dichten Wald verborgenen See bewachte. Das Herz der Staffelleiterin schlug jedenfalls schon höher, wenn sie nur daran dachte, dass sie ihre Gelüste gleich in ihr stillen durfte, doch das war nur ein weiterer Grund, nichts zu überstürzen. Wenn sie es diesmal nicht ein wenig ruhiger anging, wäre diese Eskapade schon wieder vorbei, bevor sie endgültige Befreiung hätte erlangen können. Dementsprechend schob sie ihre Hüfte nur sehr gemächlich vorwärts, während sie genoss, wie ihr Penis Zentimeter für Zentimeter weiter von warmer Feuchtigkeit umhüllt wurde, als sie ihn immer tiefer in das glitschige Loch eindringen ließ.
Auf der anderen Seite konnte Emilia genau spüren, wie sich die spitze Eichel zwischen ihre Schamlippen drängte, sie behutsam aufspreizte und dann allmählich bis zum Anschlag in sie getrieben wurde. Dabei war sie erstaunt, dass sie sich nicht in dem Maße beladen fühlte, wie sie es erwartet hatte. Natürlich hatte sie bisher noch keinen anderen Schwanz in sich gehabt als ihren eigenen, und obwohl ihr bewusst war, dass der nicht nur für den menschlichen Durchschnitt, sondern ebenso für den dämonischen, abnorm groß war, hatte sie doch mehr erwartet. Wer auch immer sich ihr da angenommen hatte, war zumindest nicht außerordentlich gut bestückt.
Doch das war Emilia im Moment ohnehin nicht wichtig. Ihr ging es ja hauptsächlich darum, dieselben Erfahrungen zu machen wie Maria, um ihr noch näher zu kommen, um zu verstehen, wie ihre liebenswerte Persönlichkeit zu dem geworden war, was sie heute darstellte. Im Grunde holte sie also an einem Tag alles nach, was ihre Freundin im Laufe einiger Monate erlebt hatte, von ihrem ersten Mal, das Emilia gerade im Begriff war anzugehen, bis hin zu einem hemmungslosen Gangbang, und da war eine breite Diversität an Geschlechtsteilen nur von Vorteil. Immerhin hatte Maria es bestimmt auch mit Ständern in allen möglichen Formen und Größen zu tun gehabt, also war es für sie selbstverständlich, dass sie dasselbe wollte.
Die Dämonin, die sich nun ihrer Scheide bemächtigt hatte, schien es jedoch nicht so eilig zu haben, sich zu erleichtern, wie die, denen Emilia es zuvor mit dem Mund oder den Händen gemacht hatte. Nachdem sie ihren Schwanz so tief wie möglich in sie gebohrt hatte, verharrte sie eine kleine Weile so, wobei ihr ein leises Seufzen der Erlösung entfuhr, als hätte sie lange Zeit eine schwere Last mit sich schleppen müssen, die ihr jetzt gnädigerweise abgenommen worden war, dann erst fing sie an, sich ohne jede Eile zu bewegen. Mit bedächtigem sanftem Schwung ließ sie ihr Becken vor und zurück wandern, sodass ihr wie von glatten Schuppen bedeckter Penis ohne jeden Widerstand durch Emilias Schlitz glitt. Dazu trug natürlich auch bei, dass Emilia seit Beginn ihres unverhofften Engagements als Dienstmädchen in zunehmendem Maße geiler geworden war. Es war seltsam, sie tat das hier ja nicht, um irgendeinen persönlichen Lustgewinn zu erzielen, und eigentlich war sie viel zu sehr von sengender Scham ergriffen, als dass sie überhaupt in der Lage sein sollte, Erregung zu verspüren, doch zu ihrer eigenen Schande musste sie sich eingestehen, dass sie von Anfang an ihren Spaß an dieser Scharade gehabt hatte. Es hatte sie schon heiß gemacht, der ersten dieser Dämoninnen einen zu blasen, so unfassbar schnell das letztendlich auch geschafft war, aber als dann die übrigen Wächterinnen sich ebenfalls entblößt hatten, sie überall gestreichelt hatten und ihre steinharten Ständer an ihr rieben, war es endgültig um sie geschehen gewesen. Das altbekannte Prickeln in ihrem Unterleib hatte eingesetzt, ihr eigener Schwanz hatte unbarmherzig um sich geschlagen und ihre Spalte war so nass geworden, dass deren Nektar in ihren Slip eingesickert war.
Bei so viel Schmiere konnte die Dämonin, die Einlass in ihre Scheide gefunden hatte, ja gar nicht ins Stocken geraten, und das tat sich auch nicht. In ihrem gleichbleibenden gemütlichem Tempo stieß sie von hinten in Emilias Geschlecht, verweilte einen winzigen Augenblick und zog sich dann wieder zurück. Obwohl der in sie fahrende Penis nicht besonders groß war, konnte Emilia dennoch wahrnehmen, wie sich die echsenartigen Schuppen an ihren Labien vorbeischoben, wie die Spitze immer wieder tiefer in sie sank und dabei ihr Inneres auseinanderdrängte. Es war ein berauschendes Gefühl, das sie mehr und mehr gefangen nahm. Der Wächterin, die sich hier mit ihr vergnügte, schien es ähnlich zu ergehen, zumindest hatte die Art, wie sie sanft schaukelnd ihr Becken hin und her wiegte, etwas Traumschwärmerisches an sich, und so ließen sie sich beide gemeinsam mitreißen von diesem eingängigen Rhythmus.
Fast kam es Emilia sogar so vor, als würde sie tanzen. Zwar hatte sie es bisher unter allen Umständen verhindern können, an einer Veranstaltung teilzunehmen, bei der die Gefahr bestand, dass es zu Paartänzen hätte kommen können, aber so in etwa stellte sie es sich vor, ausgehend von den Anhaltspunkten, die sich ihr boten. Musik hatte Emilia eben schon immer viel bedeutet. Sie war ein elementarer Bestandteil ihres Lebens; wann immer es möglich war, steckte sie sich Kopfhörer in die Ohren und gab sich ganz ihrer Melodie hin, und selbst wenn sie gerade keine Musik hören konnte, spielte sie in ihren Gedanken dennoch weiter, insbesondere wenn sie mit einer eher langweiligen repetitiven Aufgabe eingebunden war. Dann war es, als würde in ihrem Kopf ihre ganz persönliche Playlist ablaufen, vorrangig gefüllt mit ihren Lieblingsliedern, doch auch mit solchen, die sie nur zufällig mal gehört hatte, sie aber trotzdem auf die eine oder andere Weise beeindruckt hatten. Manchmal, wenn sie alleine in ihrem Zimmer war, fing sie sogar unwillkürlich allein zu tanzen an. Das passierte, indem sie zunächst nur im Takt der Musik mitwippte – egal ob sie nun wirklich war, oder nur ihrer Imagination entsprang –, bis sie plötzlich, ohne es richtig zu bemerken, einen Fuß vor den anderen setzte, im Zimmer umherwirbelte und ihre Arme in der Luft schwang.
Genau an solche Gelegenheiten fühlte Emilia sich jetzt erinnert. Obwohl die Wächterin nur langsam in sie glitt und dabei keine besondere Kraft anwandte, schubste sie Emilia sie doch jedes Mal eine Winzigkeit vorwärts, sodass sie letzten Endes unentwegt hin und her pendelte, ganz sachte, als würde sie von einer einfühlsamen Partnerin in einem gemessenen Tanz zu unhörbarer elegischer Musik in den Armen gewiegt. Auf diese Weise wurde ihr Gesicht auch immer wieder dicht an den Schritt der Dämonin vor ihr gedrückt, sodass deren Schwanz noch tiefer in Emilias Mund vordrang.
Da der seine Gestalt aber offenbar an seine Umgebung anpasste, hatte das eigentlich keine Auswirkungen auf sie. Das weiche formlose Fleisch behielt seine Ausmaße bei, es bildete sich kein Fortwuchs, der unangenehm an ihre Kehle stoßen würde, vielmehr schien es sich in ihr zu stauchen und zu verdichten, mit dem Ergebnis, dass sich zwar mehr Masse des wuchernden Geschlechts in sie presste, sein Umfang sich aber nicht weiter ausbreitete. Einzig für die Wächterin, der dieser amorphe Penis gehörte, machte das einen merklichen Unterschied, denn so streiften Emilias Lippen unaufhörlich an dem nachgiebigen Schaft entlang, wobei sie ihn dort ein wenig zusammendrückten, wo sie über die nasse glitschige Haut fuhren, und das gefiel ihr ganz offensichtlich. Ihre Hüften fingen an, sich ihr entgegen zu bewegen, während sie den Kopf in den Nacken legte und vernehmbar aufstöhnte.
Vollkommen unvermittelt wurde Emilia nur allzu deutlich bewusst, dass dies also die Verhältnisse waren, in denen sie zum ersten Mal einen anderen Penis als ihren eigenen in sich spürte, den einer völlig Fremden, die sie noch nicht einmal hatte sehen können, und von der sie sich eigentlich nur aus Neugier durchnehmen ließ, während um sie herum bereits unzählige andere Aspirantinnen auf ihre Chance warteten, sich ebenfalls an ihr zu schaffen zu machen, und sie gleichzeitig noch an einem Schwanz in ihrem Mund lutschte. Einen Moment lang war es für sie sogar so, als würde sie eine Art außerkörperlicher Wahrnehmung erleben. Es kam ihr vor, als hätte ihre Seele diese stoffliche Hülle hinter sich gelassen, über der sie nun schwebte und nüchtern, ohne den Endorphinrausch profaner hormoninduzierter Ekstase herab blickte. Es hielt nur für den Bruchteil von Sekunden an, trotzdem hatte sie den Eindruck, als würde sie sich selbst und die gesamte Szenerie, in der sie sich wiederfand, von oben betrachten. Sie sah sich dort am Boden knien, ein blasses zierliches Mädchen mit strahlend weißen Haaren, die ihren Kopf umwehten wie vom Wind aufgewirbelter Schnee, hinter sich eine Dämonin, die ihre Scheide in Beschlag nahm, vor sich eine, die sich von ihr einen blasen ließ, und sie umgebend eine wahre Meute von Dämoninnen mit heruntergelassenen Hosen oder heraushängenden Schwengeln, die sich dicht an sie drängten in der Hoffnung, sofort einspringen zu können, wenn ein Platz in einer ihrer Körperöffnungen frei wurde.
Doch so haltlos dieser Ansturm auf sie auch war, ließ sich eine gewisse Ordnung in diesem scheinbaren Chaos erkennen. Zwar bildeten sich nicht unbedingt konzentrische Kreise um Emilia, die hier überraschend zur Hauptattraktion einer unangekündigten Massenveranstaltung avanciert war, aber die Konstellation glich einem Experiment, das sie erst kürzlich im Physikunterricht durchgeführt hatten. Bei diesem Versuchsaufbau hatte ihr Lehrer einen Stabmagneten unter eine dünne Plexiglasscheibe gehalten, auf der er dann Eisenspäne verstreut hatte, und genau wie die sich entlang der Feldlinien ausgerichtet hatten, verteilten sich auch die Wächterinnen in dem Raum. Unmittelbar neben Emilia, dem Pol, auf den sie alle zustrebten, tummelten sich dicht zusammengedrängt die allermeisten von ihnen, die alle versuchten, sie in irgendeiner Weise zu berühren – von den beiden, die jeweils eine ihrer Brüste in ihrer Handfläche kneteten, oder die ihre Ständer an den Stellen ihres Körpers rieben, die sie eben erreichten, bis zu denen, die sich damit zufriedengaben, einfach nur das Spektakel zu verfolgen, wie dieses junge Dienstmädchen ihre Löcher gestopft bekam und die diesen Anblick nutzten, um sich darauf einen runterzuholen –, während sich die Menge mit zunehmender Entfernung immer weiter ausdünnte, wo nur vereinzelt Wächterinnen herumstanden, die nichts weiter tun konnten, als auf ihre Gelegenheit zu warten, näher an das Geschehen heranzurücken.
Hin und wieder spürte Emilia Tropfen von Präejakulat auf sich herabregnen, wenn die in ihrer direkten Umgebung wichsenden Dämoninnen es noch wilder angingen, sie spürte ihr Streicheln sowie ihr nach Aufmerksamkeit heischendes Herumtänzeln, und sie spürte, wie die sich an sie drückenden Eicheln nasse Flecken auf ihr hinterließen. Zusammen mit den beiden in ihr steckenden Penissen, dem kleinen schuppenbedeckten, der ihre Scheide bearbeitete, und dem wachsartigen, der sich in ihrem Mund breit gemacht hatte, erzeugte das einen Eindruck von Wärme in ihr. Insgeheim wusste sie, dass das eine falsche Annahme war; es war keine echte Nähe, die sie hier empfand, keine Zuneigung von der sie sich einbildete, das die Wächterinnen sie ausstrahlten, es war nur das ungebundene Verlangen, ihre überschäumenden Triebe zu besänftigen, das sie einte, dennoch war Emilia zumindest für den Moment vollauf zufrieden mit sich und den Ereignissen, in die sie geschlittert war. Sie war glücklich damit, begehrt zu werden, glücklich so viel Bewunderung unter dieser Horde von Fremden hervorzurufen und glücklich von diesen zwei Dämoninnen, zwischen denen sie feststeckte, sanft vor und zurück geschaukelt zu werden wie eine Feder, die auf einem stillen See der Gunst von Wind und Wasser ausgeliefert war.
Ihr war also durchaus klar, dass das eher eine unterbewusste Assoziation zu sozialen Bindungen war, vielleicht zu frühkindlichen Erinnerungen von ihrer Mutter in den Armen gehalten und getröstet zu werden, zu dem Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, das das in ihr ausgelöst hatte, doch war sie trotz aller Selbsterkenntnis nun einmal wehrlos gegen die Macht dieser Anwandlungen. Die Empfindung von Verbundenheit, die sie durchströmte, mochte eine Illusion sein, aber die der Intimität war unbestreitbar echt. Sie war in jedem Aspekt dieses ausartenden Zeitvertreibs für die wohlverdiente Pause dieser überstrapazierten Wächterinnen spürbar; in dem Geräusch von nackter Haut, die auf nackte Haut traf, mit dem die Dämonin hinter ihr ihren Ständer in sie bohrte; in dem Geruch der bloßgelegten unzähligen Geschlechtsteile, die ihr von allen Seiten entgegengestreckt wurden; in dem moschusartigen Geschmack nach den Sekreten, die ihr den Mund verklebten sowie natürlich in der simplen Tatsache, dass zwei ihrer Körperöffnungen von Penissen besetzt waren. Das alles entfaltete schon seinen ganz eigenen unwiderstehlichen Zauber, doch im Einklang mit dem betörenden gleichmäßigen Schwingen, das das gegen ihren Hintern prallende Becken verursachte, ließ es sie in einen Zustand völliger Entrückung fallen. Sie fühlte sich wie in Trance, wie bei einer Zeremonie, in der durch ritualistische Gesänge oder Tänze ein kollektives Erlebnis der Transzendenz herbeigeführt werden sollte, es war, als würde ihr Geist sich mit der Welt an sich verbinden, als würde sie völlig in dem Moment aufgehen und nichts anderes würde mehr zählen.
Dementsprechend überrascht war Emilia, als ein Strahl heißen Spermas in ihren Mund schoss. Dabei waren die Anzeichen eines sich anbahnenden Höhepunkts der Dämonin eigentlich nicht zu übersehen gewesen. Ihr immer dringender klingendes Stöhnen, die winzigen impulsiven Zuckungen, die wie Übersprungshandlungen vor einem unvermeidlichen Ausbruch wirkten, und nicht zuletzt das Anspannen ihres gesamten restlichen Körpers waren unmissverständliche Vorboten, die Emilia auf unterschwelliger Ebene zwar durchaus registrierte, denen sie in ihrer ganz auf den Augenblick fokussierten Wahrnehmung aber gar keine Beachtung schenkte. Sogar der formlose Schwanz der Wächterin hatte sich kurz zuvor für die Dauer eines Wimpernschlags zusammengezogen, bevor mit aller Macht der Samen aus ihm hervorspritzte. Emilia war noch immer zu sehr in sich selbst versunken, als dass sie irgendwie hätte reagieren können, sodass ihr Instinkt das Handeln übernahm. Noch ehe ihr überhaupt klar wurde, was sie tat, schluckte sie auch schon und die sämige Flüssigkeit lief ihren Hals hinab.
So ging es Woge um Woge weiter. Jedes Mal, wenn der weiche Penis tiefer in Emilias Mund gedrückt wurde, wurde er zusammengequetscht, und wenn er hinausfuhr, wurde er auseinandergezogen, wobei die eng um ihn geschlossenen Lippen fest an ihm entlangstrichen. Auf diese Weise war es, als würde er gemolken, als würde der Ring, den Emilias Lippen um ihn bildeten, den Samen aus ihm herauspressen, sodass immer, wenn sie sein Ende erreichte, sich ein neuerlicher Schwall in sie ergoss. Auch die schluckte Emilia ganz ohne darüber nachzudenken. Das in sie strömende Sperma war ohnehin so schmierig und wurde so tief in ihr entlassen, dass es fast wie von selbst geschah. Hindernislos sickerte das Ejakulat in ihre Kehle ein und rann in ihr hinab, eine Spur von Wärme und seinem salzigen Geschmack hinter sich herziehend. Das fühlte sich ein wenig so an, als hätte sie an einer Tasse sehr starken würzigen Tees genippt, der auf dem Weg in ihren Magen nicht nur ihre Speiseröhre mit Hitze überzog, sondern nach und nach auch noch ihre gesamte Brust und den Bauch damit erfüllte, während sein Aroma sich brennend an ihrem Gaumen ausbreitete und sich dort festsetzte, als würde der klebrige Samen einfach an ihr haften bleiben.
Die Ladung, die dabei in sie flutete, erwies sich sogar für dämonische Verhältnisse als nahezu unglaublich riesig. Obwohl die einzelnen Schübe nicht außergewöhnlich umfangreich waren, wollten sie doch gar nicht mehr aufhören. In endloser Folge wurde eine Schliere nach der anderen in ihren Mund geschleudert, verteilte seinen durchdringenden Geschmack darin und lief schließlich samtig in ihr hinab. Es mochte daran liegen, dass sie für den Moment jedes Zeitgefühl verloren hatte, aber ihr erschien es, als würde die Wächterin eine Ewigkeit still dort stehen bleiben, nur gelegentlich von unmerklichen Krämpfen geschüttelt und wellenartig eine Unmenge an Samen ausschüttend. Zwar versiegte die Quelle ganz allmählich, aber bis es so weit war, kam es Emilia bereits so vor, als hätte sie ein großes Glas voll dieser heißen Milch in kleinen schlucken, jedoch ohne einmal abzusetzen, ausgetrunken. Schwer und träge spürte sie diesen See aus Sperma in ihrem Bauch, und noch immer kamen einige letzte Tropfen wie die Nachwehen eines gewaltigen Sturms hinzu.
Irgendwann hatte die Wächterin sich aber offenbar zu ihrer Zufriedenheit entleert. Nachdem noch ein einziger runder Tropfen von der Größe einer Rosine aus dem Loch an der Spitze ihres Schwanzes trat, der sich fast schon widerwillig und nur durch äußerste Anstrengung löste und auf Emilias Zunge fiel, wankte sie tief ausatmend einen Schritt zurück. Nun, da ihr Becken ihr gallertartiges Geschlecht nicht mehr in den Mund gedrückt hielt, flutschte es langsam heraus. Erst zog es sich in die Länge, bis es so dünn wurde, dass das Stück hinter Emilias Lippen sich durch die enge Öffnung zwängen konnte und geschmeidig wie eine Schlange, die sich aus ihrem Nest wand, zwischen ihnen hinausglitt. Sie fühlte sich, als wäre sie mit einem nassen Lappen geknebelt gewesen, der jetzt vorsichtig aus ihr hervorgezogen wurde.
Als sich das schneckenähnliche Ding endlich mit einem feucht klingenden Laut vollkommen aus ihr zurückgezogen hatte, schnappte Emilia erst einmal schnell nach Luft, schloss den Mund und schluckte die verbliebenen Reste der verschiedenen Sekrete, die es in ihr zurückgelassen hatte. Die davontaumelnde Wächterin war währenddessen damit beschäftigt, ihren schwammig aussehenden und vor Speichel und Samensträngen triefenden Penis irgendwie wieder in ihrer Hose zu verstauen, doch sobald sie nicht mehr im Weg war, sah Emilia sich bereits von einer ganzen Riege an neuen Ständern umgeben, die ihr bebend vor Erwartung entgegengehalten wurden. Aufs Geratewohl suchte sie sich einen davon aus – einen, der das knollenartige Aussehen einer Ingwerwurzel besaß, und der mit den dicken Sehnsuchtstropfen, die in Fäden von ihm herabhingen, einen besonders bedürftigen Eindruck erweckte – und nahm ihn in den Mund.
Im Gegensatz zu der Dämonin, die sich zuvor von ihr einen hatte blasen lassen, schob diese ihr nicht von sich aus den Schwanz in den Mund, sie hielt einfach nur still und begnügte sich mit den sachten Kopfbewegungen, die dadurch entstanden, dass Emilia langsam von hinten gefickt wurde. Damit war so gut wie ohne Unterbrechung wieder dieselbe Routine wie zuvor hergestellt, bevor sie einen weiteren Samenerguss in ihrem Mund empfangen hatte. Da der Penis der vorigen Wächterin ihren Mund so oder so vollständig ausgefüllt hatte, hatte es ja gar keine Auswirkungen auf sie gehabt, dass sie sich mit ihrem Schritt immer wieder dicht an sie gedrückt hatte. Es hatte sich also bis auf den eilig ausgeführten Tausch des Schwanzes, den sie jetzt lutschte, nichts weiter geändert. Noch immer wurde sie durch die schwachen aber beständigen Beckenstöße in ihre Scheide leicht nach vorne geschubst, nur dass sie diesmal eben auch fühlen konnte, wie die Stange in ihrem Mund hinein und wieder hinausfuhr und wie ganz ohne ihr Zutun ihre Lippen über die glatte Haut strichen. So war es nach wie vor, als würde sie sich von beiden Seiten gleichzeitig besteigen lassen, und das blieb auch erstaunlich wundervoll. Sicher war ihr klar gewesen, dass es schön wäre, sich von sämtlichen Mitglieder des Freak-Clubs durchvögeln zu lassen, wäre es jemals dazu gekommen, doch sie hätte nicht erwartet, wie erregend es war, hier inmitten einer Horde völlig fremder Dämoninnen auf Händen und Knien zu hocken und sie alle der Reihe nach ranzulassen, während sie sich kaum noch dem Andrang des Publikums erwehren konnte, das sich um sie herum eingefunden hatte und das sich in der Zeit, bis sie ihre Chance bekamen, einen Spaß daraus machten, sie mit ihren Schwänzen zu traktieren.
Trotzdem überkamen sie jetzt nicht diese träumerischen Anwandlungen, was vor allem daran lag, dass sie plötzlich eine unerwartete Berührung seitlich unter ihrem Bauch wahrnahm. Zunächst beachtete Emilia sie gar nicht weiter, immerhin wurde sie gerade an allen möglichen nur irgendwie erreichbaren Stellen sowohl von Händen als auch von Penissen gestreichelt, doch dann fiel ihr mit einem Mal auf, dass sich diese hier völlig anders anfühlte. Es waren keine Finger und auch kein noch so absonderliches Geschlechtsteil, das sie da streifte, es war ein von dicken buschigen Haaren bedeckter Kopf.
Verwirrt blickte Emilia an sich herab – zumindest so weit ihr das mit dem Schwanz, der zwischen ihren Lippen steckte, möglich war – und blickte in die hellen grünen Augen der jungen Wächterin, der sie sich als Erste angenommen hatte. Nun war sie offensichtlich gerade dabei, mit dem Rücken auf dem Boden liegend unter sie zu robben. Sie ließ kurz ein scheues Grinsen aufblitzen, dann griff sie nach Emilias vor Begierde wild umherpeitschenden Penis und begann ihn zu wichsen. Dazu benötigte sie beide Hände, aber nicht etwa, weil er so gewaltig gewesen wäre, denn obwohl er ungemein dick war und ihr fast bis zu den Knien reichte, konnte man ihn wenigstens an seinem spitz zulaufenden Ende bequem mit den Fingern umfassen, sondern weil er so unbändig in jede Richtung ausschlug. Emilia war das gewohnt; wenn sie ihn masturbierte, musste sie auch beide Hände zu Hilfe nehmen. Ihr tentakelähnlicher Schwanz war einfach zu glitschig, als dass sie ihn anders hätte festhalten können, also hatte sie ihn dann immer mit einer Hand in der Mitte gepackt und mit der anderen seine Kuppel massiert.
So ging nun auch die junge Wächterin vor. Eine Hand benutzte sie dazu, sein oberes Drittel zu fixieren, obwohl seine Oberfläche so von Feuchtigkeit überzogen war, dass er sich in ihrer starren Faust selbst vor und zurück schlängelte, während sie mit Daumen und Zeigefinger der anderen über seine konisch geformte Eichel fuhr. Sie holte ihr jedoch nicht wirklich einen runter, wie Emilia auffiel. Sie betastete ihn vielmehr, zeichnete seine Konturen nach und befühlte die Beschaffenheit seiner Haut. Anscheinend hatte sie die Eigenartigkeit von Emilias Rohr bemerkt, war neugierig geworden und war ihm nun so nahe gekommen, um es sich genauer zu besehen. Allerdings geriet diese Annahme ins Wanken, als sie auf einmal ihren Kopf vorstreckte, den sich windenden Penis an ihren leicht geöffneten Mund heranführte und ihn sich zwischen die Lippen schob. Mehr Ermutigung war für ihn auch nicht nötig, wie Emilia aus eigener Erfahrung wusste. Wie immer, wenn er eine geeignete Einhöhlung gefunden hatte, legte er eine völlig unvermittelt auftretende Zielstrebigkeit an den Tag und drückte sich jetzt aus eigener Kraft weiter in den Mund der Wächterin hinein, bis er ihn komplett ausfüllte. So verharrte er einen Moment lang, bevor er dazu überging, sich mit schnellen Stößen in ihr vor und zurück zu bewegen. Das war ein unkontrollierbarer Automatismus, und so fickte er ihren Mund ebenso ungezügelt, als wäre er die eigentlich dafür vorgesehene Körperöffnung.
Die Wächterin schien sich jedoch nicht daran zu stören. Sie schloss sogar wie vor Genuss überwältigt die Augen und unterstützte die Bemühungen des sich in sie rammenden Schwanzes, indem sie ihm ihren Kopf ergeben hinhielt. Vielleicht hatte Emilia sich also geirrt, vielleicht war es gar nicht bloße Neugier gewesen, die sie dazu getrieben hatte, sich unter sie zu legen, sondern sie wollte sich einfach bei ihr für den gelisteten Gefallen revanchieren. Doch selbst wenn dem so war, hätte das nichts an den ambivalenten Empfindungen geändert, mit denen Emilia nun konfrontiert wurde. Zwar war es geradezu atemberaubend, wie die junge Dämonin an der Spitze ihres Schwanzes saugte, während sie gleichzeitig den Schaft mit den Händen bearbeitete, dennoch konnte sie einfach nicht verhindern, dass sich ihr Magen vor Verlegenheit zusammenkrampfte, und sie spürte Hitze in ihren Wangen aufsteigen, als sie unwillkürlich errötete.
Das war an sich natürlich eine etwas eigenwillige Gewichtung moralischer Standpunkte. Auf der einen Seite stellte sie hier sämtliche ihrer Körperöffnungen einer ganzen Kompanie ihr völlig fremder Wächterinnen zur freien Verfügung, ohne deshalb an einem schlechten Gewissen zu leiden, aber sobald jemand, dem sie nicht uneingeschränkt vertraute, ihrem eigenen Penis auch nur zu nahe kam, verging sie förmlich vor Scham. Trotzdem überraschte es Emilia nicht. Das war wohl abzusehen gewesen, immerhin war es vor ein paar Monaten, als sie neu auf das Internat gekommen war, und sie ihre ersten sexuellen Erfahrungen gemacht hatte, nachdem Fantasma durch Zufall das Geheimnis ihrer Herkunft entdeckt hatte, nicht anders gewesen. Auch damals war sie entgegen aller Lust peinlich berührt gewesen, als dieses Mädchen, das sie an diesem Tag gerade erst kennengelernt hatte, ihr einen geblasen hatte, und das war ihrer Meinung nach auch nicht ohne Grund der Fall. Sie hatte nun einmal schon früh festgestellt, wie abnorm ihr Schwanz war. Sie hatte sich sowieso schon wie ein Monster gefühlt, weil sie überhaupt einen besaß, weil sie immer gedacht hatte, die einzige Halbdämonin auf der Welt zu sein, und damit ganz allein mit ihren Problemen, ohne dass jemand sie je wirklich verstehen könnte, ohne dass jemand ihren Schmerz, ihre Wünsche oder ihre Hoffnungen nachvollziehen könnte, und obwohl sich letzteres als Irrtum herausgestellt hatte, nachdem sie beide immer mehr Mitglieder für ihren Club gefunden hatten, war es doch dabei geblieben, dass ihr Penis eine Depravation war.
Selbstverständlich hatten die Geschlechter der anderen ebenfalls ihre gewissen Eigenheiten, aber keines war so obskur wie ihres. Sein abartiges Aussehen, das an den Fangarm eines Oktopus erinnerte, seine zu dieser Assoziation passenden wellenartigen Bewegungen sowie die schleimigen Sekrete, die aus jeder seine Poren traten, wenn Emilia geil wurde; das alles machte es nur zu einer Abscheu erregenden Deformation, wie sollte sie also keine Scham dabei empfinden, wenn jemand etwas so Intimes tat, wie daran zu lecken? Das war keine Schüchternheit, das war bloßer Selbstschutz. Über die Jahre hinweg hatte sie schnell gelernt, dass nichts so leicht Ablehnung hervorrief wie Andersartigkeit, was sollte also schon dabei herauskommen, wenn sie jemandem ihre Andersartigkeit ganz offen ins Gesicht klatschte?
Vor diesem Hintergrund erschien es ihr fast schon unglaublich, wie leicht es ihr in der weiteren Entstehung des Freak-Clubs gefallen war, sich da neuen Anwärterinnen nackt zu zeigen, aber das war irgendwie etwas Anderes gewesen. Zum einen hatten die sich über alle Maßen gefreut, weil sie ebenso wie Emilia immer angenommen hatten, die einzigen ihrer Art zu sein, und zum anderen waren es jedes Mal mehr Mitglieder auf ihrer Seite gewesen, die sich gemeinsam mit ihr ausgezogen hatten, nun jedoch erfuhr sie zum ersten Mal, wie es sich für sie angefühlt hatte, als Neuankömmling einer solchen Übermacht von eingeschworenen Kameradinnen gegenüberzustehen. Hier war sie es plötzlich, die völlig auf sich gestellt dastand, umringt von einem Haufen fremder Leute, die von ihr erwarteten, dass sie die Beine für sie breit machte – und sie konnte nicht abstreiten, dass sie selbst ganz scharf darauf war. Nicht nur waren das Wogen ihres Penis und die ausfließenden Säfte ihrer Scheide untrügliche Indizien, sondern letztendlich war es ja genau das, weshalb sie überhaupt eingewilligt hatte, diese Aufgabe zu übernehmen.
Sie hatte sich dafür entschieden, um sich Maria näher zu fühlen, und das waren ohne Zweifel die perfekten Umstände dafür, schließlich hatte sie im Club ganz Ähnliches erlebt. Sie war ihm als Letzte beigetreten, dementsprechend waren bei ihrer Einweihungsfeier die meisten Mitglieder zugegen gewesen und noch dazu als einziger Mensch inmitten von hormongeplagten Halbdämoninnen im Teenageralter. Auch sie war also allein gewesen, als sie dazu angehalten war, sich um die Befriedigung der körperlichen Bedürfnisse der Hälfte ihrer Klassenkameradinnen zu kümmern, und es lag zumindest nahe, dass auch sie währenddessen nicht frei von Schuldgefühlen war, denn auch wenn das schon lange ihre liebste Phantasie gewesen war, wie sie so freimütig erzählt hatte, stammte sie dennoch aus einem strengen, recht konservativen Haus, außerdem war das mit Sicherheit nichts, was gesellschaftlich allgemein akzeptiert gewesen wäre. Insofern fügte ihre Verlegenheit dem Geschehen eine weitere Dimension hinzu, die für ihr Verständnis, was genau an dieser Abart der Lust Maria so anmachte, unbedingt notwendig war.
Die junge Wächterin schien jedoch gar nicht zu bemerken, in welch paradoxe Gefühlswelten sie Emilia mit ihrem Tun stürzte. Sie hatte buchstäblich alle Hände voll zu tun, den sich stürmisch in sie schlängelnden Schwanz zu bändigen. Hätte sie ihn nicht gehalten, hätte er mit aller Wahrscheinlichkeit viel zu weit ausgeholt und wäre so immer wieder zwischen ihre Lippen hervorgerutscht, so aufgebracht wie er sich hier ausnahm. Ihr Mund war dick beschmiert mit den Säften, die der Penis mit seinen Bestrebungen, tiefer hinein zu gelangen, über ihm verteilte, zudem verhinderten sie, dass die Dämonin ihre Lippen ganz um ihn schließen konnte. Deshalb spritzte dabei Speichel aus ihnen hervor wie bei einem Glas, das man heftig mit einem Schwamm schrubbte, vermischte sich dort mit den übrigen Flüssigkeiten und bildete so einen weißlichen Schaum, der nach und nach in sich ausdünnenden Bächen ihr Gesicht herablief. Es sah aus, als hätte sie versucht, während eines Erdbebens ein Stück Sahnetorte zu essen, was dann erwartungsgemäße Konsequenzen nach sich gezogen hatte.
Bei der Hingabe, mit der sie zu Werke ging, war es nur schwer vorstellbar, dass sie nur dazu verleitet worden war, weil sie Emilia auf diese Weise für ihren vorigen Dienst danken wollte. Es erweckte viel eher den Anschein, als hätte sie selbst einige Freude daran, und das verstand Emilia nur zu gut. Die junge Wächterin war als erste aus einer breiten Masse an Bittstellerinnen auserwählt worden, mit dieser ganz besonderen Form des Beistands umsorgt zu werden, und dabei so schnell gekommen, dass sie gar keine Möglichkeit gehabt hatte, richtig in Stimmung zu kommen, wie sollte sie da nicht wieder das Verlangen in ihr aufflammen, wenn sie gezwungen war zuzusehen, wie ihr gesamtes Kollegium nacheinander das bekamen, wonach sie sich noch immer sehnte? Es war eben weitaus erfüllender, es langsam anzugehen, sich von zärtlichen Berührungen, Küssen und sanftem Streicheln immer weiter zu steigern, bis man die höchsten Gipfel der Lust stürmte. Doch das war hier wohl nicht vorgesehen, so weit Emilia das überblicken konnte, schien es eher darum zu gehen, hier den Wächterinnen nur kurz Gelegenheit zu geben, ihre sexuelle Anspannung abzubauen, bevor sie mit ihrem Training fortfuhren.
Das war dieser jungen Dämonin aber offenbar nicht genug, und auch wenn es ein reines Substitut sein mochte, ihr einen abzusaugen, wusste Emilia, wie hinreißend es war, es jemand anderem mit dem Mund zu machen. Es hatte eigentlich sogar etwas ganz und gar Beruhigendes an sich, die Wärme des Schritts an den Wangen zu spüren, den süßlichen Geruch einzuatmen und das Pulsieren des Geschlechts mit den Lippen wahrnehmen zu können. Sie hatte schon oft genug erlebt, wie leicht man sich das hineinsteigern konnte und wie befreit man sich selbst fühlte, wenn man es schaffte, seinen Partner damit einen Höhepunkt zu verschaffen. Selbst jetzt, als sie gerade an dem harten Ständer einer Wächterin lutschte, die sie noch nie zuvor gesehen hatte, statt an dem einer ihrer Freundinnen, und der sie sich auch nur aus Zufall, nicht wegen irgendeiner Verbundenheit annahm, besaß das eine Magie, der sie sich nicht entziehen konnte.
Plötzlich fiel Emilia auch noch ein Hinweis auf, dass die Dämonin nicht aus völlig uneigennützigen Motiven handelte. Auf einmal spürte sie nämlich einen Penis gegen ihren Bauch drücken. Das wäre an sich selbstverständlich nicht weiter bemerkenswert gewesen, war sie doch noch immer umringt von einer Kompanie wild erregter Wächterinnen, die nun durch die Aussicht, ihren über die Tage aufgestautem Stress endlich wieder mit Hilfe eines jungen Dienstmädchens bewältigen zu dürfen, beinahe rasend vor Ausgelassenheit waren. Schon die ganze Zeit über war sie nicht nur an jeder irgendwie zugängigen Stelle ihres Körpers befingert worden, sondern es hatten sich auch unzählige Schwänze an ihr gerieben, und ihr Bauch war in diesem Zusammenhang nicht die seltsamste Wahl, aber in diesem Fall stimmte der Winkel nicht. Die Eichel ragte von unter her steil zu ihr nach oben, was nur eines bedeuten konnte. Zwar konnte Emilia mit dem Rohr in ihrem Mund den Kopf nicht weit genug senken, um ihre Vermutung zu bestätigen, aber das war in diesem Fall wohl auch nicht unbedingt notwendig. Es gab nur eine plausible Erklärung, offenbar hatte die Dämonin unter ihr einen Steifen bekommen, der nun nach Aufmerksamkeit hungerte, ob es nun daran lag, dass ihr vorangegangener Orgasmus ihr nicht völlige Erlösung hatte geben können, oder ob die Tatsache, dass sie Emilia einen blies das schwindende Feuer der Leidenschaft wieder von Neuem auflodern ließ.
Nur leider war Emilia im Moment zu beschäftigt, als dass sie sich um ihn hätte kümmern können. So wie er vom Schritt der unter ihr liegenden Wächterin abstand konnte sie ihn nicht in ihre letzte noch freie Körperöffnung aufnehmen und ihre Hände brauchte sie, um sich abzustützen, zudem versank sie immer mehr in ihrer eigenen Verzückung. Es war einfach zu berauschend, wie sie es mit beiden ihrer Geschlechtsteile zugleich besorgt bekam, wie an ihrem Penis gesaugt und geleckte wurde, während ihre Scheide von langsamen Stößen durchzogen wurde. Dennoch entging ihr nicht, dass auch die Dämonin, die sich gerade an ihrer Spalte ausließ, sich unaufhaltsam einem Höhepunkt annäherte. Sie wurde jedoch nicht hastiger und nicht unbedachter in der Art, wie sie ihr Becken vorschob, vielmehr war das genaue Gegenteil der Fall, sie bewegte sich noch gefasster, als wäre sie eine Dirigentin, die sich mit aller Kraft darauf konzentrieren musste, einen gleichmäßigen Takt beizubehalten, und statt schneller zu werden, drängte sie sich nun wie mit mühsam unterdrückter Euphorie Emilias Hintern entgegen.
Letztendlich kam es ihnen gleichzeitig. Emilia spürte gerade, wie der erste dicke Strahl Sperma in sie gepumpt wurde, als sie ebenfalls abzuspritzen begann. Das fühlte sich ein wenig so an wie bei den Anlässen, in denen sie beim Masturbieren ihrem unaufhörlich nach einem geeigneten Loch umhertastenden Schwanz erlaubt hatte, gleich ihren eigenen Schlitz zu benutzen. In demselben Maße wie sich der Samen aus ihr ergoss, wurde auch sie damit überschwemmt, nur dass es diesmal der Saft einer ihr völlig unbekannten Wächterin war, der in sie floss, und sie selbst in den Mund einer weiteren, ihr ebenso unbekannten Wächterin ejakulierte. Mehr und mehr der heißen Flüssigkeit schoss in einzelnen Schüben in sie, überzog ihre Scheidenwände mit seiner klebrigen Wärme und füllte ihren Kanal so immer weiter auf, bis schließlich nicht der kleinste Tropfen noch hineingepasst hätte, sodass er unweigerlich überlief, Rinnsale davon sich aus der schmalen Lücke zwischen ihren Schamlippen und dem Penis darin herauswanden und wie Spinnen an ihren silbrig glänzenden Fäden langsam dem Boden entgegen schwebten.
Ein Blick hinab zeigte Emilia, dass es der jungen Wächterin, die ihre den Schwanz lutschte, nicht anders erging. Die Ladung, die sie ihr in den Mund strömen ließ, hatte sie anscheinend ganz unvorhergesehen getroffen, oder sie war einfach von deren Art und Menge überrascht. Emilia wusste, dass sie von allen Mitgliedern des Freak-Clubs mit Abstand das meiste Sperma bei einem Orgasmus abgab, obwohl es bei ihnen allen mindestens das Zehnfache eines Menschen war – Isabelle hatte dies betreffend umfassende Berechnungen und Tests angestellt –, und dass sie alles auf einmal in einem einzigen massiven Schwall abfeuerte, als würde einem jemand mit Hochdruck den Inhalt eines vollen Glases Milch in eine bestimmte Körperöffnung leiten, machte es sicher auch nicht besser.
Sie war es also gewohnt, dass jedes Mal, wenn sie es mit dem Mund gemacht bekam, es genau so endete wie bei der Wächterin jetzt. Ihre Wangen hatten sich bereits sichtbar ausgewölbt, so viel Samenflüssigkeit war mit einem Mal in ihr entleert worden, trotzdem hatte das noch nicht ausgereicht, das sie alles in sich behalten konnte; die um das Rohr geschlossenen Lippen waren für die aufkommende Flut kein Hindernis gewesen, sie war einfach über sie hinweg gespült, hatte den dort hängenden Schaum von Wollusttropfen und Speichel mit sich gerissen und war ihr über das gesamte Gesicht geronnen. Sämtliche Vertiefungen und Neigungen, die ihre Physiognomie aufwies, war nun mit Flüssen und Seen aus Sperma bedeckt, es sammelte sich in dem Tal um ihre Nase herum, schob sich weiß und in unterschiedlichen Abstufungen der Konsistenz wie sich verschiebende Gletscher über ihr Kinn und lief sämig ihren Hals hinab.
Emilia hätte erwartet, dass die Wächterin nun, nachdem ihr Mund dermaßen mit Schleim besudelt worden war, sich so schnell wie möglich erheben würde, um das Zeug auszuspucken, aber das tat sie nicht. Sie blieb still liegen, behielt Emilias sich allmählich beruhigenden Penis weiterhin im Mund, sah ihr fest in die Augen und begann dann bewusst zu schlucken. Sie trank langsam, mit ausgedehnten Pausen zwischen den einzelnen Schlucken, ganz so als würde sie es genießen und wollte, dass es nicht so bald vorüber war. Fast ein wenig fassungslos beobachtete Emilia, wie ihre Wangen immer weiter zurück zu ihrer ursprünglichen Größe schrumpften, als die Wächterin ihren Samen offenbar bis zum letzten Tropfen in sich hineinschlürfte. Das hatte jedoch nichts damit zu tun, dass sie nicht hätte glauben können, dass die Dämonin etwas derartig Unanständiges tat, immerhin hatten schon alle ihre Freundinnen und sogar sie selbst das Gleiche gemacht, aber keine von ihnen – nicht einmal Nicole, die grundsätzlich auf alles stand, was auch nur im entferntesten mit Sperma zu tun hatte – hatte so begeistert an ihrem Schwanz genuckelt, um auch noch den letzten Rest seiner Sahne aus ihm herauszusaugen.
Das war ein überaus intensives Gefühl. Emilia spürte, wie sich mit einem Schaudern ein nachträglicher, beinahe schon verzweifelter Spritzer Ejakulat aus ihr löste, der ein unangenehmes Ziehen auf seinem Weg hinterließ, von den innerhalb ihres Körpers liegenden Hoden, den Samenleiter entlang bis hinauf zur Spitze ihres Rohrs. Es waren nur noch ein paar winzige Tropfen, die da aus ihr hervorsickerten, aber als das geschah, war das so befreiend, dass sie einen Moment Schwierigkeiten hatte, sich noch aufrecht zu halten. Nur unter äußerster Anstrengung gelang ihr das, doch als dieser Schwächeanfall vergangen war, kam es ihr vor, als würde sie alles ein bisschen klarer sehen. Plötzlich bemerkte sie, dass inzwischen auch der Orgasmus der Wächterin hinter ihr abgeklungen war.
Während es ihr gekommen war, hatte die sich ruhig und gleichmäßig weiterbewegt, und erst als die wuchtig aus ihr hervorschießenden Fontänen zu dem Tröpfeln eines undichten Wasserhahns abgeflacht waren, hatte sie allmählich in ihren unerschütterlichen Verausgabungen nachgelassen. Zu diesem Zeitpunkt war Emilias Schlitz jedoch schon bis zum Überlaufen mit Sperma gefüllt. Warm und glibberig waberte es in ihr umher, quoll an dem nicht gerade großzügig bemessenen Penis vorbei aus ihr heraus und lief anschließend kribbelnd ihre Schenkel hinab. Nach einer Weile atmete die Wächterin noch einmal tief durch, bevor sie sich seufzend aus Emilia zurückzog. Sobald ihr nun erschlaffender Ständer mit einem leisen Schmatzen aus dem völlig beschmierten Loch glitt, folgte ihm eine Welle des Samens, den er dort hinterlassen hatte, die sich langsam zwischen den noch immer leicht geöffneten Schamlippen herauswand und von ihnen wie ein Klecks flüssigen Klebstoffs zu Boden fiel.
Das beachtete die Wächterin aber gar nicht weiter. Noch ehe ihr aus Emilias Scheide fließender Samen mit einem Platschen aufkam, hatte sie sich bereits aufgerichtet und war zurück in die Menge der sie umgebenden nackten Dämoninnen getreten, von der sie nun nicht mehr zu unterscheiden war. Erst da fiel Emilia auf, das es jetzt zu spät war, um noch herausfinden zu können, wer ihr denn überhaupt die Jungfräulichkeit genommen hatte – falls man das denn so nennen konnte, nachdem sie ihren gesamten Freundeskreis schon genagelt hatte und auch selbst von ihrem eigenen Schwanz genagelt worden war. Mit dem Ständer in ihrem Mund hatte sie sich jedenfalls nicht umsehen können, um wenigstens einen Blick auf sie zu werfen, wenn sie sie schon nicht richtig kennengelernt hatte und nun gab es keine Möglichkeit mehr, das nachzuholen. Auf diese Weise war das Erlebnis also für sie verlaufen, bei dem zum ersten Mal ein anderer Penis als ihr eigener sich in ihr ergangen hatte; es war ein vollkommen anonyme Wächterin gewesen, von der sie weder den Namen kannte, noch wusste wie sie aussah, und die zufälligerweise einfach als Erste an die Reihe gekommen war, sich im Zuge eines Gangbangs mit ihr zu amüsieren, bei dem sie sämtliche ihrer Körperöffnungen zu frei zugänglichem Allgemeingut erklärt hatte. Aber was hatte sie denn auch anderes erwartet? Ihr ganzes bisheriges Leben war eine einzige Abfolge von Abnormitäten gewesen; schon ihr erstes Mal, bei dem ihr Penis bei jemand anderem als ihr selbst zum Einsatz gekommen war, hätte kaum abstruser sein können, warum sollte nun also das mit ihrem zweiten Geschlechtsteil eine Ausnahme von dieser scheinbar universellen Regel darstellen?
Trotzdem war das kein Grund, irgendetwas zu bereuen, entschied sie. Egal, in welch absonderliche Situationen das Schicksal sie auch immer geführt haben mochte, oder zu welch verruchten Taten sie sich hatte hinreißen lassen, in letzter Konsequenz war alles bloß Teil einer Entwicklung gewesen, in deren Ergebnis sie im Freak-Club gelandet war, einer Gemeinschaft, zu der sie eine tiefe Verbundenheit spürte und in der sie sich endlich angenommen fühlte, und natürlich war sie mit Maria zusammengekommen, dem Mädchen, das sie von ganzem Herzen liebte. Sie musste also keine Scham deswegen empfinden, und ebenso wenig musste sie sich dafür schämen, was nun hier vor sich ging. Wie sie es geplant hatte, würde es sie Maria nur noch näher bringen, und das war doch alles, was zählte.
Dieser Gedanke stärkte sie noch einmal in ihrem Entschluss und gab ihr die nötige emotionale Kraft, den nächsten Schritt auf ihrem Weg zur Erfüllung ihres Ziels zu gehen. Ein schneller Blick hinab zeigte ihr, dass die junge Wächterin noch immer reglos unter ihr lag, die Augen schwelgerisch geschlossen und ihr Ständer steil aus ihrem Intimbereich aufragend, während sie mit schweren Schlucken offenbar versuchte, die klebrigen Rückstände des Spermas aus ihrem Mund zu bekommen, mit dem Emilia sie so freigiebig bedacht hatte. Das war tatsächlich unerlässlich für die Idee, die Emilia hatte, um diese Eskapade noch mehr denen anzugleichen, die Maria im Laufe ihrer Mitgliedschaft im Freak-Club abgehalten hatte, denn da war es selten dabei geblieben, dass sich nur zwei ihrer Freundinnen zur selben Zeit an ihr zu schaffen machten. In den allermeisten Fällen waren es mindestens drei – einer in ihrer Scheide, einer in ihrem Mund und einer in ihrem Arsch – und manchmal, wenn die Stimmung allzu ausgelassen war, kam es auch schon mal vor, dass sich zwei Schwänze zusammen in dasselbe Loch verirrten. Das war zwar immer nur in der Hitze des Augenblicks geschehen, trotzdem hatte Maria ihr einmal gestanden, wie sehr ihr das gefiel. Nicht wegen des Gefühls an sich, sondern wegen der Implikationen, die damit einher gingen. Sie liebte es einfach, das Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit zu sein, sie suchte förmlich nach jeder Art von Bewunderung und Bestätigung, die sie bekommen konnte, und wenn dann die Leute alles daran setzten, sich in jede noch so winzige Lücke zu quetschen, die ihr Körper zu bieten hatte, war das für sie eben der Himmel auf Erden.
Was Analverkehr anging so war das ohnehin eine von Marias besonderen Vorlieben, nur hatte Emilia bisher noch nicht herausfinden können, warum eigentlich. Das hatte sie nicht weiter ausgeführt, und Emilia, die in diesem Bereich noch gar keine Erfahrungen gemacht hatte, hatte es damals versäumt weiter nachzuhaken. Sie hatte einfach akzeptiert, dass ihre feste Freundin darauf stand, wenn ihr ein wie auch immer geartetes Objekt in den Hintern eingeführt wurde. Erst später war sie zu der Einsicht gelangt, dass das doch etwas merkwürdig war, denn was sollte schon so geil daran sein, einen Penis in den Darm statt in die Scheide gesteckt zu bekommen? Sie wäre von sich aus zumindest nie auf den Gedanken verfallen, ihren After zu befingern statt ihrer Geschlechtsteile, wenn sie es sich selbst machte. Aber genau deshalb hatte sie sich ja auf dieses Abenteuer eingelassen, hier konnte sie die Antwort auf ihre offenen Fragen in einem eigenhändig durchgeführten Experiment auf eine ganz praktische Weise herausfinden. Ihr weiteres Vorgehen lag also auf der Hand; ihre oberste Priorität war zunächst, die Dämoninnen dazu zu bringen, ihre Kehrseite zu besteigen, aber das sollte eigentlich keinen Aufwand darstellen, so viele freiwillige Helfer wie hier zugegen waren, und genau da setzte ihr Plan ein.
Bevor eine der gierenden Dämoninnen sich von hinten ihrer Spalte nähern konnte, womit sie in Emilias kniender Position den Zugang zu Emilias Anus versperrt hätte, bewegte sie ihr ausgestrecktes Hinterteil ein wenig seitwärts, bis ihr Körper parallel über der am Boden liegenden Wächterin schwebte und schwang ein Bein über sie hinweg. Mit dem zusätzlichen Schwanz in ihrem Mund benötigte das einiges an vorsichtigem Manövrieren, damit er nicht versehentlich aus ihr herausrutschte, doch schaffte sie es letztendlich. Anschließend brauchte sie einen Moment, um ihr Becken genau senkrecht über den steif abstehenden Penis unter ihr zu bringen, dann setzte sie dazu an, sich auf ihm niederzulassen. Das erwies sich jedoch als ungeahnte Herausforderung. Sie hatte sich immerhin tief vornübergebeugt, um der zweiten Dämonin weiterhin einen blasen zu können, da konnte sie nicht einfach ihre Hände zu Hilfe nehmen. Hätte sie das getan, wäre sie wegen des verlagerten Schwerpunkts unweigerlich umgekippt. Ihr blieb also nichts anderes übrig, als sich auf bloße Schätzungen zu verlassen, und das war doch weit schwieriger als gedacht. Ihre ersten Versuche schlugen ein ums andere Mal fehl, ihr samengefluteter Schlitz war eben zu glitschig, als dass die dicke Eichel der Wächterin ohne jede Führung den Weg hinein finden würde. Er war ja nicht nur vollkommen durchnässt von seinen eigenen Säften, aus ihm tropften auch noch die Reste der vorigen Entladung, die dort hineingeleitet worden war, und so glitt der Ständer immer wieder an der anvisierten Öffnung vorbei, was dazu führte, dass Emilias Schritt auf die Hüfte der Dämonin unter ihr klatschte, einen feuchten Fleck von austretendem Sperma darauf hinterließ und ihr frei umherschwingender Schwanz wie eine fleischige Peitsche auf deren Bauch prallte.
Zum Glück war ihre Absicht aber kaum misszuverstehen, und da die durchaus im Interesse der Wächterin selbst lag, beschloss diese nun einzugreifen. Mit einer Hand umfasste sie ihr hartes Rohr und hielt es so an seinem Platz, während Emilia erneut ihr Becken hob. Das reichte bereits an Vorkehrungen. Als Emilia ihre Scheide jetzt auf die rundliche Eichel drückte, rutschte sie nicht ab, stattdessen teilte die von Vorsamen benetzte Spitze ihre Schamlippen und schob sich trotz des beträchtlichen Umfangs ohne jeden Widerstand in sie. Dabei konnte Emilia ein schwaches Stöhnen nicht unterdrücken, auch wenn das mit dem Penis in ihrem Mund kaum zu hören war. Im Grunde genommen stand dieses Gefühl im genauen Gegenteil zu dem, wenn sie sich ihr eigenes Ding eingeführt hatte. Da war es ja so gewesen, dass die Spitze sehr dünn war und sich zu seinem Ansatz hin immer weiter verdickte, bei dem hier jedoch war die Eichel deutlich größer als der Schaft, und sie saß fast wie eine Kugel am Griffende eines Spazierstocks. Damit unterschied er sich natürlich auch von dem der vorigen Wächterin, der bis dahin einzig anderen, die der Einlass in ihre Weiblichkeit gewährt worden war. Es war zwar unbestreitbar reizvoll gewesen, als die doch recht wenig beeindruckende Latte dieser unbekannten Wächterin sie so langsam und einfühlsam durchgenommen hatte, aber nun zu spüren, wie ihr Inneres so gedehnt wurde, war ohne Zweifel sehr viel mitreißender.
Erst mit einiger Verspätung bemerkte Emilia, dass sie eine ganze Zeit in dieser unbequemen Haltung zugebracht hatte, während sie sich daran gewöhnte, wie der riesige Schwanz ihre Scheidenwände spreizte; mit dem Unterschenkel auf dem Boden, den Hintern erhoben und sich mit den Händen abstützend, sodass sie der anderen Dämonin die Stange lutschen konnte. Dementsprechend ließ sie sich jetzt langsam weiter auf die Wächterin unter ihr sinken, deren Rohr so immer tiefer in sie drang. Deutlich konnte Emilia fühlen, wie die dicke runde Eichel die Enge ihres Tunnels aufweitete, während sie bis zu ihrem Grund vordrang. Das war in etwa so, als würde man einen für dieses Vorhaben eigentlich viel zu großen Ball in einen flexiblen Schlauch zwängen wollen, dennoch verlief es einigermaßen problemlos, was zum Teil wohl auch an der ungeheuren Menge öliger Flüssigkeiten lag, die in ihr zusammengelaufen waren. Obwohl das meiste an Samen, den die erste Wächterin in ihrer Scheide abgelassen hatte, bereits wieder herausgeflossen war, war er zu zäh und es war viel zu viel gewesen, als dass nicht einiges davon in ihr gestockt wäre. Heiß und klebrig überzog er ihre Scheide noch immer von innen wie Sirup, der in einen Trichter geträufelt worden war; zusammen mit dem Penis wurde es immer weiter den Schacht von Emilias Schlitz hinaufgeschoben, wurde von ihm verdrängt und rann in glibberigen Tümpeln zwischen ihren Labien hervor.
Als Emilia den Ständer schließlich ganz in sich aufgenommen hatte und sie rittlings auf dem Becken der Wächterin saß, mit den Knien am Boden und ihren Schritt fest auf dem der zu ihr aufblickenden Dämonin, schwamm sie bereits förmlich in einer Pfütze des aus ihr austretenden Spermas, aber das beirrte sie nicht in der weiteren Verfolgung ihres Plans. Sie beugte sich vor, bis sie mit den Lippen an den Ansatz des Schwanzes stieß, den sie gerade lutschte, und da das nicht reichte, drückte sie zusätzlich ihren Rücken durch, um so ihren Hintern auszustrecken. Dann griff sie mit beiden Händen, die sie ja nun nicht mehr benötigte, um sich abzustützen, hinter sich, packte ihre Pobacken und spreizte sie, sodass das Loch zwischen ihnen freigelegt wurde, der winzige, rosig schimmernde Zugang zu ihrem Rektum.
Das war natürlich ein unwiderstehliches Angebot, und dementsprechend groß war das Gedränge, das nun unter der Meute von Dämoninnen, die sich hier um Emilia versammelt hatte, losbrach. Keine von ihnen wollte sich die Gelegenheit entgehen lassen, es mit diesem jungen hübschen Mädchen zu treiben, besonders da sie ihnen gerade eine weitere ihrer Körperöffnungen dazu bereithielt. Emilia selbst bekam davon allerdings kaum etwas mit. Da sie nach wie vor damit beschäftigt war, der Wächterin vor sich einen zu blasen, konnte sie sich nicht umdrehen, und so hörte sie nur das schnelle Getrappel von sich nähernden Schritten und leises Rempeln, begleitet von unterdrückten Verwünschungen, aber diese Geräusche hielten nur für die Dauer eines Wimpernschlags an. Wer auch immer da das Rennen für sich entschieden hatte, war offenbar ebenso rabiat wie zur Eile angehalten. Noch bevor Emilia sich wirklich darauf hätte vorbereiten können, spürte sie auch schon eine leicht feuchte Eichel, die sich in die Spalte zwischen ihren Hinterbacken schob. Dort benötigte die Wächterin zwar einen kurzen Augenblick, um sich in die richtige Position zu bringen, doch sobald sie mit der Spitze ihres Schwanzes Emilias Anus erst einmal ausgemacht hatte, war sie nicht mehr zu halten. Ohne auch nur im Mindesten zu zögern stieß sie sofort zu, wobei sie sich nicht weiter darum kümmerte, dass das nur sehr schwerfällig vonstatten ging und es nur mit äußerster Kraftanstrengung zu bewerkstelligen war. Sie schien das gewöhnt zu sein und drückte sich behutsam aber dennoch unnachgiebig tiefer in Emilias Darm.
Für Emilia hingegen war das etwas ganz und gar Neues. Obwohl es für sie mit ihrem biegsamen Penis kein Problem dargestellt hätte, hatte sie ihn sich nie in den After eingeführt, wenn sie ihre doch sehr spezielle Art der Masturbation eingesetzt hatte und einmal ganz abgesehen davon hatte sie es ja nicht einmal mit einem Finger oder etwas Ähnlichem versucht, nachdem Maria ihr offenbart hatte, wie sehr sie das anmachte. Dabei war es nicht einmal so, dass sie dem unbedingt abgeneigt gewesen wäre, sie hatte nur eben nie besonders darüber nachgedacht. Zwar war sie allgemeinen grundsätzlich neugierig und interessiert an allem, was irgendwie abseitig war, aber sie war wohl einfach zu unbedarft gewesen, um so etwas überhaupt in Betracht zu ziehen. Im Nachhinein konnte sie sich ohnehin nur schwer vorstellen, wie sie das hätte tun sollen, ohne dabei vor Scham einen Herzinfarkt zu erleiden. Immerhin war es ihr schon peinlich genug gewesen, ihr eigenes Teil in ihren Mund oder ihre Scheide einzulassen. Dann hatte sie immer mit brennenden Wangen und wild klopfendem Herzen dagelegen, während sich in ihrem Bauch eine seltsame Mischung aus Schuld und Lust ausbreitete, dass sie ihre Triebe auf so verquere Weise an sich selbst auslebte, da war gar nicht auszudenken, was sie erst durchmachen musste, hätte sie ihn sich auch noch in den Arsch gesteckt.
Natürlich hatte sie später, nachdem sie Mitglied des Freak-Clubs geworden war, ohne dem je explizit zugestimmt zu haben – sie konnte selbst nicht so genau sagen, wie das passiert war, sie war eben zufällig mit dort hineingerutscht und einfach hängengeblieben –, und sich in dessen so offener, libertärer Gesellschaft frei und akzeptiert gefühlt hatte, nach und nach sämtliche ihrer Freundinnen auch von hinten bestiegen, aber trotzdem hatte keine von ihnen je Anstalten gezeigt, das Gleiche bei ihr zu versuchen. Sie wusste also, wie es war, ihren Penis im After eines Mädchens zu versenken, sie wusste nur nicht, wie es war, wenn es jemand anderes bei ihr tat. Erst jetzt, als sie den Entschluss gefasst hatte, in dieser obskuren Verwicklung, in der sie zum Spielzeug dieser Kompanie an Wächterinnen geworden war, alles nachzuholen, was Maria erlebt hatte, sollte es dazu kommen, und ehrlich gesagt konnte sie es kaum noch erwarten. So wie Maria ihr vorgeschwärmt hatte, wie aufregend es doch sei, wenn alle ihre Löcher in Benutzung waren, war sie nun begierig herauszufinden, wie sich das wohl anfühlte.
Wie gebannt hielt sie still, während sie genau verfolgte, was nun geschah. Langsam drang die Eichel in ihr Arschloch ein, weitete es immer mehr auf, bis endlich auch der breite Rand hindurchpasste, kämpfte sich noch tiefer hinein, sodass der Schaft ebenfalls durch den engen Ring ihres Schließmuskels gezwängt wurde, an ihm entlangschrubbte und sich so unaufhaltsam in ihr Rektum bohrte. Das war ein in höchstem Maße seltsames Gefühl, aber nicht wirklich unangenehm, wie Emilia feststellte, allerdings unterschied es sich deutlich von dem in ihrer Scheide. Zwar spürte sie, wie der unregelmäßig geformte Penis ihre Darmwand auseinanderdrückte, doch blieb das eher vage und nicht so klar umrissen wie in ihrem Geschlecht. Auch die Empfindung des Ausgefülltseins war nur diffus wahrzunehmen. Ihr kam es mehr so vor, als hätte ihr jemand einen Luftballon in den Hintern gepresst statt eines harten Ständers. Offensichtlich war die Sensorik in dieser Körperöffnung nicht so ausgeprägt wie in anderen.
Wenn sie es sich genauer überlegte, konnte das aber auch damit zusammenhängen, dass all das von den weitaus mächtigeren Sinneseindrücken überschattet wurde, die ihr gespreizter Anus ihr vermittelte. Der war ohne Zweifel überaus empfindlich und wurde hier zudem stark beansprucht. So aufgeweitet wie er war, stand er unter ziemlicher Spannung, sodass er sich unendlich straff um das fremde Objekt in seiner Mitte zog. Dort tat sich alles ganz deutlich hervor, die Beschaffenheit des Schwanzes, seine Unebenheiten, seine Wärme und die seidene Weichheit seiner Haut, die die darunter liegende Härte umhüllte, all das machte sich hier ebenso eindrücklich bemerkbar wie die etwas befremdliche konstante Dehnung ihres Afters oder die schwergängige Reibung, mit der die Stange in sie fuhr.
Insbesondere der letzte Punkt war etwas, das unwillkürlich Emilias Aufmerksamkeit auf sich zog. Es kam ihr so vor, als würde das dichte Band ihres Hintereingangs an dem eindringenden Körperteil haften bleiben und sich nur widerwillig wieder Stück für Stück von ihm lösen, sodass er zusammen mit ihm tiefer in die Mulde des Pos herabgezogen wurde. Selbstverständlich war das Unsinn, ihr Schließmuskel rührte sich nicht von der Stelle, sondern blieb eben nur immer für kurze Augenblicke an dem vorbeiziehenden Penis hängen, aber die Illusion blieb bestehen, und obwohl das möglicherweise ein wenig verschroben war, weckte gerade das Merkwürdige, das Unbekannte an dieser Situation eine flammende Leidenschaft in ihr. Während dieses Rohr sich gegen jeden Widerstand in ihren analen Tunnel quetschte, bildete sich ein Kribbeln in Emilias Bauch, das sich nach und nach ausbreitete. Es war aber nicht nur Erregung alleine, die das in ihr auslöste, es war auch der Reiz des Neuen, die Aufregung etwas zum ersten Mal zu tun, von dem sie zwar nicht genau wusste, was sie dabei erwartete, das jedoch voller Verheißung von unbändiger Lust war.
Irgendwann hatte die Wächterin es endlich geschafft, die ganze beeindruckende Länge ihres Schwanzes in ihr unterzubringen, was Emilia erst einmal dazu veranlasste, wohlig aufzustöhnen. Damit hatte sie es vollbracht, nun war jedes ihrer Löcher von einem Ständer belegt; einer steckte in ihrem Mund, einer in ihrer Scheide und einer in ihrem Arsch, genau so wie Maria es immer wollte, wenn sie sich mal wieder mit sämtlichen Mitgliedern des Freak-Clubs gleichzeitig vergnügte, und so nutzte Emilia diese Gelegenheit, um bis ins kleinste Detail zu analysieren, wie sich das anfühlte. Schließlich konnte Marias Begeisterung für diese Praktik nicht nur daher rühren, dass sie dabei im Mittelpunkt des Begehrens der Hälfte ihrer Klassenkameradinnen stand – denn dass dies ihre Art war, sich die Bestätigung zu holen, nach der sich jeder Mensch insgeheim sehnte, stand völlig außer Frage –, das hätte sie auch haben können, wenn sie es nacheinander mit ihnen getrieben hätte, und um Belange der Effizienz ging es ihr da wohl kaum.
Nein, es musste noch mehr daran sein, was sie so sehr verzauberte, und selbst jetzt schon, als die drei Penisse in ihr sich noch gar nicht bewegten, verstand Emilia allmählich, was das war. Wohin sie sich auch wandte, von allen Seiten strömten die unübersehbaren Eigenarten sowie die Präsenz von primären männlichen Fortpflanzungsorganen auf sie ein, und das machte sie mehr an, als sie je für möglich gehalten hätte. Emilia stand eben einfach nicht auf Jungs; soweit es sie betraf, waren das alles nur unreife egozentrische Angeber, die ihre Ignoranz hinter oberflächlichen Fassade emotionaler Kälte zu verstecken versuchten, dennoch musste sie zugeben, dass sie das, was sie zwischen ihren Beinen hatten, im Gegensatz zu ihrem übrigen Aussehen ungemein anziehend fand. Das konnte natürlich auch schlicht daran liegen, dass so ein steifes Rohr einfach ein unverkennbares Symbol der Intimität war, die hier herrschte, und schon deshalb erotisch wirkten, aber Emilia bezweifelte, dass es nur das war.
Während der Entstehung des Clubs hatte sie schnell herausgefunden, dass es nicht von der Hand zu weisen war, wie sehr sie von den Schwänzen ihrer Freundinnen angetan war, und wie viel Spaß es machte, an ihnen herumzuspielen, sie in den Mund zu nehmen oder sie nur zu betrachten. Wie sie vor Sehnsucht zuckten, wie sich ihre Vorhaut verschieben ließ und wie in dickflüssigen Tropfen der Vorsamen aus den Löchern an ihrer Spitze austrat, jede dieser Einzelheiten strahlte eine Faszination aus, der sie sich nicht entziehen konnte, und gemessen an diesen Vorgaben befand sie sich nun wohl im Paradies, einem himmlischen Garten der Lüste, in dem sich jede Menge wunderschöner Hermaphroditen tummelten, und ihr auffordernd ihre geschwollenen Ständer hinhielten. Die Luft war bereits schwer von ihrem süßlichen Geruch, ihr charakteristischer Geschmack entfaltete sich auf Emilias Zunge, sie spürte die von ihnen ausgehende Hitze an den Stellen ihres Körpers, an denen sie sich an ihr rieben, ebenso wie die Feuchtigkeit des Präejakulats, das sie dabei auf ihr verschmierten, aber neben all dem waren ja auch noch drei davon, so weit es irgend ging, in sie eingelassen worden, und das war sicherlich der mit Abstand erhabenste Punkt in dieser Liste.
Obwohl sie keine Ahnung hatte, wie es war, wenn ihr Hintern allein in Beschlag genommen wurde, war zu vermuten, dass die Tatsache, dass nun ihre Scheide und ihr Rektum gleichermaßen aufgezwängt wurden, dieses Gefühl noch intensivierte, jedenfalls war Emilia sich ohne jeden Zweifel bewusst, dass das zumindest auf ihren Schlitz zutraf. Der Schwanz in ihrem Arsch blähte zwangsläufig ihren Darm auf, sodass er gegen den Kanal ihrer Weiblichkeit drückte, und ihn auf diese Weise verengte. So konnte sie den Penis dort sehr viel genauer in sich wahrnehmen als sonst, und dasselbe galt umgekehrt wohl auch für den in ihrem Anus. Zwar hatte Emilia bisher noch keine Blick auf ihn werfen können – geschweige denn auf das Gesicht dessen Besitzerin –, trotzdem konnte sie nur anhand der Art, wie er sich in ihr ausnahm, auf seine Form und Ausmaße schließen. Dadurch, wie stark ihr After aufgeweitet wurde, konnte sie etwa seinen Durchmesser abschätzen, die Länge erkannte sie daran, wie tief er in sie ragte, und auch wenn das Innere ihres Rektums, wie sie bemerkt hatte, nicht besonders sensitiv war, ließ sich leicht ausmachen, dass er ein wenig nach oben gebogen war, eine ausladende Eichel besaß, aber ansonsten keine auffälligen Alleinstellungsmerkmale aufwies.
Für die Wächterin mit der offensichtlichen Analfixierung schien es ähnlich überwältigend zu sein wie für Emilia. Als sie nun so reglos in ihr verharrte, war ein leises Stöhnen von ihr zu hören, fast schon das wohlige Wimmern eines Hundes, der seinen Samen in einem läufigen Weibchen entleerte, und unverkennbar konnte Emilia ihren Schwanz in sich zucken fühlen. Sie ging also ebenfalls ganz darin auf, wie sich der Anus fest und unbeugsam wie eine Manschette um den Ansatz ihres Ständers zog, doch darüber hinaus war ihr damit ohne Frage anzumerken, dass dieser langwierige und mühsame Prozess, ihre gesamte Länge in dieses winzige Loche hineinzubekommen, sie bereits zu einem guten Teil verausgabt hatte. Möglicherweise diente diese Pause also nicht nur dazu, den schwelgerischen Augenblick voll auszukosten, sondern war schlicht nötig, weil sie sonst schon abgespritzt hätte, bevor sie überhaupt richtig angefangen hatte.
Doch welchen Anlass es nun auch gab, die Wächterin hatte sich jedenfalls bald wieder im Griff. Sie holte einmal tief Luft, ließ sie hörbar wieder entweichen und von da an kannte sie kein Halten mehr. In einer schnellen flüssigen Bewegung zog sie sich ein Stück aus Emilia zurück, ließ ihre Hüfte aber sofort wieder vorspringen und ging so nahtlos dazu über, Emilias bis zu diesem Zeitpunkt unberührten Hintern hart und in rascher Geschwindigkeit durchzuvögeln. Dabei brauchte sie nicht erst ihren eigenen Rhythmus zu finden, vom ersten Augenblick an schob sie ihren Schwanz gleichmäßig und ohne große Umstände in Emilias Rektum hin und her, so kontrolliert und präzise, dass es fast mechanisch wirkte. Breitbeinig kniete sie hinter Emilia, still und effizient, ohne auch nur einen unnützen Muskel zu rühren, während ihr Becken unablässig vor und zurück schwang wie das schwere übergroße Pendel einer Standuhr.
Vielleicht war diese Wächterin ein besonders disziplinorientierter Charakter – eine Vermutung, die bei ihrer Profession durchaus nahe lag –, dass sie entgegen all ihres Verlangens noch so gefasst blieb, und dass sich in ihr eine ganze Menge Säfte angestaut hatten, die nun ohne auch nur die geringste Verzögerung zu erdulden darauf pochten, endlich abfließen zu dürfen, war kaum zu übersehen. Dafür sprach nicht nur die Hast, mit der sie Emilias Hintereingang bearbeitete, sondern vor allem auch die Kraft, die sie dabei aufwandte. Sie warf sich so ungestüm nach vorn, dass Emilia die Erschütterung wie die sich ausbreitenden seismischen Wellen bei einem Erdbeben durch ihren Körper rasen spürte. Jeder einzelne der beständig auf sie einprasselnden Aufschläge war sogar heftig genug, um sie ein wenig vorwärts zu schubsen. Auf diese Weise brauchte sie sich nicht einmal selbst zu bewegen, die Wächterin hinter ihr übernahm diese Aufgabe ganz für sie. Immer wenn deren Becken mit einem Klatschen gegen ihr Gesäß prallte, wurde Emilias vorgebeugter Oberkörper weggedrückt, sodass der Penis in ihrem Mund tiefer in sie drang, der in ihrer Scheide jedoch etwas hervorrutschte, und wenn die Wächterin sich aus ihr zurückzog, sank Emilia nach unten, der Penis in ihrem Mund fuhr heraus und der in ihrer Scheide steckte wieder zur Gänze in ihr.
Diese automatisch fortlaufende Prozedur, so unaufhaltsam wie das Ticken eines Uhrwerks, hatte etwas unendlich Erotisches an sich, das aber weit über das bloße Körperliche hinausging. Natürlich war es auch auf physischer Ebene erregend, wie drei Schwänze auf einmal in sie stießen, während unzählige weitere sich überall an ihr rieben, doch was sie wirklich vor Lust erbeben ließ, war von eher abstrakter Natur. Dazu muss man sagen, dass für Emilia schon immer die Freiheit die größtmögliche Bedeutung in ihrem Leben einnahm; das ging sogar so weit, dass sie es vermied, irgendwelche Bindungen einzugehen. Sie wollte einfach weitestgehend unabhängig bleiben, sie wollte keine Hilfe in Anspruch nehmen müssen, wenn es nicht zwingend erforderlich war, sie brauchte kein Lob von Lehrern oder anderen Autoritätspersonen und sie wollte auch keine flüchtigen Bekanntschaften pflegen, die nur daraus bestanden, ab und zu ein paar Plattitüden auszutauschen. Wenn sie sich schon die Mühe machte, eine soziale Beziehung aufrecht zu erhalten, musste sie schon von tiefgreifenden Gemeinsamkeiten und aufrichtiger Zuneigung geprägt sein, weshalb sie kaum etwas mit anderen zu tun hatte, abgesehen von den Mitgliedern des Freak-Clubs und Maria.
Nun gut, das lag zu einem gewissen Teil auch daran, dass sie seit jeher die Stille der Einsamkeit gegenüber einer geistlosen Unterhaltung bevorzugte, und sie sich aufgrund ihrer Erfahrungen mit den Sticheleien ihrer Klassenkameraden immer weiter abschottete, jedenfalls konnte sie deshalb nicht offen auf andere zugehen. Bevor sie jemanden nicht bis in sein innerstes Wesen kannte und beschlossen hatte, dass diese Person ihres uneingeschränkten Vertrauens würdig war, begegnete Emilia ihr auf eine recht unterkühlte Art. Sie wollte als würdevoll wahrgenommen werden, und so bewahrte sie stets eine gleichmütige Ruhe, als gingen sie die profanen Probleme dieser Welt überhaupt nichts an.
Das bedeutete zudem, das es ihr schwer fiel, die Kontrolle abzugeben. Ordnung hielt sie für unabdingbar, sie sortierte sogar ihre Unterwäsche nach Schnitt – sie hätte sie zusätzlich auch nach Farbe sortiert, doch erübrigte sich das bedingt durch ihren bevorzugten Stil – und konnte es nicht ausstehen, wenn etwas nicht ganz genau so lief, wie sie es sich vorstellte. Also machte sie am liebsten alles von vorneherein selbst, sei es nun das Aufräumen ihres Zimmers oder das Abheften ihrer Hausaufgaben, immerhin wusste sie am besten, wie sie es haben wollte, und vielleicht war das insgeheim mitverantwortlich dafür, dass die anderen Mitglieder bei ihren Clubtreffen sich nie getraut hatten, sich auch einmal mit Emilias unteren Körperöffnungen zu befassen. Sie war eben von einer solchen Aura der Autonomie und der Erhabenheit umgeben, dass nur schwer zu glauben war, sie könnte sich dazu herablassen, es gleich mit einer ganzen Horde von Dämoninnen treiben. Von daher war es erstaunlich, wie schnell es doch genau dazu gekommen war. Ihre letzte Versammlung war gerade einmal zwei Stunden her, in der sie ihnen noch ihre etwas eigenwillige Form der Masturbation vorgeführt hatte, und nun war sie hier, auf dem Boden einer Trainingshalle und hatte nicht nur wie üblich ihren Mund, sondern auch noch zum ersten Mal ihre Scheide und ihren Arsch einer breiten Öffentlichkeit zu deren Belustigung freigegeben. Dass es hier anders war, war jedoch nur zu verständlich. Ihre Freundinnen hatten sie immer als eine der ihren betrachtet, als ihnen gleichgestellt, jetzt aber war sie nur eine Heranwachsende inmitten dieser Schar voll ausgebildeter Wächterinnen, die durch ihren Korpsgeist miteinander verbunden waren und es gewohnt waren, die sogenannten Zivilistinnen zum Wohle ihrer Königin einzuschüchtern, um deren Befehlsgewalt über sie ausüben zu können.
Doch dem allen entgegen merkte Emilia nun, dass es in bestimmten Situationen äußerst reizvoll sein konnte, ihre eher dominante Veranlagung für eine Weile zu vergessen und sich ganz dem Lauf der Geschehnisse hinzugeben. Plötzlich war sie vollständig Bedingungen unterworfen, die sie nicht beeinflussen konnte, aber was normalerweise ihr schlimmster Alptraum gewesen wäre, war nun seltsam anziehend. Paradoxerweise hatte es sogar etwas fundamental Befreiendes an sich, Leidenschaft in dem zu finden, was sie sonst immer unter allen Umständen zu verhindern versucht hatte, nämlich dem Verlust von auch nur dem kleinsten bisschen Selbstbestimmung. Natürlich würde diese Entdeckung nicht grundlegend ihre Persönlichkeit verändern, sie würde auch weiterhin im Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchen, alle Eventualitäten vorherzusehen und die Abläufe der Ereignisse genauestens zu planen. Das hier war für sie mehr eine Singularität, eine kleine, in sich geschlossene Abweichung ihrer gewohnten Lebensrealität, aber sie nahm sich vor, zumindest hin und wieder einmal etwas spontaner zu sein und es zu akzeptieren, wenn nicht alles lief wie erwartet.
So sehr sie ihre Routine und das Tröstliche des Vertrauten auch brauchte, manchmal war Berechenbarkeit schlicht langweilig und dann brachte ein wenig Chaos die dringend benötigte Aufregung mit sich. Wobei Emilia eigentlich noch nie so etwas wie Ordnung beim Sex erlebt hatte. Wenn der Club eines seiner extravaganteren Treffen abhielt, ging von Anfang an alles drunter und drüber, dann stolperten die Mädchen schon einmal blind umher, in dem Versuch schnell aus ihren Höschen zu steigen, Kleidungsstücke flogen unbeachtet durch die Gegend und allerorten tropfte Vorsamen, vergossenes Sperma und Scheidensekret auf den Boden, doch selbst wenn Emilia ausnahmsweise nicht nur bloße Teilnehmerin einer Orgie war, sondern einfach nur mit Maria, ihrer festen Freundin, schlief, war das ein ziemliches Durcheinander aus Küssen, Umarmungen und impulsiven Berührungen.
Doch so desorganisiert sämtliche ihrer bisherigen Erfahrungen auch gewesen waren, das alles war nichts im Vergleich zu dem Tumult, in dem sie sich jetzt befand. Emilia wurde noch immer ohne eigenen Antrieb nur durch den Aufprall des Beckens der Wächterin gegen ihren Hintern rückhaltlos hin und her geworfen, in einem Augenblick bohrte sich der Schwanz in ihrem Mund bis zum Anschlag in sie, im nächsten der in ihrer Scheide, während der dritte unaufhörlich auf ihr Arschloch einhämmerte. Das war bereits erratisch genug, so wirbelte ihr langes, weiß glänzendes Haar wie sich bauschende Seide um ihren Kopf, das Wenige, was sie an Brustumfang vorzuweisen hatte, wackelte spürbar umher und auch ihr Kleid rutschte an ihrem Körper auf und ab, sodass der weich fließende Stoff sanft über ihre Haut strich, doch neben dem allem warteten ja noch zahllose andere Dämoninnen darauf, sich mit ihr zu vergnügen, die in ihrer Ungeduld angefangen hatten, jede noch so unscheinbare Gelegenheit wahrzunehmen, Emilias Bereitwilligkeit ihnen gegenüber in irgendeiner Weise für sich zu nutzen. Hände fuhren an ihr entlang, an ihrem Bauch, ihrer Brust oder ihren Hinterbacken, Penisse wurden an ihr gerieben und Unmengen der verschiedensten Körperflüssigkeiten liefen in Rinnsalen überall dort an ihr herab, wo sie mit ihnen beschmiert worden war.
Selbst die zu Beginn so gefasste Wächterin, die sich Emilias Hinterteil bemächtigt hatte, verlor mit der Zeit immer mehr ihre stoische Ruhe. Zwar bleiben ihre Stöße so regelmäßig und unausgesetzt wie zuvor, trotzdem konnte Emilia ohne jeden Zweifel erkennen, dass es ihr sehr bald kommen würde. Sie hatte schwer zu keuchen angefangen und drückte sich nun mit einem solchen Verlangen in ihren Anus, dass es ihr schon so vorkam, als würde sie von einem wilden Stier gefickt. Es fühlte sich sogar ein bisschen so an, als würde der ohnehin schon dicke Ständer der Dämonin in ihrem Rektum noch weiter anwachsen, aber Emilia war sich nicht sicher, ob das nicht nur bloße Einbildung war. Vielleicht war es eher ihr Schließmuskel, der durch diese ungewohnte Behandlung angeschwollen war, er schien jedenfalls empfindlicher und auch breiter als sonst zu sein, mehr wie ein starkes Tau, statt wie im Normalzustand wie eine gummiähnliche Schnur. Das war jedoch gar nicht unangenehm, vielmehr konnte sie so alles noch viel deutlicher spüren, wie der massige Schwanz in sie hinein und wieder hinaus geschoben wurde, wie er ihren Darm ausfüllte und wie er an ihrem After vorbeischrubbte.
Überhaupt ließ sich die Wächterin nun so enthemmt in ihr gehen, dass es Emilia schwer fiel, sich noch aufrecht zu halten. Auf dem scheinbar jüngsten Mitglied dieser Mannschaft unter ihr hockend, den Oberkörper nach vorne gebeugt und den Rücken durchgedrückt, um den Kopf oben zu behalten, damit sie es auch noch einer dritten Dämonin mit dem Mund machen konnte, war es trotz der Tatsache, dass sie sich mit den Händen am Boden abstützte, gar nicht so einfach, das Gleichgewicht zu bewahren, vor allem nicht wenn sich ihr jemand mit aller Macht von hinten entgegenwarf. Bei der Wucht, mit der sie hier vor und zurück geschleudert wurde, konnte sie jedenfalls unmöglich die Lippen noch länger um den Penis geschlossen halten, an dem sie gerade saugte. Das war gar keine bewusste Entscheidung, es passierte einfach. Unter der Wirkung der Bemühungen mit dem die Wächterin hinter ihr sich ihren Arsch vornahm, und dem Druck, den die in ihren Mund gelaufenen Flüssigkeiten verursachten, öffnete er sich ganz von allein.
So dringend wie die Wächterin, der sie einen blies, es offensichtlich nötig hatte, das sich in stauende Sperma zu entlassen, waren ihr bereits unzählige Lusttropfen entwichen, die zusammengenommen bestimmt ausgereicht hätten, ihren Mund völlig zu überschwemmen, doch daneben hatten ja noch immer Überbleibsel der vorigen Ladungen in ihr geklebt, bevor die jetzige Dämonin diesen Platz eingenommen hatte, und da Emilia unter den erschwerten Bedingungen, die sich ihr mit dem unaufhörlichen Eindonnern auf ihr Gesäß boten, nicht schlucken konnte, war zudem mehr und mehr Speichel in sie geflossen. Es hatte sich also einiges in ihr angesammelt, das ihr nun wie ein unendlich langsamer dickflüssiger Schwall über die Lippen trat, in langen zähen Fäden von ihnen herabfiel und schließlich mit einem hörbaren Platschen mitten ins Gesicht der jungen Wächterin unter ihr landete.
Doch diese schien das nicht einmal zu bemerken. Ihre Augen waren geschlossen, der Mund zu einem lautlosen Stöhnen verzogen und ihre Wangen glühten in einem leuchtenden Rot. Als Emilia das sah, war ihr sofort klar, dass sie kurz davor war, zu kommen, und noch während dieser Gedanke in ihrem Kopf Gestalt annahm, ging auch schon ein merkliches Beben durch den Körper der Dämonin. Ruckartig hob sich ihr Becken dem von Emilia entgegen und im selben Augenblick schoss das Sperma aus ihr hervor. Wie zuvor, als sie in Emilias Mund gespritzt hatte, war es ein langer dicker Strahl, der da plötzlich ihr Inneres flutete, dann kurz abebbte und so Welle um Welle tief in sie hineinschwappte. Sie spürte, wie sich die heiße sämige Flüssigkeit in ihr verteilte, ihr gesamtes Geschlecht mit seiner sirupartigen Konsistenz überzog und wie es träge daran herablief.
Der erste Orgasmus der jugendlichen Dämonin hatte sie schnell und heftig erwischt, und obwohl dieser zweite Erguss nun mit ebenso viel Hochdruck aus ihr hervorgebrochen war, hatte er sie diesmal doch sichtlich erschöpft. Reglos blieb sie unter Emilia liegen, die Augen weiterhin geschlossen, während sie erst einmal versuchte, wieder zu Atem zu kommen. Andererseits konnte sie sonst wohl auch nirgendwo hin, so lange Emilia rittlings auf ihr saß, eine zweite Wächterin zu ihren Schultern stand, die sich einen ablutschen ließ, eine dritte das Mädchen auf ihr zügellos in in den Arsch fickte und überall um sie herum sich noch zahlreiche andere tummelten, die ungeduldig warteten, bis sie endlich an der Reihe waren.
Ihr Schwanz musst dabei eigentlich weiter stimuliert werden, so ungehalten wie Emilia an ihrem Schritt auf und ab rutschte, aber das schien keinen Unterschied mehr zu machen. Stück für Stück schrumpfte er in sich zusammen, als er allmählich erschlaffte. Die ausladende, komplett runde Eichel wurde kleiner und sank immer weiter hinab ihrem Scheideneingang entgegen, gleichzeitig wurde ihr Schaft immer weicher, bis er irgendwann völlig schlapp war. Es war ein wenig merkwürdig, ihn dennoch weiter in sich zu behalten. Er war ganz klein und schwammig geworden, und nachdem ihr ohnehin von den eigenen Säften durchnässter Schlitz auch noch mit dem Samen von nunmehr zwei Wächterinnen angefüllt war, die sich darin erleichtert hatten, fühlte es sich fast an, als würde er in ihr schwimmen wie eine Kaulquappe in einem modrigen Tümpel. Jedoch schwand der Pegel dieses Gewässers stetig, wenn auch höchstens in einem ganz unbedeutenden Maßstab, denn winzige Tröpfchen Spermas traten kitzelnd zwischen ihren Schamlippen hervor, was Emilia unwillkürlich vor Lust erzittern ließ.
So glitschig, wie er von den ihn umgebenden Flüssigkeiten geworden war, dauerte es aber gar nicht lange, bis der wabbelige Penis endgültig aus ihr hervorflutschte. Damit hätte der Samen frei aus ihr herausströmen können, doch verhinderte seine hohe Viskosität, dass es wie aus einer offenen Leitung aus ihrer Spalte hervorplatzte. Stattdessen rann zuerst nur eine feine dünne Linie heraus, die eher farblos war, bevor ihr auch die mehr glibberigen, milchig aussehenden Teile dieser heterogenen Masse in großen zusammenhängenden Klumpen folgte. Das alles floss natürlich hinab auf den Unterkörper der noch immer still unter ihr liegenden Wächterin, und da ihre Kameradin sich nach wie vor mit vollem persönlichen Einsatz bemühte, es Emilia von hinten zu besorgen, wurde es dort großflächig verschmiert.
Das wirkte im Grund wie Öl, es machte den Schoß der Wächterin so rutschig wie eine glatt polierte Eisbahn. Emilia schlitterte nun förmlich an deren Intimbereich entlang, wo ihr schlaffer Penis flach auflag, was sich schnell als überraschend reizvoll herausstellte. Er hatte sich genau gerade ausgerichtet, sodass seine Unterseite längs zwischen ihren Schamlippen steckte, und durch die von der Begierde der hinter ihr knienden Wächterin verursachten Bewegungen ihrer eigenen Hüfte fuhr sie an ihm auf und ab. Auf diese Weise trieb sie es gewissermaßen weiter mit der jungen Wächterin, selbst wenn sich keines ihrer Körperteile wirklich in ihr befand, und das war seltsamerweise noch herrlicher als konventioneller Sex – falls man diese Ereignisse hier, bei denen einer Meute vollkommen anonymer Wächterinnen erlaubt hatte, nach eigenem Willen ihre Bedürfnisse an ihr zu befriedigen, denn als konventionellen Sex bezeichnen wollte, aber das war bis jetzt immerhin die einzige Erfahrung, die sie dahingehend gemacht hatte, dass jemand anderes seinen Steifen in ihr vergrub.
Sie vermutete, dass das an der Ganzheitlichkeit dieser Situation lag. Während ihr fortlaufend ein großer Schwanz in den Hintern geschoben wurde und ihr Mund so gleichermaßen einem weiteren entgegengedrückt wurde, klemmte ein dritter wie eine weiche aufgequollene Teigrolle zwischen ihren leicht gespreizten Labien. Sie fühlte noch immer die Wärme seines Samens in ihr, ebenso wie er nach und nach aus ihr hervorsickerte und ihrer beider Scham benetzte, als er dort beständig umhergewischt wurde, vor allem aber fühlte sie die eindrückliche Präsenz des Penis an sich, auf dem sie gerade herumritt. Immer wieder glitt sie an seinem schlappen Schaft entlang, wobei er sanft ihre Scheide streichelte, ihre äußeren Schamlippen teilte und sich an ihrem Inneren rieb.
Doch das war gar nicht das Aufregendste an dieser Sache. Die vornübergebeugte Position, die sie eingenommen hatte, um einer der Wächterinnen einen zu blasen und einer anderen mit ihrem ausgestreckten Po ungehinderten Zugang zu ihrem Anus zu gewähren, bedeutete auch, dass ihr Kitzler mit einbezogen wurde. Bei jedem Stoß, mit dem ihr Hintern bedacht wurde, streifte er an dem von Körpersäften völlig bedeckten Schwanz hinauf und hinunter und sandte dabei Wellen seiner Ekstase durch Emilia, die von Mal zu mal stärker wurden. Nachdem sie heute bereits drei Höhepunkte erlebt hatte, hatte sie eigentlich nicht gedacht, dass es möglich wäre, an diesem Tag noch einmal eine Latte zu bekommen, doch genau das war jetzt der Fall. Mit neu entfachter Leidenschaft begann ihr Penis sich auf dem Bauch der Wächterin wieder zu regen, während er zusehends größer und dicker wurde.
Der auf dem Boden liegenden Dämonin erging es da offenbar nicht anders. Deutlich konnte Emilia spüren, wie deren an ihren Schlitz gepresster Schwanz ebenfalls zuckte und wieder anzuschwellen begann, doch noch ehe er nennenswert an Umfang zunehmen konnte, verlor die Wächterin, die Emilias Hinterseite beackerte, die Kontrolle. Laut stöhnte sie auf und rammte ihren Ständer ein letztes Mal bis zum Anschlag in das ihr zugestandene Loch, als die erste gewaltige Woge an Sperma aus ihr hervorbrandete. Für diesen Moment schienen sich sämtliche ihrer Muskeln zu verkrampfen, und dementsprechend erstarrte sie in genau dieser Haltung, die Hände auf Emilias unteren Rücken gelegt, die Kuhle ihres Beckens nahtlos dicht an der Rundung ihres Hinterns und ihr hartes Rohr so weit wie nur irgend möglich in ihr Rektum eingebettet, während sich Schub um Schub der Samen aus ihr ergoss.
So füllte sich Emilias Rektum immer weiter; die heiße Gischt spülte in ihren Kanal wie Meerwasser in eine Höhlung am Strand, schwappte wieder zurück und waberte dann bei jedem neuen Spritzer wild darin umher e ein silberner See bei stürmischem Wetter. Die samtene Flüssigkeit schmiegte sich in jede noch so kleine Falte ihres Darms, während sie immer tiefer dort hineinströmte. Das war natürlich ungewohnt. Es war schon kurios genug gewesen, einen Penis in die Körperöffnung eingeführt zu bekommen, doch jetzt mit einer solch unmenschlich riesigen, schleimigen Ladung vollgepumpt zu werden, übertraf das noch bei weitem. Fast kam es Emilia vor, als würde dieser sonst so enge Tunnel aufgedehnt wie ein Ballon, den man an einen voll aufgedrehten Wasserhahn hielt, bis er beinahe platzte, dennoch war es ihr keinesfalls zuwider. Vielmehr erzeugte es in ihrem Bauch diese wohlige Leichtigkeit, wenn man etwas tat, das zwar den Nimbus des Verruchten um sich trug, aber eben auch unendlich viel Spaß machte.
Für sie schien es eine kleine Ewigkeit anzudauern, dass die Wächterin sich fest an ihren Po klammerte und dabei ihr Sperma in sie sprudeln ließ, doch nach einer Weile verebbte der reißende Bach an Ejakulat zu einem schwindenden Gerinnsel und schließlich zu einem vereinzelten schwachen Tröpfeln. Zuletzt quoll nur noch eine winzige Perle der dicklichen weißen Sahne aus dem Loch an der Eichel, und das nahm die Dämonin offenbar zum Zeichen, dass sie Emilias Hilfsbereitschaft zur Gänze ausgereizt hatte. Langsam zog sie sich aus ihr zurück, kam aber nur wenige Millimeter weit, bevor sie sich mit einer erschöpften wehmütigen Bewegung noch einmal tief zwischen Emilias Hinterbacken drückte. Damit schien ihre Kraft allerdings vollständig aufgebraucht. Noch immer schwer atmend von ihrem berauschenden Orgasmus machte sie sich daran, ihren Penis aus Emilia heraus zu bekommen. Das gestaltete sich jedoch schwieriger als erwartet. Ihre Erektion war mittlerweile ziemlich abgeflaut, und der sie umschließende After hielt sie so fest in sich, dass es einiges an Aufwand benötigte, um sie endlich voneinander zu lösen. Doch zum Glück trieften sie beide vor fettigen Sekreten, und so dauerte es nicht lange, bis die Eichel doch noch mit einem deutlich hörbaren, nassen Geräusch aus seinem Gefängnis ausbrach.
Als die Wächterin wie benommen aufstand und zurück in die Menge taumelte, kroch auch ihre Kameradin unter Emilia hervor. Das tat sie mit offensichtlichem Widerwillen, was Emilia nur zu gut nachvollziehen konnte, immerhin hatte sie bemerkt, dass die junge Wächterin gerade erst wieder eine Latte bekam, aber es hätte wohl verständlicherweise wenig Aussicht auf Erfolg bestanden, den umstehenden Dämoninnen klar machen zu wollen, dass sie unbedingt noch eine dritte Runde brauchte, bevor eine von ihnen zum Zug kommen sollte. Alleine der Versuch hätte wahrscheinlich bloß zu einem Aufstand mittleren Ausmaßes geführt, also fügte sie sich und räumte ihren Platz in Emilias Scheide für die Nächste.
Emilia blieb währenddessen so hocken, wie sie war, auf allen Vieren kniend, den Hintern erhoben und ihr Gesicht im Schritt der Unbekannten vergraben, die gerade an der Reihe war, von ihr einen geblasen zu bekommen. Sie schmeckte deren Vorsamen auf ihrer Zunge, und obwohl sich ihr Anus wieder auf seine ursprüngliche Größe zusammengezogen hatte, stahl sich eine Schliere Sperma daraus hervor, lief ihren Damm hinab und vermischte sich mit den Säften aus ihrer Scheide, die von den vorigen Wächterinnen dort hinterlassen worden waren.
Doch natürlich blieben ihre nun freistehenden Löcher in einem solch begierigen Umfeld nicht lange leer. Mit der üblichen Hektik kroch bereits eine Dämonin unter sie und platzierte die Spitze ihres harten Ständers unmittelbar an ihrer Spalte. Das kam Emilias wiedererweckten Lust nur zu gute, und so ließ sie langsam ihr Becken hinab, bis sie fest auf dem Schritt der Wächterin saß. Kaum war das geschehen, spürte sie auch schon, wie ein dritter Penis feucht gegen ihre Kehrseite stieß. Wie wohl auch alle anderen in diesem Raum war er bereits über und über mit Vorsamen besudelt und beschmierte sie so noch mehr mit dem Zeug als sie ohnehin schon war, während er zu ihrer Gesäßfalte herübergezogen wurde. Dort angekommen lehnte die Wächterin sich ein wenig vor, sodass ihre Eichel zwischen Emilias Pobacken drang und sich sanft auf ihren After legte. In dieser Haltung verharrte sie dann jedoch erst einmal und bewegte ihr steifes Rohr mit einer Hand auf und ab. Im ersten Moment dachte Emilia, dass sollte dazu dienen, sie noch heißer zu machen, aber als sich immer mehr Nässe an dieser Stelle ausbreitete, erkannte sie die wahre Absicht dahinter. Die Dämonin nutzte das aus ihrem Hintern entwichene Sperma, um damit sowohl ihren Penis als auch das Loch, in das er eingelassen werden sollte, so gut wie möglich mit dem öligen Sekret einzuseifen. Immer wieder strich so die Schwanzspitze über ihren offengelegten Hintereingang hinweg, tauchte in die Spermapfütze, die ihre Vorgängerin da hinterlassen hatte, und verteilte die klebrige Soße überall.
Nach einiger Zeit schien die Dämonin zufrieden mit ihrem Werk zu sein. Als die Eichel bei ihrem beständigen Auf und Ab irgendwann wieder auf dem Anus zu liegen kam, ließ sie ihre Hüfte unvermittelt vorschnellen, was Emilia ebenso wie die Wächterin laut aufkeuchen ließ. Obwohl der große Schwanz ihren Mund komplett ausfüllte und sie so nur gedämpft zu hören war, klang Emilia unüberhörbar erschrocken, dennoch musste sie zugeben, dass die Vorbereitungen der Dämonin ihren Zweck absolut erfüllten. Sie hatte jetzt nicht so zu kämpfen, in die enge Öffnung hineinzukommen wie die Dämonin vorher; ein einziger kräftiger Ruck genügte, und schon überwand sie das Hindernis des Schließmuskels, glitt problemlos hindurch und schob sich bis zum Ansatz in Emilias Rektum.
Diese Mühelosigkeit setzte sich auch fort, als die Wächterin sich nun in ihr zu bewegen begann. Dabei schwang sie ihr Becken mit ähnlich viel Wucht Emilia entgegen wie ihre Kameradin und das sogar mit deutlich höherer Geschwindigkeit, trotzdem wurde sie jetzt nicht so durchgeschüttelt. Da ihr mit dem glitschigen Samen getränkter Hintern dem eindringenden Rohr schlicht weniger Widerstand bot, konnte er ungehindert in ihr ein und aus fahren. Das führte dazu, dass sie immer noch von den Stößen der Dämonin in ihren Arsch vorwärts gedrückt wurde und wieder zurück sank, wenn sie sich von ihr entfernte, allerdings erheblich sachter als zuvor. So stemmten sich noch immer abwechselnd die Schwänze tief in sie, einmal der in ihrer Scheide und dann plötzlich die in ihrem Mund und in ihrem Darm., doch diesmal konnte sie dabei ohne Schwierigkeiten das Gleichgewicht halten.
Diesen Umstand nahm sie zum Anlass, sich mit neuer Hingabe ihrer Aufgabe zu widmen, der vor ihr stehenden Wächterin einen zu blasen. Die hatte bisher am längsten durchgehalten von allen Dämoninnen, für deren Befriedigung zu sorgen sich Emilia einverstanden erklärt hatte, obwohl sie mittlerweile einen fast stetigen Strom an Lusttropfen abgab, die sich warm und seidig auf ihre Zunge legten. Sie war also auf jeden Fall heiß darauf, mal wieder einen abgemolken zu bekommen, und Emilia war nun entschlossen, ihr diesen Gefallen zu erweisen, zumal sie deren Bedürfnisse zuletzt ja ein wenig vernachlässigt hatte, als diese Orgie hier einen so stürmischen Verlauf genommen hatte, dass sie gar nicht mehr die Lippen um ihren Penis hatte schließen können. Um für diese Ungerechtigkeit Genugtuung zu leisten, strengte sie sich an, genau das zu tun, was ihr zuvor unmöglich gewesen war: straff zog sie die Lippen um den Schaft zusammen, und saugte so fest sie konnte an der Eichel, während sie gleichzeitig mit dem Kopf nickte, in demselben Takt, in dem die beiden anderen Dämoninnen ihre unteren Körperöffnungen stopften. In der nun in ihrem Mund herrschenden Enge konnte Emilia genau fühlen, wie die Unterseite des Schwanzes über ihre Zunge hinwegstrich, wie seine Spitze sich an ihren Gaumen schmiegte und wie die breiten Adern und leichten Unregelmäßigkeiten in seiner Form gegen ihre Lippen drückten.
Diese intensive Aufmerksamkeit, die der Wächterin damit zuteil wurde, brachten sie schnell an ihre Grenzen und darüber hinaus. Emilia war gerade erst in diesem bezaubernden Einklang versunken, mit dem sie von den drei Dämoninnen durchgenommen wurde, während zahllose andere sie befingerten und sie mit ihren tropfenden Ständern streichelten, als ihr Mund auch schon buchstäblich von Sperma geflutet wurde, denn denn der Samenerguss dieser Wächterin verlief nicht ganz so wie bei den meisten ihrer Kameradinnen, die bis zu diesem Zeitpunkt in oder auf Emilia abgespritzt hatten, und das waren ja durchaus einige gewesen. Im Gegensatz zu ihnen schoss bei ihr der Saft nicht in mehreren Schüben hervor, sondern in einem einzigen mächtigen Strahl, wie Emilia es auch von Emma kannte. Es war, als hätte ihr jemand einen Gartenschlauch in den Mund gesteckt, der nur für einen kurzen Augenblick aber dafür auf höchster Stufe aufgedreht wurde. Im einen Moment war sie noch ahnungslos dabei gewesen, vehement an der Eichel zu nuckeln, und im nächsten war ihr Mund schon so übervoll mit Sperma, dass sich ihre Wangen aufgebläht hatten und ein winziger Tropfen davon sich aus ihrem Mundwinkel stahl.
Eine Weile blieb die Wächterin so stehen, breitbeinig, alle Muskeln erschlafft und atmete langsam aus, während ihr Penis zwischen Emilias Lippen wild zuckte, wobei er noch einige Schlieren seines Samens abgab. Schließlich seufzte sie zufrieden und ließ ihre Hüfte einmal auf und ab wippen, als hätte sie Emilia benutzt wie eine öffentliche Toilette und wollte nun noch den letzten hartnäckig an ihr haftenden Tropfen in ihren geduldig dargebotenen Mund abschütteln, damit er nicht ihren Slip befleckte. Dann trat sie einen Schritt nach hinten, sodass ihr Schwanz zwischen Emilias Lippen hervorflutschte, die sie schnell aufeinander pressen musste, damit die ganze schleimige Suppe nicht aus ihr herausstürzte wie aus einem Springbrunnen. Die Dämonin war inzwischen schon dabei, ihre Hose wieder hochzuziehen und sich aus dem Mittelpunkt des Gedränges, das sich um das angebliche Dienstmädchen gebildet hatte, einen Weg nach außen zu bahnen, während Emilia zurück blieb, den Mund voller Sperma und umringt von einer Truppe Wächterinnen, die darauf brannten, ihr noch viel mehr davon einzuflößen.
Bevor es dazu kommen konnte, stand Emilia jedoch erst einmal vor der Entscheidung, ob sie schlucken sollte oder nicht. Bei den Ladungen zuvor hatte sich diese Frage kaum gestellt; da war alles Schlag auf Schlag gegangen, und sie war so in die Verkommenheit dieser Situation versunken gewesen, dass sie beinahe automatisch geschluckt hatte, ohne auch nur darüber nachzudenken. Jetzt hingegen war es anders, jetzt hatte sie die nötige Zeit und den Abstand, sich zu überlegen, was sie mit dem Samen in ihrem Mund anfangen sollte. Sie war nicht unbedingt darauf versessen, es zu schlucken, obwohl es durchaus seinen Reiz hatte, nur hatte sie mittlerweile so viel dieser heißen Sahne von den verschiedenen Wächterinnen getrunken, dass sie schon glaubte, es in ihrem Bauch hin und her schwappen zu spüren, als sie von den Bewegungen der Dämoninnen, die es ihr in den Hintern und die Scheide besorgten, umherschwankte, aber wenn sie es einfach aus ihrem Mund hätte hinausfließen lassen, hätte sie es der Wächterin unter sich förmlich ins Gesicht gespuckt, und das erschien ihr dann doch etwas ungehörig.
Somit blieb ihr letzten Endes wohl kaum eine Wahl. Schluck für Schluck begann sie dir riesige Ladung ihre Kehle hinabfließen zu lassen, wobei sie jedoch nur langsam vorankam. Die dickliche Flüssigkeit war einfach zu zäh, als dass sie leicht hinunter zu bekommen wäre, und nach jedem noch so winzigen bisschen, das sie bewältigt hatte, musste sie innehalten, um Luft zu holen und das Brennen des salzigen bitteren Geschmacks abklingen zu lassen. Der zog sich wie eine Linie flammenden Öls ihren Hals hinab, so eindringlich wie ein plötzliches Geräusch in der Stille der Nacht, und wurde jedes Mal von neuem entfacht, wenn sie einen weiteren Schluck nahm. Nach und nach kam es ihr so vor, als könnte sie diesen seltsamen unvergleichlichen Geschmack überall an sich wahrnehmen; er explodierte geradezu in ihrem Mund, folgte ihrer Speiseröhre bis hinab in ihren Bauch, er schien aber sogar noch in ihre Brust abzustrahlen und sie wie eine feuchte Wolke einzuhüllen. Selbst nachdem sie es geschafft hatte, und den letzten Rest Samen getrunken hatte, verschwand dieser Eindruck nicht, noch immer glaubte sie, von seiner schwere und seinem Aroma umfangen zu sein.
Diese Angelegenheit, das Sperma der Wächterin zu schlürfen wie eine Tasse heißen Tee, hatte sie völlig für sich vereinnahmt, wie Emilia auf einmal klar wurde. Als würde sie aus einem tranceähnlichen Zustand erwachen, fiel ihr auf, dass sie die übrige Welt komplett ausgeblendet hatte und fand sich nun in ihrer ursprünglichen Situation wieder. Die beiden Dämoninnen fickten sie weiterhin mit unverminderter Anstrengung in ihren Arsch und ihre Scheide, während die lange Schlange an Wartenden sie befummelte oder ihre vor Vorsamen triefenden Penisse an ihr rieb. Neu war nur, dass ein paar von ihnen sich vor ihr versammelt hatten, die respektvoll Abstand hielten und offenbar gebannt verfolgt hatten, wie sie das in ihrem Mund abgeladene Sperma mühsam geschluckt hatte. Dieses Schauspiel hatte ihnen ganz ohne Zweifel gefallen; sämtliche ihrer Schwänze waren steinhart und zitterten bereits vor Erregung. Als sie bemerkten, dass Emilia sie unverwandt anblickte, drängelten sie sich alle gleichzeitig eilig vor und präsentierten ihr stolz und Aufmerksamkeit heischend wie auf einem Basar, was sie zu bieten hatten. Innerhalb kürzester Zeit war Emilia umringt von nässenden, sich aufbäumenden Ständern, die ihr nachgerade ins Gesicht gestreckt wurden, und von denen sie sich einen aussuchen konnte, den sie lutschen wollte.
Doch bevor sie das tat, wollte sie auf jeden Fall noch eine weitere Sache ausprobieren. Sie nutzte die Gelegenheit, dass ihr Mund ausnahmsweise weder von Penissen noch von Sperma angefüllt war, um sich umzudrehen und über die Schulter hinweg den Trupp an Wächterinnen hinter sich zu fixieren, die onanierend dastanden, bereit jederzeit einzuspringen, sobald ein Platz für sie frei wurde – und jetzt war Emilia im Begriff, diesen Wunsch für eine von ihnen wahr werden zu lassen. Mit einer Hand griff sie hinter sich, packte eine ihrer Pobacken und zog sie zur Seite, damit ihre Zuschauerinnen eine gute Sicht auf beide ihrer noch immer besetzten Löcher hatten, dann warf sie einen auffordernden Blick in die Runde und sagte, ohne jemand Bestimmtes anzusprechen: »Was meint ihr? Da passt doch noch einer rein, oder?«
Das sahen einige der Dämoninnen offenbar recht ähnlich, auch wenn sie doch etwas Zweifel in ihren Mienen stehen hatten. Sie setzten sich eher zögerlich in Bewegung, nur eine von ihnen schien in dieser Hinsicht absolut überzeugt zu sein. In rekordverdächtiger Geschwindigkeit überholte sie alle ihrer Konkurrentinnen, die ihr möglicherweise diesen Platz streitig machen konnten, und rannte auf Emilia zu. Auch bei ihr angelangt verlor sie keine Zeit. Noch während sie fast über den Boden schlitternd zum Stehen kam, ging sie bereits in die Knie und positionierte sich schräg hinter Emilias freigiebig dargebotenem Hintern, da er selbst ja noch immer von ihrer Kameradin in Beschlag genommen wurde. Erst dann, als sie sicher sein konnte, dass niemand ihr dieses einmalige Angebot vor der Nase wegschnappen würde, erlaubte sie sich einen Moment des Überlegens. Nachdenklich betrachtete sie Emilias Unterkörper, in dem schon zwei Schwänze steckten, und ging wohl in Gedanken ihre Optionen durch, wie sie da noch einen dritten unterbringen konnte. Letztendlich dauerte es aber gar nicht lange, bis sie zu einem Ergebnis gekommen war. Mit neugewonnener Entschlossenheit nahm sie ihren Schaft zwischen Daumen und Zeigefinger und setzte ihn an Emilias Scheide an. Dabei war ihr natürlich zuerst ihre Kameradin etwas im Weg, die dabei war, Emilia von hinten zu beglücken, aber die rückte kurzerhand ein wenig zur Seite, sodass sie nun zu zweit dort knieten.
Damit war für die neue Wächterin alles bereit, um bei dem Spaß mitzumachen. Sie umklammerte ihren Ständer fester und schob ihre Hüfte langsam vorwärts. Die Spitze ihrer Eichel lag genau zwischen Emilias Schamlippen und der Latte ihrer Kollegin. Mit viel Kraft schaffte sie es, das oberste Stückchen in diese Lücke hinein zu zwängen, doch als sie sich bis zum breiten Rand ihrer Eichel vorangekämpft hatte, hielt sie kurz inne. Zum einen hatte sie Angst, dem Mädchen wehzutun und hielt es für eine gute Idee, sie sich erst einmal daran gewöhnen zu lassen, aber zum anderen brauchte sie selbst ebenfalls eine gewisse Verschnaufpause. Sie hatte schon zuvor an ähnlichen Orgien teilgenommen, aber noch nie zuvor war es dabei so sehr ausgeartet, dass eines der Dienstmädchen darum bat, einen zweiten Schwanz in dasselbe Loch gerammt zu bekommen. Sie war sich selbst nicht ganz sicher, wie das überhaupt gehen sollte, doch als es zu dieser unerwarteten Offerte gekommen war, hatte sie mehr aus reinem Reflex gehandelt. Sie war einfach zu geil gewesen, als dass sie noch klar hätte denken können, und war blind losgestürmt, um als Erste diese Chance ergreifen zu können. Jedenfalls hatte sie noch nie etwas derartig Enges erlebt. Es war beinahe schmerzhaft, wie ihre Eichel zusammengequetscht wurde, und sich das Rohr der anderen Dämonin hart an ihr eigenes drückte. Dennoch fühlte es sich zugegebenermaßen auch unglaublich gut an, außerdem war es der ausdrückliche Wunsch dieses Mädchens, und in diesem Fall war sie nur zu gerne bereit, ihr behilflich zu sein. Also biss sie sich leicht auf die Unterlippe, holte einmal tief Luft und strengte sich an, so gut wie möglich weiter einzudringen.
In Emilia tobte derweil dieselbe Mischung widerstreitender Gefühle. Auch für sie war es ein ganz merkwürdiges Zusammenspiel von Lust, Schmerz und Scham, das ihr bisher völlig neu war, und das trotz aller ungewohnter und teilweise sogar unangenehmer Beiwirkungen einfach zu aufregend war, um jetzt damit aufzuhören. Immer weiter wurden ihre Schamlippen gedehnt, als sich dieser zweite Penis vorsichtig in sie schob, bis sie allmählich befürchtete, es würde sie zerreißen. Doch zum Glück hielt diese Sorge nur für den Bruchteil einer Sekunde an, denn unter Aufbietung aller Verbissenheit schaffte die Wächterin es endlich, ihre dicke Eichel in Emilias engen Kanal zu drücken. Da die Wächterin sich so unnachgiebig gegen ihr Hinterteil gestemmt hatte, um diesen Widerstand zu überwinden, glitt ihr Schwanz nun automatisch bis zur Hälfte in sie hinein, ehe sie ihn aufhalten konnte, und damit war der schwierige Teil überstanden. Die Anspannung verflog und Erleichterung durchströmte Emilia. Zischend atmete sie aus, als hätte das Einführen dieses neuen Knüppels in sie alle Luft aus ihren Lungen verdrängt. Allerdings hieß das nicht, dass damit die seltsam erregende Empfindung übermäßiger Belastung völlig verschwunden wäre. Noch nie zuvor war sie so ausgefüllt gewesen; ihre Scheide wurde von den beiden Ständern auseinander gezerrt als wäre sie eine Socke, die über zwei Füße gleichzeitig gestülpt wurde, und zog sich unendlich straff um deren Schäfte, während ein dritter ihren After aufweitete. Insgesamt betrachtet fühlte sie sich, als wäre ihr ganzer Unterkörper mit Knetmasse ausgestopft worden, die sämtlichen verfügbaren Platz in ihr einnahm und sich überall in ihr ausbreitete.
Doch wie sich herausstellte, war das noch gar nichts im Vergleich dazu, was sie nun erwartete, als die Wächterinnen begannen, sich in ihr zu bewegen, obwohl sie dabei zutiefst bedächtig vorgingen. Der Dämonin, die unter ihr lag, blieb natürlich nichts anderes übrig, als weiterhin still dazuliegen, weshalb nur die zwei anderen ihrem Trieb freien Lauf lassen konnten. Da sie beide etwas seitlich versetzt hinter Emilia hocken mussten, konnten sie nicht im selben Augenblick in sie vordrängen, sondern mussten sich ein wenig arrangieren. Also stießen sie immer abwechselnd in sie, mal wurden zwei Penisse mit ihrer vollen Länge in ihren Schlitz gezwungen, während ihr Anus nur noch von einer Eichel verschlossen wurde, und mal wurde einer der Schwänze in ihrer Scheide weit hinaus gezogen, aber dafür wurde ihr Arsch entsprechend eingenommen. Das taten sie wie die Wächterin, die sich zuerst Emilias Hinterteil gewidmet hatte, äußerst organisiert und präzise. Sie warteten jedes Mal geduldig, bis die jeweils andere sich vollständig zurückgezogen hatte, bevor sie selbst wieder ihr Becken vorschoben.
Auf diese Weise gelangte zwar keine von beiden so tief wie sie gekommen wären, wenn sie einzeln angetreten wären, aber das bemerkte Emilia nicht einmal. Die Wächterin, die unter ihr lag, steckte immerhin bis zum Anschlag in ihr und war so in ihrer ganzen Länge zu spüren, doch das war eher unbeträchtlich bei diesem Sturm an Gefühlen, der über Emilia hereinbrach. Was sie hingegen wirklich anmachte, war der Umfang, mit dem die zwei Schwänze das Innere ihrer Scheide spreizten. Die Spalte so aufgedrückt zu bekommen, genau bis an die Grenze ihres Fassungsvermögens, war eine verquere, aber nichtsdestoweniger erstaunlich berauschende Erfahrung. Emilia erinnerte das ein wenig an einen Muskelkrampf, der allmählich nachließ. Ihr Schritt fühlte sich wie geschwollen an, kribbelte aber auch als stünde sie kurz vor einem Orgasmus. Sie nahm alles einfach viel intensiver wahr; das Reiben der zwei Schwänze an ihrer Scheidenwand, als sie unentwegt in sie fuhren, die breite Eichel, die sich merklich von ihnen abhob, und an ihr entlangstrich oder die Adern, die über ihre Labien streiften, das alles stach mit einer solchen Klarheit in ihr Bewusstsein, dass ein unablässiges Schaudern sich nahender Ekstase ihren Körper durchströmte.
Doch bevor ein weiterer Orgasmus sie erneut ablenken würde, beschloss sie, sich zunächst wieder auf ihre eigentliche Aufgabe zu konzentrieren. Um sie herum stand noch immer ein Pulk von Dämoninnen verteilt, die ihr begehrlich ihre zuckenden, von Wollusttropfen verklebten Schwänze vors Gesicht hielten, und sie wollte gerade einen von ihnen in den Mund nehmen, als sie dieser Gedanke, noch eine vierte Wächterin in sie eindringen zu lassen, auf eine neue Idee brachte. Noch einmal drehte sie den Kopf zu der gierig zusehenden Menge hinter ihr und sagte: »Noch einer.«
Ihre Stimme war rau, kaum mehr als ein kehliges Krächzen, aber sie wurde offenbar trotzdem verstanden, und nachdem die andere Wächterin ihren Ständer in Emilias bereits besetzte Scheide gequetscht hatte, war wohl nicht schwer zu erraten, was ihr nun vorschwebte. Wieder hörte sie vereinzelt zweifelndes Gemurmel, doch diesmal fanden sich schon mehrere Freiwillige für dieses Experiment. Einige der versammelten Wächterinnen lösten sich aus der Gruppe und hasteten eilig auf Emilia zu. Die, die das spontane Rennen für sich entscheiden konnte, hielt sich auch gar nicht lange damit auf, sich zu fragen, wie sie die Sache angehen sollte. Ihre Kameradin hatte ihr immerhin vorgemacht, was zu tun war, und so kniete sie sich einfach auf der entgegengesetzten Seite von ihr neben die Dämonin, die sich bereits daran gemacht hatte, Emilias zierlichen Hintern durchzunehmen, und setzte ihre spitz zulaufende Eichel ebenfalls an diesem Loch an.
Doch ab da war es nicht mehr ganz so leicht. Auch für diese Wächterin stellte es eine gravierende Herausforderung dar, einen zweiten Penis in die ihr offerierte Körperöffnung einzuführen, aber es war ihr anzusehen, dass sie bereit war, sich bis zur völligen Erschöpfung zu verausgaben, um dieses Ziel zu erreichen, und tatsächlich machte sie erstaunlich schnell Fortschritt. Nachdem schon die erste Dämonin einige Schwierigkeiten hatte, diesen außerordentlich engen Zugang für sich zu nutzen, war Emilia schon überrascht, dass sich ihr Vorhaben überhaupt umsetzen ließ. Als sie dazu aufgefordert hatte, war sie einfach nur einer plötzlichen Eingebung gefolgt, ohne sich Gedanken über die Durchführbarkeit oder irgendwelche Implikationen zu machen, seien sie nun moralischer oder physischer Natur, doch hier hockte sie nun, zwei Schwänze in ihrer Scheide und einen dritten in ihrem Arsch, während sich ein vierter zusätzlich immer tiefer in ihr Rektum bohrte.
Noch bevor dieser Neuzugang auch nur zur Hälfte seinen Weg in sie gefunden hatte, erkannte Emilia, dass sie damit endgültig alles an Kapazität aus sich herausgeholt hatte, was sie in sich hatte. Jetzt hätte nicht einmal ein Bindfaden mehr in sie hineingepasst, geschweige denn ein weiterer Penis. Zwei in ihrem Geschlecht und zwei in ihrem Anus, das war offenbar das absolute Maximum. Das war zwar nicht unbedingt der Sinn dieses Abenteuers, aber sie fand es trotzdem auf eine seltsame Art befriedigend zu erfahren, wo genau ihre Grenzen lagen, und dass sie gerade mit baumelnden Zehen daran entlangtaumelte, stand außer Frage. Schon jetzt hatte sich ihre Atmung in ein beinahe hysterisches Hecheln verwandelt und immer wieder entfuhren ihr wimmernde Laute, im Grunde klang sie also wie eine läufige Hündin, die von einem riesigen Männchen mit seinem Knoten nur allzu wild bestiegen wurde, als ihr After nun schier endlos aufgeweitet wurde und der Ständer der vierten Wächterin langsam aber unaufhaltsam immer tiefer in sie vorrückte.
Das ging nur äußerst schwerfällig vonstatten, und Emilia musste sich auf die Lippen beißen, um bei dem stechenden Schmerz nicht wenigstens laut aufzukeuchen, aber dennoch musste sie zugeben, dass es trotz all dieser Widrigkeiten ziemlich glatt lief, und sie wusste auch, woran das lag. Der erste Samenerguss, der ihr in den Darm gespritzt worden war, hatte ihn mit Sperma förmlich geflutet, und als sich direkt danach die nächste Dämonin über ihren Hintern hergemacht hatte, war die schmierige Flüssigkeit hinausgelangt und überall gleichmäßig verteilt worden. Mittlerweile war sowohl ihr After als auch der Penis der anderen Wächterin vollständig mit dem Schleim überzogen und erleichterte so das Eintauchen dieser zweiten Latte.
Dessen ungeachtet blieb das ein Unterfangen, das viel Ausdauer erforderte, doch die neu hinzugekommene Wächterin ließ sich in ihrer Zielstrebigkeit von nichts abbringen. Unbeirrbar drückte sie sich immer weiter vorwärts, und diese Beharrlichkeit zahlte sich bald aus. Letzten Endes schaffte sie es, ihren dicken Schwanz so tief wie unter den gegebenen Umständen möglich in schmalen Schacht zu quetschen, und damit war es vollbracht, nun steckten vier Penisse gleichzeitig in Emilia. Doch genau genommen war das je erst der Anfang. Obwohl es ihr vorkam, schon einiges geleistet zu haben, , so wie ihre beiden Löcher unter Spannung standen und eigentlich jeder einzelne Muskel in ihr sich verkrampft hatte, stand ihr die größte Sensation noch bevor.
Die begann, als die Wächterinnen sich nun allmählich in ihr bewegten. Zunächst gingen sie genau so behutsam und koordiniert zu Werke wie zuvor. Jede von ihnen hielt sich zurück und wartete, bis sie an der Reihe war, bevor sie ihr Becken Emilias Hintern entgegendrückten, doch diese gegenseitige Rücksichtnahme war unweigerlich zum Scheitern verurteilt. Es war einfach schwer, bei so vielen Teilnehmern einer Orgie, die sich alle die ihnen zur Verfügung gestellte Körperöffnung noch mit jemandem teilen mussten, einen gemeinsamen Rhythmus zu finden, besonders wenn die sich wie in einer Spirale steigernde Geilheit einem die Sinne raubte, und so gerieten sie schnell aus dem Takt. Im ersten Augenblick waren es nur winzige Abweichungen der Geschwindigkeiten voneinander, doch wie bei einer Maschine, bei der ein Zahnrad ein Ungleichgewicht bekommen hatte, nahm diese Divergenz immer mehr zu, bis es schließlich vollkommen drunter und drüber ging. Emilia überraschte das keineswegs, für sie zeichnete sich darin sogar eine Allegorie auf Themen der Soziologie ab. Solange man nur einen kleinen intimen Kreis bildete, war es kein Problem, Allgemeingut zu erhalten, doch je mehr sich daran beteiligten, desto mehr zog jeder nur noch seinen eigenen Nutzen daraus. Das war im Limbus offenbar nicht anders als unter Menschen, aber warum sollte es das auch sein? Das Gesetz der Entropie besaß immerhin einen Anspruch auf Universalgültigkeit, und auch wenn es nicht darauf ausgelegt war, hatte sie dennoch immer die Meinung vertreten, dass es sich ebenso gut auf gesellschaftliche Strukturen anwenden ließ.
Die Wächterinnen gaben sich nun jedenfalls alle Mühe – natürlich ohne sich dessen bewusst zu sein –, diese Hypothese zu bestätigen. Sie hatten es mittlerweile aufgegeben, zumindest noch den Anschein von Solidarität aufrecht zu halten und gaben sich nur noch dem Erfüllen der eigenen Lust hin. Vielleicht befürchteten sie, dass ihre Bedürfnisse zu kurz kamen, wenn sie sich nicht rigoros durchsetzten, und so rammelten sie wild durcheinander, wobei sie alle ihre ganz eigenen Vorlieben bedienten. Die eine, die sich Emilias Hintern vorgenommen hatte, tat das voller Genuss, langsam und ausladend, als wäre sie bestrebt, jeden einzelnen Moment davon umfassend auszukosten, während ijre Kameradin in demselben Tunnel nur ganz fahrig ihre Hüfte vor und zurück rucken ließ, so rasch und kräftig, dass sie bestimmt nicht lange durchhalten würde. Sogar die Wächterin, die unter ihr lag, konnte nun nicht länger still bleiben. Unablässig hob sich ihr Gesäß vom Boden, als sie nach oben stieß, um ihren sich nach Erlösung sehnenden Ständer irgendwie mit mehr Reibung zu stimulieren.
Dabei prallte ihr Schritt selbstverständlich jedes Mal gegen den von Emilia, und diese unerwartete Kollision brachte sie aus der Balance, sodass ihr Oberkörper ein Stück nach vorn sackte. Zwar konnte sie sich noch rechtzeitig mit den Händen am Boden abstützen, doch nicht bevor sie mit den ihr noch immer erwartungsvoll hingehaltenen Penissen der sie umringenden Dämoninnen zusammentraf. Einige streiften sie nur an der Schulter oder zerfurchten ihr das Haar, ein paar rutschten an ihrer Wange ab, aber einer erwischte sie genau am Mundwinkel und blieb warm und feucht dort liegen. Das erinnerte Emilia wieder daran, dass sie noch eine ganze Menge Schwänze abzumelken hatte und sich nicht wenige davon genau hier vor ihr versammelt hatten, um von ihr einen geblasen zu bekommen. Nun, diesem Wunsch war ohne den geringsten Aufwand nachzukommen; sie öffnete bloß den Mund und alles andere ging wie von selbst. Mit einem Mal flutschte das von Vorsamen glitschig gewordene Teil in sie hinein und erfüllte sie mit seinem süßlichen, leicht abgestandenen Geschmack. Er fühlte sich geradezu heiß auf ihrer Zunge an, und sie konnte spüren, wie die Flüssigkeit, mit der er überzogen war, ihre Lippen benetzte.
So verharrte Emilia erst einmal, das gummiartige Rohr, aus dem stetig noch mehr seines Sekrets hervortropfte, nur reglos in sich haltend, während sie überlegte, was sie nun tun sollte. Ihr Halt war auch so schon unsicher genug, wenn sie jetzt noch angefangen hätte, mit dem Kopf zu nicken, um wie gewohnt an dem Schwanz in ihrem Mund zu lutschen, hätte sie unweigerlich das Gleichgewicht verloren. Die unter ihr liegende Wächterin bäumte sich mittlerweile so stark auf, dass Emilia sich auf ihr vorkam wie eine Reiterin, die versuchte ein Wildpferd zu zähmen, gleichzeitig waren ihre Anstrengungen, sie von unten zu ficken, zu unbeholfen und zu unregelmäßig, als dass sie denselben Effekt gehabt hätten wie vorher, als die Stöße der Dämonin, die zuerst ihren Hintereingang benutzt hatte, so wuchtig und dennoch so präzise waren, dass ihr Oberkörper genau auf die richtige Weise vor und zurück geschwungen war, und sie so automatisch noch einer anderen einen geblasen hatte. Jetzt war es ja nicht so, dass es einen Mangel an sexuell ausgehungerten Wächterinnen gegeben hätte, die bereits eifrig dabei waren, es ihr von hinten zu besorgen, doch von ihnen konnte sich in dem Gedränge, das an Emilias Kehrseite herrschte, keine fest genug an sie pressen, damit sie ebenso vorgeworfen wurde.
Zum Glück jedoch erkannte die Wächterin, deren Penis sie im Mund hatte, ihr Dilemma und ergriff von sich aus die Initiative. Langsam und rücksichtsvoll, um Emilia weder zu verschrecken, noch ihr Unannehmlichkeiten zu bereiten, machte sie mit der Hüfte kleine Fickbewegungen in ihren Mund hinein. Das klappte überraschend gut. Ohne Schwierigkeiten fuhr der Schwanz zwischen Emilias Lippen ein und aus, strich über ihre Zunge hinweg und fügte sich mit seiner weichen Eichel nahtlos an ihren Gaumen. Dass das so problemlos ablief hing auch damit zusammen, dass die Wächterin nicht übermäßig bestückt war. Zwar war ihr Gehänge auch nicht unbedingt klein, aber doch bestenfalls unterer Durchschnitt. So konnte sie nicht ihre gesamte Länge in Emilias Mund unterbringen, aber doch zumindest den größten Teil. Zudem machte sie ihre Sache ausgesprochen behände. Als wäre es für sie nichts Besonderes, den Mund eines minderjährigen Mädchens auf dieselbe Weise durchzunehmen als wäre es ihr Geschlecht, während deren übrige Löcher von einer Horde weiterer außer Kontrolle geratener Dämoninnen gestopft wurden, ließ sie ihr Becken einfach ruhig vor und zurück wandern, so weit dass der Rand ihrer Eichel mal von innen gegen die Lippen des Mädchens stieß, wenn sie sich von ihr entfernte, und mal die Spitze ihres Ständers sich bis an ihren Rachen drückte, wenn sie sich ihr wieder näherte.
Das ergab einen mitreißenden Sog, dem Emilia sich nur zu gerne ergab. Er war sogar so verlockend, dass sie für ein paar Sekunden den Gedanken erwog, mit einer Geste noch einer zweiten Wächterin zu bedeuten, ihr den Penis in den Mund zu stecken, damit auch wirklich ausnahmslos jede ihrer Körperöffnungen doppelt belegt war, allerdings verwarf sie ihn praktisch sofort wieder. Schon so war es nicht gerade leicht, sich auf der unter ihr bockenden Wächterin zu halten, ohne dass ihr der Schwanz zwischen den Lippen herausgeflutscht wäre. Aber diese Beschränkung hatte nicht nur Nachteile. Nun konnte sie wenigstens alle Aufmerksamkeit, die nicht dafür gebraucht wurde, das Gleichgewicht zu wahren, dem Stab in ihrem Mund zukommen lassen. Sie zog die Lippen um ihn stramm und saugte so fest an ihm, wie sie nur konnte, während sie zugleich seine Unterseite leckte. Diese Entscheidung wusste die Wächterin offenbar zu schätzen, wie Emilia mit einem Blick zu ihr hinauf feststellte. Ihr Gesicht war vor Erregung verzerrt; die Augen hatte sie geschlossen, ihr Mund war leicht geöffnet und die Wangen waren gerötet.
Damit blieb Emilia gar nichts weiter zu tun. Sie brauchte sich nur auf Händen und Knien zu halten, während die fünf Wächterinnen stoisch und ohne sich um die anderen zu kümmern, ihre Löcher bearbeiteten. So konnte sie sich ganz fallen lassen und sich in ihren Gefühlen verlieren, die sie mittlerweile ohnehin fast zu überwältigen drohten. Die Schar an Dämoninnen, die sie von hinten bestürmten, schienen jetzt jeden noch verbliebenen Funken Selbstbeherrschung verloren zu haben. Emilia kam sich vor, als wäre sie von einem Rudel wilder Wölfe angefallen worden, das sich nun ganz ungezügelt über sie hermachte. Sie hörte alle fünf von ihnen irgendwelche Laute der Lust von sich geben, die durchaus etwas Animalisches an sich hatten, und zusammen bildeten sie eine Kakophonie aus Stöhnen, Hecheln, Ächzen und wohligem Seufzen. Sogar die übrigen Wächterinnen, die sie belagerten und die Zeit, bis sie an der Reihe waren, damit verbrachten zu onanieren oder sie zu betatschen, mischten sich darunter, wenn auch sehr viel leiser. Von ihnen kam in den meisten Fällen nur ein schweres Atmen und ein verhaltenes Zischen, wenn sie im letzten Moment innehielten, bevor es sich schon aus ihnen ergossen hätte, ohne dass sie die ihnen angebotene Hilfeleistung vollständig in Anspruch nehmen konnten, vereinzelt waren aber auch anfeuernde Rufe zu vernehmen sowie das sehnsuchtsvolle Keuchen einiger Dämoninnen, die das angespannte Warten kaum noch länger aushielten.
Es dauerte eine Weile, bis Emilia bemerkte, dass sie selbst ebenfalls wieder angefangen hatte, entrückte Geräusche zu machen. Wären sie nicht von dem Schwanz in ihrem Mund gedämpft worden, wäre es wohl ein unverhohlenes konstantes Stöhnen geworden, doch so blieb es bei einem tiefem Brummen aus ihrer Brust heraus, das ihre Lippen zum Vibrieren brachte und ihr ein wenig die Luft raubte, weil es so kurz aufeinander folgte. Es war, als würde sie rennen und dabei immer nur kurz nach Luft schnappen, und sie sofort wieder pustend entweichen zu lassen, was völlig ungewohnt für sie war. Zwar hatte sie es bisher nur selten zugelassen, dass ihr eigener Penis seinen Weg in ihre Scheide fand, doch hatte sie so weit die Erfahrung gemacht, dass sich ihre Atmung unausweichlich an den Rhythmus der Stöße in sie anpasste, nur war vermutlich genau das das Problem, nun da unter ihren Liebhaberinnen endgültig das blanke Chaos ausgebrochen war.
Das lag aber nicht ausschließlich daran, dass sich jede von ihnen völlig unstrukturiert und je nach Fasson in ihr austobte, sondern vor allem daran, dass ihre Löcher jetzt doppelt belegt waren. Wenn sie ihr eigenes Ding in sich aufgenommen hatte, war es im Grunde so gewesen, als würde ein Kolben in seinen Zylinder eintauchen. Obwohl er das eher schlängelnd tat, bewegte er sich doch systematisch und eben gleichmäßig, was hier ganz und gar nicht gegeben war. Hier war es mehr wie zwei Züge, die aus entgegengesetzten Richtungen einen Tunnel passierten und dabei aneinander vorbeifuhren. Während sie also spürte, wie auf der einen Seite ihrer Spalte etwas in sie geschoben wurde, wurde auf der anderen etwas herausgezogen. Es war ein unaufhörliches Ein und Aus, das irritierenderweise auch noch gleichzeitig und in sämtlichen ihrer unteren Körperöffnungen stattfand, wann also hätte sie bei einer solchen Reizüberflutung einmal tief durchatmen sollen? Kein Wunder, dass sie wie eine schnurrende Katze klang, die sich auf einer heißen, von der Sonne beschienen Terrasse zu einer Kugel zusammengerollt hatte.
Das fühlte sich äußerst verwirrend an, gleich fünf Schwänze in sich zu haben, von denen vier sich alle unabhängig voneinander an ihrem Unterleib bedienten, während ihr noch ein weiterer zwischen die Lippen gedrückt wurde. Es widersprach einfach allen Vorstellungen, die sie sich bisher von der Welt gemacht hatte; ihre Scheidenwand meldete ihr ebenso wie ihr Anus zwei völlig gegensätzliche Empfindungen, so etwas hatte sie noch nie erlebt, und sie hätte wohl auch nie gedacht, dass es überhaupt möglich war, trotzdem war es so, und obwohl es so kontraintuitiv war, dass sie es kaum verarbeiten konnte, verdoppelte es ihre Lust sogar noch. Immerhin nahm sie nun zwei Sinneseindrücke, die für sie immer klar abzugrenzen gewesen waren, plötzlich zur gleichen Zeit wahr, allerdings konnte es natürlich auch etwas damit zu tun haben, dass sich ihr, so beständig wie ihre Zugänge hier aufgedehnt wurden, alles viel heftiger aufdrang als jemals zuvor, jedenfalls war diese ganze Sache buchstäblich überwältigend.
Das ging sogar so weit, dass es Emilia fast so vorkam, als bekäme sie einen Nervenzusammenbruch. So wie sie sonst keinen wirklichen Einfluss darauf hatte, was ihr Penis tat, verhielt es sich nun mit ihrem gesamten Körper. Ein unwillkürliches beben hatte sie erfasst, ihr Schnaufen ging immer schneller und ihr Herzschlag war wie ein unaufhörliches Donnergrollen, das direkt über einem den Himmel durchzuckte und dessen Nachhall bis in die Knochen wirkte. Das alles waren untrügliche Anzeichen eines sich anbahnenden Höhepunkts, das war ihr völlig klar, nur waren sie noch nie zuvor dermaßen aufrüttelnd gewesen. Schon jetzt wusste sie, dass dies der tiefgreifendste Orgasmus sein würde, den sie jemals gehabt hatte, was aber nur weitere Scham in ihr hervorrief. Sie liebte Maria von ganzem Herzen, der Sex mit ihr emotional auf eine Weise, die sie selbst kaum fassen konnte, und dennoch fand sie sich hier zitternd und keuchend vor Begierde wieder, konnte sich nur mit Mühe aufrecht halten, weil ihre Muskeln ihr nicht mehr gehorchen wollten, und sie war von einer Ekstase ergriffen, die ihr in diesem Ausmaß bisher fremd war, als sie sich nun umstandslos von so vielen Schwänzen durchvögeln ließ, wie gerade noch in sie hineinpassten, wobei das Absonderlichste an dieser Situation wohl zweifellos die Tatsache darstellte, dass sie keine einzige dieser Wächterinnen auch nur ansatzweise kannte.
Doch war das wirklich so schlimm? Irgendwie konnte sie sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie Maria damit betrog, obwohl sie sich doch nur deshalb auf diese Absurdität eingelassen hatte, um ihr noch näher zu sein, und sie allen Grund zu der Annahme hatte, dass sie ihr verzeihen würde, wenn sie ihr bei ihrer Rückkehr davon erzählte. Immerhin war das etwas, worauf sie selbst stand, sich von einer Mannschaft völlig Fremder bis zur Besinnungslosigkeit nageln zu lassen, sie wäre also bestimmt nicht wütend auf sie, sondern eher angeregt und würde verlangen, dass sie ihr jedes noch so kleine Detail ausmalte, trotzdem blieb ein schlechtes Gewissen. Allein dass Maria bisher nichts von dieser Entgleisung wusste, vermittelte Emilia das Gefühl, sie zu hintergehen, und die übrigen Rahmenbedingungen trugen nicht unbedingt dazu bei, ihre Scham zu lindern, aber letzten Endes konnte nichts davon verhindern, dass die Leidenschaft in ihr immer weiter aufstieg, bis sie allmählich überzukochen drohte.
Dieser Haufen an Dämoninnen, die sich in ihr ereiferten, schienen jedoch nicht allzu besorgt wegen möglicher moralischer Komplikationen zu sein. Aber warum sollten sie auch? Sie konnten nichts ahnen von Emilias ambivalenten Aufwallungen, außerdem hatte sie sich – zumindest vorgeblich – freiwillig für diese Aufgabe gemeldet und sie zuletzt förmlich dazu gedrängt, immer mehr Schwänze in sie einzuführen. Dementsprechend zufrieden waren sie jetzt mit sich selbst und der Welt im Allgemeinen. Daraus konnte man ihnen keinen Vorwurf machen; es war offensichtlich, dass es keine von ihnen noch lange ausgehalten hätte ohne diese besondere Art der Aufmunterung, und sie alle waren deutlich erkennbar erleichtert, nun zu bekommen, wonach sie sich lange vergebens gesehnt hatten. Jede trieb ihren Ständer inzwischen spürbar ungeduldiger in sie hinein, sie verwendeten mehr Druck, um trotz der Konkurrenz, die dasselbe Ziel hatte, tiefer in ihr jeweiliges Loch vorzudringen und sie waren zu einem wahrhaft atemberaubenden Tempo gelangt.
Es war also nicht zu übersehen, dass sie ebenfalls kurz davor standen zu kommen. Für einen Augenblick überlegte Emilia, ob es für die Dämoninnen genau so außergewöhnlich berauschend war wie für sie selbst und kam zu dem Ergebnis, dass wohl davon auszugehen war. Dass ihre Körperöffnungen so stark wie nie zuvor gespreizt wurden, bedeutete im Umkehrschluss ja auch, dass die Penisse in ihnen stärker zusammengepresst wurden. Sie hatten es also weitaus enger als üblich, tatsächlich konnte Emilia sogar fühlen, wie sie eingedrückt wurden, wenn sie sich in sie drängten, und dass sie dabei unweigerlich aneinanderrieben würde sie noch zusätzlich stimulieren, nahm sie an, so wie es bei ihr selbst auch war, dieses elektrisierende Gefühl, sich auf der einen Seite zurückzuziehen, während man auf der anderen tiefer glitt.
Noch in derselben Sekunde, in der ihr diese Gedanken durch den Kopf schossen, spritze die unmissverständliche Bestätigung ihrer Vermutung auch schon in sie hinein. Es war eine der beiden Wächterinnen, die einen Platz in ihrem Hintern für sich hatten ergattern können, der die scheinbar unendliche Anzahl unterschiedlicher Empfindungen auf einmal zu viel geworden waren und sich in ihr entleerte. Das geschah ohne viel Vorwarnung und überraschend unvermittelt. Sie stöhnte nur kurz und hell auf, hielt einen Moment inne und dann brach ein gewaltiger Strom heißer Flüssigkeit aus ihr hervor, der Emilias Rektum blitzschnell mit noch mehr Samen überflutete als ohnehin schon dort hineingepumpt worden war. Auch danach hielt sie sich nicht lange mit Umständlichkeiten auf. Nachdem sie nun befriedigt war, nahm sie sich bloß noch genug Zeit, ein Mal tief Luft zu holen, bevor sie ohne viel Aufhebens ihre Latte packte und sie mit einem glibschigen Geräusch herauszerrte, um die nächste ihrer Kameradinnen ranzulassen.
Die anderen, die noch immer damit beschäftigt waren, es mit Emilia zu treiben, ließen sich davon indes nicht stören. Sie fuhren währenddessen einfach fort, ihre Schwänze in ihr hinein und hinaus zu bewegen, woran sie auch weiterhin festhielten, als sich bereits eine neue Dämonin aus der hier zusammengerotteten Gruppe löste und auf die freigewordene Stelle zu hastete. Nur die Wächterin, die schon mit vollem Einsatz dabei war, Emilias Anus durchzunehmen, unterbrach ihre Bemühungen gerade lange genug, um der Hinzugekommenen das Eindringen zu erleichtern, ansonsten nahm kaum jemand Notiz von ihr, als sie die Spitze ihres Penis am After ansetzte, fest zudrückte, um den Schließmuskel zu überwinden, und damit sofort dazu überging, in derselben rasenden Geschwindigkeit wie ihre Kameradinnen ihr Becken gegen das ausgestreckte Gesäß knallen zu lassen. Da diese ganze Zeit über der Ständer der anderen Dämonin in Emilias Arschloch verblieben war, und es so versiegelt gehalten hatte, hatte das Sperma der vorigen Entladung keine Möglichkeit gehabt abzufließen, und war noch immer darin gefangen. Emilia konnte spüren, wie es zwischen den beiden Schwänzen in ihr verteilt wurde.
Von da an ging es ununterbrochen so weiter. Nach und nach kam es allen der Wächterinnen, die sich zu viert in ihrem Unterleib vergnügten, doch für jede, die gerade fertig geworden war, sprang ohne die geringste Verzögerung eine Nachfolgerin ein, sodass ihr Po und ihre Scheide stets doppelt belegt blieben. Doch auch von den Neuankömmlingen hielt keine lange durch; dafür hatten sie sich einfach schon viel zu lange mit der Rolle als tatenlose Zuschauerin zufrieden geben müssen. Es war ihnen wie eine Ewigkeit vorgekommen, in der sie beobachtet hatten, wie eine Dämonin nach der anderen über dieses hübsche junge Mädchen gestiegen war, beziehungsweise wie sie sich in wechselnden Gruppierungen wie eine Meute von umherstreifenden Tieren über sie hermachten, sie hatten das bereits ausgeschüttete Sperma und die Ausdünstungen der unzähligen bloßgelegten Geschlechtsteile gerochen, sie hatten die Geräusche gehört, mit denen die Steifen ihrer Trainingspartnerinnen in ihre Öffnungen geschoben wurden, wenn sie Glück gehabt hatten oder ausreichend Willenskraft sich durch dieses Getümmel bis zu seinem Mittelpunkt vorzukämpfen, hatten sie auch schon Gelegenheit gehabt, ihre Brüste zu befingern und nicht zuletzt hatte bis zu diesem Punkt ausnahmslos jede von ihnen schon damit begonnen, an sich selbst herumzuspielen. Bis sie endlich eine Chance bekamen, ihr Ding in irgendeiner Einhöhlung von Emilias Körper unterzubringen, waren sie bereits so geil, dass es nicht lange dauerte, bis sie vor Lust zusammenbrachen, insbesondere bei den beengten Verhältnissen, die in den ihnen offerierten Löchern mittlerweile herrschten.
Emilia wurde jetzt also am laufenden Band und von allen Seiten mit Sperma überspült, doch ergab sich dabei das gleiche Phänomen wie bei der ersten Ladung, die vorhin in ihren Hintern gelaufen war, als er noch von einem anderen Penis in Beschlag genommen worden war: das Ejakulat war einfach zu dickflüssig, um an ihm vorbei hinausrinnen zu können, bevor sich wieder ein zweiter Schwanz in sie bohrte. Demgemäß staut sich immer mehr Samen in ihr. Woge um Woge wurde es in ihr abgelassen, aber konnte danach nicht mehr entweichen. Bald kam es Emilia sogar so vor, als würde ihr Bauch anschwellen, als wäre inzwischen so viel dieser Sahne in sie geflossen, dass der Druck sie von innen heraus aufblähte. Natürlich wusste sie, dass das Unsinn war, und ein Blick an sich herab zeigte auch, dass das Gefühl sie trog, dennoch konnte sie es nicht gänzlich abschütteln. Wahrscheinlich wurde die Flüssigkeit in ihren beiden Kanälen einfach so stark komprimiert, dass sie von sich aus deren Wände auseinanderdrückte, und Emilia nahm sie so eben viel bewusster wahr, zudem waren die jeweils zwei Ständer, die unentwegt darin umherrührten und sie so womöglich noch aufschäumen ließ wie Milch, mit Sicherheit nicht ganz unschuldig daran.
Emilias anderes Ende hatte sich zu einer ähnlich hoch frequentierten Anlaufstelle für Samenergüsse entwickelt. Die Dämonin, die ihr von sich aus ihr Teil in den Mund geschoben hatte, als sie keine Möglichkeit gesehen hatte, es selbst zu tun, erreichte aus den bereits erwähnten Gründen ebenfalls sehr schnell ihren Höhepunkt. Auf einmal drückte sie ihr Becken so fest Emilias Lippen entgegen, dass sie unwillkürlich erschrocken aufkeuchte, dann spritzte ihr auch schon warmes sämiges Sperma in den Hals. Das ereignete sich so unerwartet, dass sie völlig automatisch schluckte, ohne auch nur darüber nachzudenken. Die Wächterin schien jedoch gar nicht weiter daran interessiert, was mit ihrer Ladung passierte, nachdem sie sie erst einmal abgefeuert hatte. Noch während Emilia mit schlucken beschäftigt war, zog sie ihren erstaunlich schnell erschlaffenden Penis zwischen ihren Lippen hervor und trat seufzend von ihr zurück.
Sie war gerade einen Schritt weit gekommen, da sah Emilia schon die nächste auf sich zustürzen. Sie masturbierte frenetisch und versuchte auf ihren zittrigen Beinen schnell genug zu ihr zu gelangen, um ihr den vor Säften triefenden Schwanz wenigstens noch kurz in den Mund zu stecken, bevor alle Dämme in ihr brachen, doch dazu kam es nicht mehr. Nur Zentimeter von ihrem Gesicht entfernt konnte die Wächterin nicht mehr an sich halten. Emilia hatte schon schnell den Mund geöffnet, um sie in sich aufnehmen zu können, als sie so eilig zu ihr gestürmt war, doch nun flog ihr stattdessen deren Samen hinein – oder zumindest ein Großteil davon. Bei dieser Dämonin hatte sich offenbar einiges angesammelt, und so spürte Emilia, wie breite Schlieren davon auch auf ihren Wangen, dem Kinn und auf ihrer Stirn landeten, aber das war nichts im Vergleich dazu, was nun ihre Zunge bedeckte. Das hatte auch damit zu tun, dass die Wächterin mittlerweile ihre Absichten angepasst hatte. Nachdem sie feststellen musste, dass sie sich nicht gut genug unter Kontrolle hatte, um sich von dem neuen Dienstmädchen noch wirklich einen ablutschen zu lassen, ging sie nun anders vor. Sie blieb einfach tief vornübergebeugt da stehen, wo sie war, und wichste ihr alles in den offenstehenden Mund.
Schließlich wurde ihre Hand langsamer und sie führte sie nur noch ein letztes Mal von ganz unten bis zur obersten Spitze herauf, wobei sie so fest wie möglich zudrückte, als wäre ihr Ständer eine Tube Zahnpasta, von der sie auch noch den letzten Tropfen hinausquetschen wollte, als plötzlich eine weiter der umstehenden Dämoninnen ihrem Verlangen erlag. Sie hatte bereits eine ganze Weile onanierend genau neben Emilia gestanden, doch als sie nun sah, wie deren Mund sich immer weiter mit weißem öligem Samen füllte, war es um sie geschehen. Sie fand bloß noch Zeit, den Kopf in den Nacken zu werfen und hörbar laut langgezogen auszuatmen, bevor es aus ihr hervorbrach. Mit effizienten Bewegungen ihrer Hand machte sie es sich weiter selbst, während das Sperma aus ihr hervorsprudelte, einen kleinen Bogen beschrieb und anschließend in den See plätscherte, der in Emilias Mund entstanden war und so mit jedem Schwall noch mehr anwuchs.
Als auch diese Wächterin sich erschöpft hatte, war Emilias Mund so voll mit Sperma, dass sie nicht mehr die Lippen schließen konnte, und sie Mühe hatte, diese inkonsistente Brühe nicht überschwappen zu lassen bei der ungestümen Behandlung, mit der sie von hinten noch immer bedacht wurde. Damit hatte sie jedoch allenfalls mäßigen Erfolg, den Spuren nach zu urteilen, die sie an ihren Mundwinkeln hinablaufen fühlte. Eine Weile überlegte Emilia, was sie jetzt tun sollte; wie schon zuvor wollte sie der Dämonin unter sich nicht unbedingt ins Gesicht spucken, aber sie hatte heute bereits so viel Samen getrunken, dass sie ihn warm in ihrem Magen spürte. Allerdings nahm eine neue Wächterin ihr diese Entscheidung ab, indem sie ihr kurzerhand ihren Schwanz in den Mund stopfte, ohne darauf zu achten, dass dabei das Sperma in alle Richtungen davonspritze, und begann sofort darauf, sich mit fahrigen Hüftstößen in dieser Schlammgrube zu ergehen.
Diese Wächterin hielt letztlich etwas länger durch. Bei ihr brauchte es fast eine Minute, bis sie kam, aber das täuschte nicht darüber hinweg, dass sich dieses ganze Abenteuer mittlerweile zu einer reinen Massenabfertigung gewandelt hatte. Unentwegt drängten sich neue Penisse in sie, ruckelten sie kurz durch und ergossen sich in ihr, bevor sie wieder verschwanden, aber augenblicklich schon wieder ersetzt wurden. Ihr Mund, ihr Arsch und ihre Scheide, sie alle wurden von einem beinahe konstanten Strom an Samen ausgewaschen, als würde sie nackt am Strand liegen und immer wieder von Wellen salzigen Meerwassers überrollt werden, die bis in jede noch so winzige Ritze ihres Körpers rannen.
Unter diesen Umständen ist wohl verständlich, dass Emilia schon bald den Überblick darüber verlor, wie vielen der anwesenden Dämoninnen sie bereits zu einem Orgasmus verholfen hatte und wie viele noch auf diese Gunst warteten. Sie hatte es schnell aufgegeben mitzuzählen, wie oft sie schon von innen oder außen mit Sperma besudelt worden war, aber sie hatte den starken Verdacht, dass die Gesamtsumme höher war als die der Mitglieder des Regiments, das in diesem Raum seine Übung abhielt, jedenfalls meinte sie, einige der Wächterinnen wiederzuerkennen, die sie schon einmal in irgendeiner Form bedient hatte und sich dann offenbar für eine zweite Runde anstellten. So war sie sich ziemlich sicher, dass die junge Anwärterin, der sie zu aller erst einen geblasen hatte, und die später noch ihrer Spalte einen Besuch hatte abstatten dürfen, sie am Schluss auch noch in den Arsch gefickt hatte. Falls das stimmte, war sie die erste Person, die in den Genuss aller drei ihrer Körperöffnungen gekommen war, selbst ihren eigenen Schwanz hatte sie bisher nur in ihren Mund und in ihre Möse aufgenommen.
Trotzdem soll nicht unerwähnt bleiben, dass auch Emilia im Verlauf dieser Orgie noch einen Höhepunkt erlebt hatte. Das war natürlich abzusehen gewesen, so nahe sie schon davor gestanden hatte und so unermesslich wohltuend ihre aufwallenden Gefühle waren, dennoch geschah es dann auf wenig erwartete Weise. Eine der Dämoninnen, die bis dahin neben ihr stehend sich einen abgerubbelt hatte, entdeckte ihren zügellos umherpeitschenden Penis und war sichtlich von ihm fasziniert. Nachdem sie ihn eine Zeit lang wie hypnotisiert von seinem Pendeln beobachtet hatte, griff sie plötzlich nach ihm und hielt ihn hoch. Emilia hatte keine Ahnung, was sie danach vorgehabt hatte, ob sie ihr einen blasen wollte, ihr einen abschütteln oder sich dieses ungewöhnliche Geschlechtsteil einfach nur einmal aus der Nähe ansehen wollte, doch damit war ohnehin jeder weiterführende Plan hinfällig gewesen. Diese Berührung, das Umfassen ihres Schafts in einer fest geschlossenen Faust, war der eine Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Emilia kniff die Augen zu und stöhnte sachte, als auf einmal ein Gefühl unendlicher Entspannung auf sie herabsank. Es war merkwürdig; da war sie heute schon so oft gekommen, und doch kam es ihr nun so vor, als hätte sie wochenlang in völliger Enthaltsamkeit gelebt und sie könnte zum ersten Mal seit langem endlich wieder ihrem Trieb nachgehen. Es war, als hätte sich in ihr eine unterschwellige Unruhe aufgebaut, eine Art unterdrückten Aufbegehrens, das jetzt im selben Maß aus ihr herausfloss wie der Samen aus ihrem Schwanz und dabei nichts als Glückseligkeit hinterließ. Davon wusste die Wächterin zwar nichts, die ihren Penis mit leicht überraschtem Gesichtsausdruck in der Hand hielt, aber sie sah den gewaltigen Strahl, der wie aus einem Feuerwehrschlauch aus ihm hervorgeschossen kam, und konnte nicht widerstehen. Ihre Reaktionszeit war so kurz, wie es sich für ihren Berufsstand gehörte, innerhalb von Sekundenbruchteilen hatte sie den Samen verschleudernden Ständer in ihrem Mund und nuckelte an ihm, sodass sie seinen heißen Saft trank wie von einem Wasserspender.
Doch obwohl dies die größte Ausschweifung war, die Emilia sich nur vorstellen konnte, und sie der festen Überzeugung war, sich mit ihrer Teilnahme in funktionärer Position daran irgendeine Medaille äußerst fragwürdiger Art verdient zu haben, war es letztendlich überraschend schnell vorbei. Vielleicht lag es daran, dass die Wächterinnen sich ihrer Profession entsprechend nicht mit irgendwelchen Befangenheiten aufhielten, sondern sich einfach nur rasch in ihr erleichterten, bevor sie sich wieder der Ausführung ihrer eigentlichen Befehle zuwanden, oder vielleicht daran, dass sie alle von einem so dringenden Bedürfnis erfüllt gewesen waren, dass sie es gar nicht hatten erwarten können, endlich mal wieder jemanden flachzulegen, Emilia konnte nur mit Sicherheit sagen, dass, wenn es einen Wettbewerb gäbe, innerhalb der kürzesten Zeit so viele Schwänze wie möglich zum Abspritzen zu bringen, sie hiermit auf jeden Fall gute Chancen auf den ersten Preis gehabt hätte.
Dabei merkte sie zunächst gar nicht, dass sie ihre Aufgabe bereits erfüllt hatte. Die letzte Dämonin besorgte es ihr in den Hintern, während Emilia flach auf dem Bauch lag. Nachdem die keuchend ejakuliert hatte, und schließlich den Penis aus ihr herauszog, blieb sie schlicht liegen. Sie war völlig ermattet und nahm an, die nächste Wächterin würde ihr auch so schon das Ding dort hineinstecken, wo immer sie wollte. Erst als das ausblieb, und sie um sich herum kein aufgeregtes Schnauben mehr hörte, sondern beiläufiges Gemurmel wie von Kolleginnen, die über Alltägliches plauderten, während sie darauf warteten, dass eine Geschäftsbesprechung begann, hob Emilia den Kopf. Die Dämoninnen trugen inzwischen alle wieder ihre Kleidung und standen in kleinen Gruppen beisammen ohne weiter auf sie zu achten.
Das fiel nun auch der Offizieren auf. Mit festem Schritt stapfte sie zu Emilia hinüber, hielt ihr die Hand hin und half ihr auf die Füße. »Nun«, sagte sie ruhig, »dann danke ich dir vielmals für deine Hilfsbereitschaft. Das war wirklich außerordentlich freundlich von dir. Allerdings müsste ich dich bitten, jetzt zu gehen. Wir müssen noch unsere Übung beenden und die Erfahrung hat gezeigt, dass die Anwesenheit von Dienstmädchen dabei eine recht ablenkende Wirkung auf meine Kompanie hat.«
Sie lächelte Emilia entschuldigend zu, aber das änderte nichts daran, dass sie sie am Arm aus der Halle hinausführte. Emilia ließ das bereitwillig zu, was aber im Grunde nur wenig damit zu tun hatte, dass sie wirklich gehen wollte. Vielmehr kam sie sich vor, als wäre sie gerade mitten aus der Tiefschlafphase gerissen worden und hätte noch gar nicht zurück in die Realität gefunden. Sie fühlte sich schwach und war ganz wackelig auf den Beinen, während sie neben der Offizierin hertapste, aber als sie draußen war, die Tür hinter ihr ins Schloss fiel und sie sich aufatmend an sie lehnte, ging es ihr schon wieder besser. Zwar waren ihre Gedanken noch immer wie in Nebel gehüllt, doch indem sie gleichmäßig tief Luft holte und sie nur langsam wieder ausstieß, hoffte sie, ihn zu vertreiben und ein wenig Ordnung in das Chaos in ihrem Kopf zu bringen.
Das funktionierte ausgezeichnet. Ihr Bewusstsein befreite sich immer weiter aus der Umklammerung dieses tranceähnlichen Zustands, in dem sie gefangen gewesen war, und die erste Überlegung, die sich ihr dabei aufdrängte, war, ob sie sich benutzt vorkommen sollte. Eigentlich stand es völlig außer Frage, dass sie für dieses Regiment an Wächterinnen dort drinnen nicht viel mehr als ein Spielzeug gewesen war, an dem sie ihre überschüssige Energie auslassen konnten, trotzdem bereute sie ihre Entscheidung nicht. Auch wenn sie hier ein bloßes Lustobjekt gewesen war, hatte Emilia die Wächterinnen im Gegenzug doch auch nur für ihr Experiment benutzt, mit dem sie herausfinden wollte, was Maria an dieser verschrobenen Grenzüberschreitung so sehr reizte, und das war ihr zweifellos gelungen. Sie hatte definitiv ihren Spaß gehabt, das konnte sie nicht leugnen, nicht bei diesem welterschütternden Orgasmus von vorhin, von dem sie selbst jetzt noch ganz weiche Knie hatte.
Insofern hatten also beide Parteien – Emilia ebenso wie die Meute an Dämoninnen – nur ihrem jeweiligen Verlangen nachgegeben und genau das bekommen, was sie sich davon erhofft hatten, dennoch konnte sie nicht verhindern, dass sie erneute Schuldgefühle beschlichen. War es denn nicht bestenfalls eine Abnormität gewesen, wofür sie sich eben hergegeben hatte? Jedenfalls war es wohl kaum als gewöhnlich zu bezeichnen. Emilia wusste nur zu gut, dass die allerwenigsten Menschen Verständnis für eine solche Verfehlung hätten aufbringen können. Immerhin war sie in einer Welt aufgewachsen, in der Monogamie als einzig akzeptable Form der Partnerschaft aufgefasst wurde. Sogar offene Beziehungen oder Verhältnisse, die aus mehr als zwei Personen bestanden, wurden in höchstem Maß kritisch beäugt, und selbstverständlich waren es dann immer die Frauen, über die hergezogen wurde. Aus unerklärlichen Gründen gerieten gerade Frauen schnell in Verruf. Was bei Männern als Zeichen von Stärke, Selbstbewusstsein oder Lebensfreude geachtet wurde, machte Frauen zu Emanzen, Kampflesben oder Nutten. Das war doch nichts anderes als Doppelmoral, die dazu diente, sie klein zu halten und in bestimmte Rollen zu drängen und ihnen wurde Standards auferlegt, die gar nicht zu erfüllen waren. Sie sollten stets die gerade gängigen Schönheitsideale aufweisen, egal ob ihre Körper dazu geschaffen waren oder nicht, sie sollten sich gut kleiden, aber nicht so gut, dass es angeberisch gewirkt hätte, sie sollten unschuldig sein und gleichzeitig immer zur Verfügung stehen, wenn sie dann doch einmal ›dem Richtigen‹ begegneten, und natürlich sollten sie die als typisch weiblich wahrgenommenen Attribute ausstrahlen wie Mütterlichkeit oder Sanftmut, und wer dagegen verstieß wurde schnell zum Ziel von Anfeindungen und Spott. Wenn eine Frau einen Mann korrigierte, war sie eine Besserwisserin; wenn sie in einer Gruppe die Führung übernahm, war sie herrisch und wenn sie sich einfach vergnügen wollte, und dazu schnellen unkomplizierten Sex suchte, war sie eine Schlampe.
Dieses Denken war so tief in der Gesellschaft verankert, dass es selbst in einer so libertären Freistatt wie dem Freak-Club erst nach und nach verschwunden war. Zu Anfang war Maria dort ebenfalls als Schlampe verschrien gewesen, nur weil sie eine Zeit lang recht spontan und ohne sich erst zu zieren auf Annäherungsversuche eingegangen war, auch wenn Emilia ihren Clubkameradinnen zugute halten musste, dass sie sie damit nur vor einem gebrochenen Herzen bewahren wollten. Glücklicherweise hatte sich das bald geändert und ihre entspannte Haltung gegenüber einer ganz unverbindlichen Nummer als eine rein freundschaftliche Geste wurde von ihnen mittlerweile durchaus hoch geschätzt, doch war das eben nur die eine Ausnahme. Überall sonst galt Maria als Persona non grata, und wenn es ihr schon so erging, was hatte dann erst Emilia zu befürchten? In was sie hier hineingeraten war, ging über alles hinaus, was man Maria hätte anlasten können. Obwohl deren Bekanntschaften eher flüchtiger Natur waren, hatte sie doch wenigstens ein paar Worte mit ihnen gewechselt, bevor sie sich mit ihnen an einen abgelegeneren Ort zurückgezogen hatte, um die Beine für sie breit zu machen, und obwohl sie später sämtliche Mitglieder des Freak-Clubs auf einmal rangelassen hatte – und das auf regelmäßiger Basis – war sie mit ihnen auf tiefste Weise verbunden. Emilia hingegen konnte nicht auf solch mildernde Umstände hoffen. Sie hatte sich von einer praktisch unbegrenzten Anzahl Wächterinnen durchnehmen lassen. Sie hatte sie zwar nicht vorher durchgezählt, aber es waren ohne Frage weit mehr gewesen als durchschnittliche Menschen in ihrem gesamten Leben an Geschlechtspartnern zusammentrugen, und um alles noch schlimmer zu machen, waren sie ihr nicht nur völlig fremd gewesen, sondern sie hatte die meiste Zeit über nicht einmal gesehen, mit wem oder mit wie vielen sie es gerade trieb, weil sie konsequent von hinten genommen worden war. Emilia war nicht gläubig, aber wenn man das nicht als Sünde bezeichnen konnte, was dann?
Trotzdem beharrte ihr Verstand darauf, nichts Unrechtes getan zu haben. Wenn alle freiwillig mitgemacht hatten und hinterher zufrieden waren, gab es doch absolut keinen Anlass, Scham zu empfinden, und sie war sicher, dass sie das auch nicht täte, wenn bloß Maria oder zumindest eine ihrer Freundinnen aus dem Club jetzt bei ihr wären. Dann könnten sie sich gemeinsam über ihre neue Erfahrung austauschen, wie es gewesen war, so viel Sperma zu schlucken, dass es in ihrem Bauch rumorte, oder wie jeweils zwei Schwänze in jedem ihrer Löcher ihr einen Schauer von Schmerz und Lust gleichermaßen über den Rücken gejagt hatten, und alles würde sich viel mehr nach der harmlosen Eskapade anfühlen, die es ja eigentlich war. Doch dass eben niemand bei ihr war, war genau das Problem, wie sie nun feststellte. Im Augenblick kam sie sich einfach völlig verloren vor. Sie war hier in einer anderen Welt, war von ihren Freundinnen getrennt worden, war ganz allein auf sich gestellt, ohne Führung, ohne Trost, und nun hatte sie sich auch noch zu dieser Anwandlung hinreißen lassen, die sie nach Meinung aller anderen noch mehr zu einer Abnormität machte als ohnehin schon.
Plötzlich fiel ihr auf, wie viel leichter es war, gegen die herrschenden Regeln des Anstands zu verstoßen, wenn man es gemeinsam mit Gleichgesinnten tat. Dann war man weiterhin Teil einer Gruppe und genoss deren Rückhalt, auch wenn man möglicherweise aus dem größeren System der Sozialstruktur ausgeschlossen wurde. Deshalb hatte es ihr wohl auch nie etwas ausgemacht, im Rahmen ihrer Clubtreffen die Grenzen der Moral auszuloten, doch jetzt war sie allein, niemand stand ihr bei, niemand versicherte ihr, dass sie nicht falsch gehandelt hatte oder versprach ihr Läuterung, und diese Isolation, dieses Fehlen jeglicher Bestätigung zog ihr förmlich den Boden unter den Füßen weg. Sie kam sich vor, als würde sie auf Zehenspitzen am Rande eines Abgrunds balancieren, und sie hatte auch eine ziemlich gute Vorstellung davon, woher dieser Eindruck kam. Früher hatte sie oft mit Ausgrenzung zu kämpfen gehabt, und das war, als wäre sie auf einer immerwährenden Flucht gewesen. Sie hatte das Gefühl gehabt, nie jemandem vertrauen zu können, weil diese Person ihr sonst mit diesem Wissen bei nächstbester Gelegenheit in den Rücken gefallen wäre; wenn jemand in ihrer Nähe gelacht hatte, war sie unwillkürlich zusammengezuckt, weil sie dachte, es machte sich schon wieder jemand über sie lustig und immer, wenn sie unter Menschen war, hatte sie unter ständiger Anspannung gestanden, weil sie jederzeit mit neuen Anfeindungen gegen sich gerechnet hatte.
Das hatte sich erst geändert, als sie unvermittelt Teil des Freak-Clubs geworden war. Dort war sie auf einmal mit offenen Armen empfangen worden, zum ersten Mal hatte sie erfahren, wie es war, wirklich einer Gemeinschaft anzugehören, sie war akzeptiert worden, wie sie war, und – was das Wichtigste war – sie wusste, dass sie sich immer auf sie würde verlassen können. Immerhin kannten sie bereits ihre dunkelsten Geheimnisse und hatten sich trotzdem nicht von ihr abgewendet, doch jetzt hier ohne sie zu stehen, ohne jede Bezugsperson, ließ ihr das Herz in der Brust gefrieren. Nie wieder wollte sie, dass ihr Leben so wurde wie früher, und obwohl sie wusste, dass das nicht stimmte, kam sie sich geopfert vor, wie ein Bauer in einem Schachspiel, dabei war alles, was sie wollte, in den Arm genommen zu werden und ein paar Worte des Zuspruchs zu hören.
Das stand aber zumindest für den Moment nicht zu erwarten, also hob Emilia den Kopf, straffte ihre Gestalt und sah sich zum ersten Mal, seit sie aus der Übungshalle der Wächterinnen hinauskomplimentiert worden war, genauer um. Erst jetzt bemerkte sie, dass sie nicht dort stand, wo sie hereingekommen war. Offenbar hatte es noch eine zweite Eingangstür gegeben, durch die sie vorhin hinausgedrängt worden war, obwohl ihr die nicht aufgefallen war, allerdings war Emilia zugegebenermaßen zu beschäftigt damit gewesen, ein ganzes Heer an Dämoninnen über sich steigen zu lassen, um die architektonischen Gegebenheiten ihrer Umgebung zu begutachten.
Das trug nicht gerade dazu bei, Emilia wieder zu ihrer gewohnten Souveränität zu verhelfen. Sie wusste einfach nicht, was sie tun sollte. Sie hatte es von Anfang an für keine gute Idee gehalten, diese Aktion zu starten, ohne vorher einen Plan auszuarbeiten. Es hatte sie schon immer verunsichert, sich auf etwas einzulassen, ohne vorher genau zu wissen, was sie erwartete, doch dies war noch viel schlimmer. Hier ging es um viel mehr als jemals zuvor, Lisa war entführt worden, und alle, an denen Emilia etwas lag, waren nun hier, um sie zu befreien. Zwar konnte sie sich noch immer nicht recht vorstellen, dass Sinistra ihnen etwas antat, aber sie kannte inzwischen sowohl die Leidensgeschichte ihrer Mutter als auch Lillys, trotzdem gelang es ihr nicht, diese Taten mit Sinistra in Verbindung zu bringen. Zu Emilia war sie immer liebevoll gewesen, hatte sie unterstützt, wo sie nur konnte und hatte sich die Zeit genommen, sich ihre Sorgen anzuhören, doch sie war auch äußerst zielstrebig, war berechnend und verabscheute es, wenn ihre von langer Hand geschmiedeten Pläne durchkreuzt wurden.
Was sollte sie nun also tun? Sie hatten nicht einmal einen Treffpunkt vereinbart, für den Fall, dass sie getrennt wurden, oder sich überlegt, was sie machen sollten, wenn etwas schiefging. Emilia hätte sich wieder im Internat materialisieren können, zwar war sie noch nie in eine andere Welt gereist, war sich aber ziemlich sicher, dass sie es nach der Anleitung, die sie mitgehört hatte, als Nicole es Lilly erklärt hatte, schaffen würde, nur kam ihr das völlig falsch vor. Nie würde sie ihre Freundinnen einfach so im Stich lassen. Sollte sie vielleicht selbst weiter nach Lisa suchen? Oder sollte sie Lilly und die anderen mit ihren Schattenkräften zu sich rufen? Doch auch das erschien ihr nicht zweckmäßig. Allein konnte sie nichts gegen Sinistra ausrichten, und die anderen waren möglicherweise schon fast bei Lisa angelangt, da wäre es unsinnig gewesen, sie von dort abzuberufen. Hier weiterhin tatenlos herumlungern konnte sie aber auch nicht, das wäre zu auffällig gewesen, schließlich war sie angeblich ein Dienstmädchen. Sie sollte wenigstens so tun, als hätte sie irgendeine Aufgabe.
Letztendlich beschloss sie, erst einmal ohne bestimmtes Ziel loszulaufen. Das würde wenigstens den Eindruck erwecken, dass sie sich im Palast auskannte und auf dem Weg war, eine Anweisung zu erfüllen. Vorher sah sie noch einmal reflexartig an sich herunter. Für sie war es beinahe ein Automatismus, ihr Erscheinungsbild zu überprüfen, bevor sie irgendwo hinging, und wie sich zeigte, war es momentan eine einzige Katastrophe. Ihr Kleid hing nicht gerade in Fetzen, aber da sie es die ganze Zeit über anbehalten hatte, während sie von einer nicht näher einzugrenzenden Anzahl von Wächterinnen bestiegen worden war, die allesamt in ihrer Hektik, Emilias intimste Körperstellen zu erreichen, nicht zimperlich damit umgegangen waren, hatte es einige Risse abbekommen und darüber hinaus war es natürlich von unzähligen Spermaflecken besudelt, die sich auf dem weißen Stoff zwar nicht so deutlich abhoben, wie es sonst der Fall gewesen wäre, aber sie bildeten doch erkennbare dunklere Spuren darauf. Es sah aus, als wäre sie in einen fast schon orkanartigen Regenschauer geraten – allerdings in einen, der ungewöhnlich dickflüssig war. Auch überall auf ihrer Haut konnte sie das schleimige Zeug spüren; es hatte ihre schneeweißen Haare zu Strähnen verklebt, ihr Gesicht war förmlich darin gebadet und es sickerte noch immer aus ihren Löchern hervor, wo das meiste davon gelandet war, und lief in breiten Bahnen an ihren Schenkeln hinab.
Dieser letzte Punkt verwirrte Emilia ein wenig, bevor sie mit einem Mal begriff. Als sie vorhin gebeten worden war zu gehen, hatte sie nicht daran gedacht, ihren Slip mitzunehmen, der ihr irgendwann ausgezogen worden war, sodass sie nun unten ohne hier stand. Einen Augenblick lang überlegte sie, ob sie noch einmal anklopfen und danach fragen sollte, entschied sich aber dagegen. Ihr war ziemlich klar gemacht worden, dass sie nun, da die Wächterinnen nicht mehr mit ungewollten prallen Ständern herumliefen, dort bis auf weiteres nicht zu suchen hatte, und es war ja nicht so, dass sie ihn dringend benötigte. Niemand konnte sehen, dass sie unter dem Kleid kein Höschen trug, sollten die Wächterinnen damit also machen, was sie wollten. Vielleicht war er für eine von ihnen ein nettes Souvenir.
Da sie daran nichts ändern konnte, ging sie einfach los, ohne sich um ihr Aussehen oder fehlende Kleidungsstücke zu kümmern. Nur als sie an einigen Dämoninnen vorüberging, die ihr in dem Korridor entgegenkamen, machte sie sich etwas Sorgen, wie sie wohl darauf reagierten, doch war das gar nicht nötig. Niemand wandte sich angewidert von ihr ab oder bedachte sie auch nur mit neugierigen Blicken, stattdessen lächelten sie ihr freundlich zu und grüßten sie unbeschwert. Offenbar waren minderjährige Dienstmädchen, die wie mit einem Eimer Sperma übergossen wirkten, im Limbus kein Anblick, der besonderes Aufsehen erregte.
So folgte sie unbehelligt dem Gang. Wenn sie an Abzweigungen kam, nahm sie wahllos die erstbeste, aber sie war noch gar nicht weit gekommen, als es an einem Punkt nicht weiterging. Der Korridor endete hier in einer ausladenden Sackgasse, in die mehrere Türen eingelassen waren. Sie hätte umkehren können, hörte jedoch Stimmen hinter sich, die auf sie zukamen, und einmal davon abgesehen, dass es vielleicht einen etwas merkwürdigen Eindruck gemacht hätte, direkt wieder aus diesem Gang herauszukommen, nachdem sie ihn gerade erst betreten hatte, wollte sie ihnen einfach nicht begegnen. Sie sehnte sich nach Verbundenheit, nicht nach dem oberflächlichen Austausch von Plattitüden mit Fremden. Ironischerweise hätte sie sich dann noch weniger anerkannt gefühlt und sie wäre sich bloß noch einsamer vorgekommen. Wirklich allein war man eben nicht, wenn niemand um einen herum war, sondern umgeben von Menschen, denen man sich nicht zugehörig fühlte.
Um dem zu entgehen, öffnete Emilia eine der Türen und flüchtete sich in den Raum dahinter. Sollte dort jemand sein, konnte sie sich immer noch entschuldigen und sich damit herausreden, dass sie sich als neues Dienstmädchen verlaufen hatte. Doch sie hatte Glück, in dem Raum hielt sich so weit niemand auf, und sie war wohl auch nicht unbefugt in das private Zimmer einer anderen Dämonin eingedrungen. Der Raum war weder besonders groß noch besonders klein, und die einzigen Möbelstücke darin waren ein langer Tisch in der Mitte sowie einige Stühle, die ihn umgaben. Es hätte eine Art Aufenthaltsraum sein können, allerdings bezweifelte Emilia das. Dazu fehlte ihm die Atmosphäre der Gemütlichkeit, die in solchen Einrichtungen meist herrschte, und es war auch keinerlei Unordnung zu entdecken. Kein rücksichtslos liegengelassener Müll, keine vergessenen persönlichen Gegenstände, nicht einmal ein Untersetzer oder die bei deren Mangel unvermeidbaren Ränder von Tellern und Tassen auf dem Holz des Tisches. Außerdem gab es keine Essensausgabe, keinen Trinkwasserspender oder sonst irgendeinen Hinweis darauf, dass dieser Raum Möglichkeiten zur Entspannung bot.
Emilias Einschätzung nach wurden hier eher Konferenzen abgehalten. Zwar Sinistras Machtanspruch eigentlich absolutistisch, dennoch schien sie sich hier gelegentlich mit den ihr untergebenen Ministerinnen zu beraten, oder ihnen zumindest ihre Haltung in Regierungsfragen zu diktieren, vielleicht fällt sie sogar Urteile, falls sich jemand gegen sie stellte oder es Probleme zwischen ihren Untertanen gab, jedenfalls war ihre Präsenz in diesem Raum unverkennbar. Der Tisch war so lang, dass er fast die gesamte Breite einnahm, und während die Stühle an dessen Seiten zierlos und ohne viel Wert auf Komfort gestaltet waren, glich der an seinem Kopf fast schon einem Thron. Er war nicht nur deutlich größer als die übrigen, mit hoher Rückenlehne und ausladender Sitzfläche, er hatte zudem noch eine dicke Polsterung, vermutlich aus Leder, die sehr weich und anschmiegsam aussah. Insgesamt strahlte er dieselbe Autorität und Eleganz aus, die auch Sinistra stets umgab.
In dieser Beziehung hatte Emilia sich schon immer an ihrer dämonischen Mutter orientiert. Sie hatte ihre Souveränität bewundert, ihr würdevolles Auftreten und hatte schon früh angefangen, sich ganz ähnlich zu geben. Zunächst war das noch unbewusst geschehen; ohne dass sie es selbst bemerkt hätte, hatte sie einige von ihren Eigenheiten übernommen, wie es bei Identifikationsfiguren eben der Fall war, erst später war ihr aufgefallen, dass sie das überhaupt getan hatte, und von da an hatte sie noch mehr darauf geachtet, einen ähnlich erhabenen Eindruck zu hinterlassen. Ihre gesamte Kindheit über war Sinistra ihr wie eine fast schon übermächtige Erscheinung vorgekommen, zu der sie aufblickte, die nie in Verlegenheit geriet und die niemand gewagt hätte zu verspotten. Sie war ihr großes Vorbild gewesen, und dann erfahren zu haben, für welches Leid sie verantwortlich war, hatte ihr das Herz gebrochen. In gewisser Weise hatte es sogar ihr Weltbild unwiderruflich zerstört. Auf einmal war nichts mehr so gewesen wie vorher, die Liebe zwischen ihren Eltern nunmehr als Lüge enttarnt, ihre eigene Existenz ein unverzeihliches Verbrechen an sich und dazu die Enthüllung, dass sie eine Halbschwester hatte, die nicht das Glück gehabt hatte, von Sinistra ebenso wertgeschätzt zu werden wie Emilia.
Dennoch konnte man sich Sinistras Charisma nicht so einfach entziehen. Trotz des Wissen, das Emilia mittlerweile über sie gewonnen hatte, fühlte sie sich noch immer unwiderstehlich von ihr angezogen. Als wäre Sinistra ein Stern und sie selbst ein bloßer Trabant, der die, gefangen auf seiner Bahn, so lange umkreiste, bis er irgendwann unweigerlich in ihn hineinstürzen und in einem kurzen Augenblick des Infernos zu Asche verglühen würde. Um solche Assoziationen auszulösen, musste sie nicht einmal anwesend sein. Es reichte aus, dass Emilia hier stand, in einem Raum, den sie offensichtlich oft besuchte, und vor einem Stuhl, der wie ein Sinnbild ihrer Persönlichkeit wirkte, und schon kam sie sich wieder vor wie ein kleines Mädchen, das sich nichts mehr wünschte, als ein Lob von seinen Eltern zu bekommen. Vielleicht war das der Grund, weshalb sie als Kind so brav gewesen war. Sie hatte immer getan, was ihr aufgetragen worden war, ohne diese Beschlüsse je infrage zu stellen, weil sie unbedingt wollte, dass Sinistra stolz auf sie war, und obwohl sie glaubte, dieses unreife Streben weitestgehend hinter sich gelassen zu haben, wurde ihr jetzt klar, dass sie ihre dämonische Mutter auf jeden Fall noch ein letztes Mal wiedersehen wollte und danach nach Möglichkeit nie wieder. Immerhin konnte an ihrer Schuld kein Zweifel bestehen, die hatte sie mehr oder weniger selbst zugegeben, doch fand Emilia, dass auch ihre Seite der Geschichte gehört werden sollte. Jeder Angeklagte, egal wie niederträchtig, hatte eine faire Verteidigung verdient. Wie also sahen ihre Motive aus? Tat es ihr leid, was sie getan hatte? Und was bezweckte sie überhaupt mit Lisas Entführung? Von welcher Seite man es auch betrachtete, ein abschließendes klärendes Gespräch war unerlässlich, um sich ein für alle Mal von Sinistras Lügen und dem Einfluss ihres als Fürsorge verkannten Kontrollzwangs zu befreien, und dafür befand sie sich ja schon genau im richtigen Raum, denn welche bessere Umgebung hätte es für eine solche Unterredung geben können als dieser Ehrfurcht gebietende Saal, der offensichtlich genau diesen Zwecken diente?
Dementsprechend sah Emilia keinen Grund, die Konfrontation noch länger hinauszuzögern. Sie wandte sich einfach einer der Ecken zu, in die das Licht der biolumineszenten Myzele nicht heranreichte und so von undurchdringlicher Finsternis erfüllt blieben, dann konzentrierte sie sich auf das unverwechselbare Muster aus Dunkelheit, das Sinistras Essenz darstellte. Daraufhin tat sich zunächst nichts. Wahrscheinlich überlegte Sinistra, ob Emilia sie damit in eine Falle locken wollte, oder was sie sonst für einen Plan haben konnte, sie nun zu sich zu rufen. Sie war eben von Natur aus misstrauisch, möglicherweise weil sie selbst so hinterhältig war, dass sie von anderen automatisch dasselbe annahm.
Allerdings musste ihre Neugier schließlich doch überwiegen, auch wenn sie deshalb nicht sofort jede Vorsicht über Bord warf. Zwar begannen die Schatten in der Ecke allmählich Konturen anzunehmen, aber seltsamerweise bildeten sie nur zwei längliche Ovale wie schwarz glänzende Obsidiane, die ganz von allein in der sie umgebenden Düsternis hingen. Dann öffneten sich diese beiden verfestigten Schatten plötzlich. Es war, als würde sich ein Riss in ihnen auftun und das obere Stück wie ein Schleier von ihnen gehoben, und da ging Emilia auf, dass es Sinistras Augen waren, die sie nun anstarrten. Sie verengten sich ein wenig, als sie Emilia argwöhnisch musterten, weiteten sich aber schnell wieder und ihr Blick huschte suchend durch den Raum. Offenbar fanden sie nichts, was sich als unmittelbare Bedrohung einstufen ließ, denn bevor Emilia irgendetwas sagen konnte, manifestierte Sinistra sich vollständig. Dass geschah innerhalb eines Herzschlags. Im einen Moment waren da nur diese zwei Augen wie Schlitze in der Dunkelheit, und im nächsten schritt Sinistra so geschmeidig aus der Ecke, als hätte sie schon die ganze Zeit dort gestanden und hätte sich jetzt erst dazu entschlossen, aus den sie verbergenden Schatten zu treten.
»Ah, Emilia«, sagte sie in ihrer typischen nonchalanten Art, als könnte sie gar nichts erschüttern, schon gar nicht das unerwartete Auftauchen ihrer in Unwissen gehaltenen Tochter aus einer anderen Welt an diesem Ort, wo sie als Königin regierte und eine ihrer Mitschülerinnen als Geisel hielt, »was führt dich denn hierher?«
»Das weißt du genau«, gab Emilia ebenso ruhig zurück.
»Tja, ich schätze schon, aber ehrlich gesagt habe ich nicht wirklich damit gerechnet, dass du hier aufkreuzt, sondern eher mit deiner Schwester. Apropos, wo steckt sie eigentlich?« Das fragte sie so beiläufig, als würde sie sich tatsächlich nur nach dem Befinden ihres anderen Kindes erkundigen, doch davon ließ Emilia sich nicht täuschen.
Sie zuckte bloß mit den Schultern und sagte: »Wir haben uns kurzzeitig aus den Augen verloren.«
Eine Sekunde lang besah Sinistra sich den Zustand, in dem Emilia sich befand, ihr vom Begrapschen ausgeleiertes und an den Säumen eingerissenes Kleid, ihr zerzaustes, von Sperma nasses Haar und nicht zuletzt die umfassenden Besudelungen, die an ihr hafteten, von den langsam eintrocknenden Klecksen auf ihrem Kleid bis zu den noch feuchten auf ihrer Haut, die zäh an ihr herabrannen. »Ja, sieht so aus. Also, warum wolltest du mich jetzt sprechen?«
»Ich möchte ein paar Antworten.«
Mit der Handfläche nach oben hob Sinistra einen Arm, eine unmissverständliche Geste anteilnahmsloser Einwilligung. »Kannst du meinetwegen haben. Ich habe alle dringenden Angelegenheiten geregelt und mich auf jede mögliche Überraschung vorbereitet, ich habe also Zeit, wenn du meinst, dass dir das irgendwie weiterhilft. Was liegt dir denn nun auf dem Herzen?«
Laut holte Emilia Luft und atmete seufzend wieder aus. In ihrem Kopf wirbelten s viele Fragen umher, dass es ihr schwer fiel, sich für eine zu entscheiden, mit der sie beginnen sollte, oder sich auch nur so weit zu konzentrieren, sie formulieren zu können. Doch je länger sie darüber nachdachte, desto mehr gelangte sie zu der Erkenntnis, dass sie gar nicht so unterschiedlich waren; letzten Endes liefen sie alle auf dasselbe Wort hinaus: »Warum?«
»Warum was?«
»Warum hast du Lisa entführt?«
»Ich dachte, dass wüsstest du.«
»Vielleicht möchte ich es aus deinem Mund hören.«
Wieder deutete Sinistra eine wegwerfende Handbewegung an. »Um Lilly etwas beizubringen. Sie ist mächtig, aber sie hat noch viel zu lernen. Sie hat zu viele Hemmungen, sich völlig in die sanfte Umarmung der Finsternis fallen zu lassen, weil sie Angst hat, sie nicht beherrschen zu können und dann von ihr überwältigt zu werden. Deshalb habe ich nach einem kleinen Anreiz gesucht, sie dazu zu bringen, in eine andere Welt zu reisen. Dazu muss sie sich eben zwangsläufig der Dunkelheit hingeben. Außerdem ist ihre Liebe zu diesem Mädchen ihrer unwürdig. Vielleicht sieht sie das ein, wenn ihr vor Augen geführt wird, wie schwach Menschen tatsächlich sind.«
»Aber warum?«, beharrte Emilia, wurde dafür aber nur mit einem abfälligen Blick von Sinistra gestraft.
»Auch das solltest du inzwischen wissen. Sie soll einmal meine Thronfolge antreten, doch dazu muss sie ihre Kräfte eben akzeptieren, und das kann sie nur, wenn sie versteht, dass die Schatten ihr nichts tun können, sondern dass sie ganz im Gegenteil ihr Zuhause sind, die einzig sichere Zuflucht, die ihr immer offen stehen wird und wo sie sich regenerieren kann.«
»Aber warum«, kam Emilia nicht umhin, noch einmal zu betonen. »Warum ist es so verdammt wichtig, dass unbedingt Lilly deine Nachfolge antritt, dass du sogar Menschen entführst, nur um dein Ziel zu erreichen?«
»Es sind doch nur Menschen«, sagte Sinistra mit verständnisloser Miene, als könne sie überhaupt nicht nachvollziehen, wie dieser absurde Gedanke Emilia überkommen konnte, eine so unbedeutende Spezies hätte auch nur das geringste Mitleid verdient.
Emilia hingegen durchschoss ein brennender Schmerz die Brust, als wäre ihr eine sengend heiße Klinge hineingestoßen worden. Ihr war schon immer klar gewesen, dass Sinistra von der Menschheit im Allgemeinen keine allzu hohe Meinung hatte, und das war für sie nie ein Problem gewesen, immerhin hatte sie die selbst nicht, so wie sie in ihrem Leben behandelt worden war, doch bei diesen Worten begriff sie zum ersten Mal, wie wenig Wert Sinistra einem menschlichen Leben eigentlich beimaß. Sie hasste die Menschen nicht einmal wegen ihrer unbestreitbaren Makel, wofür es Emilias Ansicht nach allen Grund gegeben hätte, aber das wäre mehr an Emotionen gewesen, als Sinistra ihnen gegenüber aufzubringen imstande war. Für sie war der Mensch nichts weiter als eine niedere Lebensform, die der ihren in sämtlichen Belangen so hoffnungslos unterlegen war, dass ihnen nicht dieselben Rechte zustanden. Sie waren einfach so rückständig; sie hatten keine Schattenkräfte und ihnen fehlte jede Einsicht in das Netz der verschiedenen Welten und wie sie funktionierten. In dieser Hinsicht waren sie kaum mehr als wilde Tiere. Im schlimmsten Fall waren sie lästiges Ungeziefer, dass man ohne Anstrengung mit einem simplen Schlag auslöschen konnte, wenn einem danach war, und im besten Fall waren sie doch wenigstens dazu zu gebrauchen, ihre Bedürfnisse an ihnen zu stillen.
Und so war es eben auch Emilias richtiger Mutter ergangen. Sie war gut genug gewesen, um sich an ihr Befriedigung zu verschaffen, nur hatten ihre Qualen damit kein Ende gefunden. Sie war noch weiterhin dazu auserkoren gewesen, ein Spielball für Sinistra zu sein. Sobald diese erfahren hatte, dass Emilias Mutter von ihr schwanger geworden war, hatte sie angefangen, Pläne zu weben und die Kontrolle über deren Leben sowie das ihres noch ungeborenen Kindes zu übernehmen. Sie hatte sie förmlich eingespannt und heimlich an ihren Fäden gezogen, als wären Emilia und ihre Mutter nichts weiter als Marionetten. Dreizehn Jahre lang hatte sie die beiden immer wieder besucht, um sicherzugehen, dass ihre Forderungen erfüllt wurden, dass Emilia sich nach ihren Wünschen entwickelte und wo sich doch schon einmal da war, hatte sie sich bei dieser Gelegenheit auch noch regelmäßig an ihrer Mutter vergriffen.
Jetzt drängte alles in Emilia danach, dieses Argument vorzubringen, dass Sinistra doch nicht ernsthaft ihre Mutter als minderwertig erachten konnte, wenn sie alles daran gesetzt hatte, die Tochter, die sie mit ihr gezeugt hatte, für sich einzunehmen, doch gleichzeitig schnürte die Vorstellung daran ihr vor Angst die Kehle zu. Sie wollte ihre Befürchtungen nicht bestätigt hören, besonders nicht in diesem Moment, wo sie sich so verletzlich fühlte wie ein Kaninchen, das mit der Pfote in eine Schlingfalle geraten war, und sie neigte nicht so sehr zu selbstzerstörerischem Verhalten, dass sie eine Frage stellen würde, auf die der Rabe unweigerlich ›Nimmermehr‹ krächzen würde. Aber es gab ja ohnehin noch einen weitaus eklatanteren Widerspruch in Sinistras Ausführungen.
»Und was ist mit Lilly? Sie ist kein Mensch und trotzdem hast du ihr das Leben zur Hölle gemacht!«
»Das ist etwas anderes«, sagte Sinistra ohne jede Reue in der Stimme. Vielmehr sprach sie in dem selbstgerechten Tonfall, der grundsätzlich allen religiösen Führern inne war, die sich dazu aufschwangen, genau zu wissen, was das Beste für ihre Anhängerschaft war. »Das war eben unumgänglich. Lilly war schon immer ein aufsässiges Kind gewesen. Ihre Mutter war genauso. Sie ist mit ihr in einen anderen Teil ihres Planeten ausgewandert, weil sie dachte, das könnte mich von Lilly fernhalten, dabei hab ich damals nur versucht, ihr ihre Herkunft näherzubringen. Als das nicht geklappt hatte, hat sie alle möglichen komischen Verteidigungsstrategien ausprobiert. Was ist das eigentlich mit diesen Kreuzen bei Menschen? Wie kommen sie darauf, dass das irgendjemanden aufhalten könnte? Na egal, jedenfalls hatte nichts davon eine Wirkung, also habe ich angefangen, Lilly auf ihre Rolle als zukünftige Königin vorzubereiten, aber sie wollte einfach nicht hören. Sie war zu sehr von ihrer Mutter beeinflusst, die ihr immer wieder erzählt hat, wie böse ich doch sei, und das hat mich darauf gebracht, dass ich erst ihren Willen brechen musste. Wenn ich es schaffen würde, ihr deutlich zu machen, dass es keinen Sinn hat, sich mir zu widersetzen und sie besser damit fährt, das zu tun, was ich ihr sage, dann könnte ich sie so formen, wie es von Anfang an geplant war. Es ist nun einmal ihr Schicksal, meine Nachfolge anzutreten, sie muss es nur noch erkennen.«
»Und deswegen hast du ihr all diese unaussprechlichen Dinge angetan?«
»Ja. Zum Glück war das bei dir nie notwendig. Deine Mutter war leicht davon zu überzeugen gewesen, dass ihr Leben viel angenehmer war, wenn sie sich fügte. Sie hat sich zwar ständig mit diesen Getränken betäubt, um sich in einem Dämmerzustand zu halten, aber wenigstens hat sie ihre Situation hingenommen, und du warst stets so gehorsam, dass eine Bestrafung nie nötig war.«
»Aber wenn das so ist, warum dann überhaupt das alles? Wenn du nur eine eigene Dynastie im Limbus gründen willst, warum muss es dann um jeden Preis Lilly sein? Ich weiß, sie ist ziemlich mächtig, aber …«
Sie brach ab, weil sie nicht offen fragen wollte, warum sie nicht als Thronfolgerin ausgewählt worden war, obwohl sie das ebenso wenig wollte wie ihre Halbschwester, doch Sinistra ahnte auch so, worauf sie hinauswollte. »Du meinst, warum ich dich nicht als Herrscherin über den Limbus ernenne?« Als Emilia nickte, stieß Sinistra ohne sich zurückhalten zu können ein Lachen aus, das möglicherweise nicht ganz so grausam klang, wie es ihr vorkam, sich aber nichtsdestoweniger wie ein Strick anfühlte, der sich immer fester um ihren Magen zog, bis er ihn beinahe zerquetschte.
»Du? Auf dem Thron? Das soll wohl ein Witz sein. Damit das klar ist, ich habe Lilly nicht auserwählt, weil sie ›ziemlich mächtig‹ ist, sie ist so mächtig, wie ich es noch nie zuvor bei irgendjemandem gespürt hätte. Wenn sie auf dem Thron wäre, könnte sie nie jemand davon stürzen, und wenn sie nur nicht so eigenwillig wäre, könnte sie in meinem Sinn weiter regieren. Es wäre eine Verschwendung, sie auf der Erde zu lassen, umgeben von diesen kleingeistigen Menschen, die ihre Macht nicht einmal dann erkennen würden, wenn sie durch ihr schwarzes Feuer vernichtet würden. Du hingegen … du warst schon immer eine Verschwendung. Eine Verschwendung meines Samens, der dich gezeugt hat, eine Verschwendung von Zeit und Energie, um dich aufzuziehen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie enttäuscht ich war, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Deine Schattenkräfte sind nicht nur schwach, sie sind völlig unterentwickelt. Hätte ich es nicht besser gewusst, ich hätte gar nicht geglaubt, dass du von mir abstammst. Erst wollte ich dich gar nicht als meine Tochter anerkennen, und dich unbeachtet auf der Erde bei deiner Mutter das unbedeutende kurze Leben führen lassen, dass Menschen eben vergönnt ist, aber dann dachte ich mir, dass es doch ganz nützlich sein könnte, eine Agentin auf der Erde zu haben. Du hättest mir treu ergeben sein sollen, und über alles Bericht erstatten, worauf ich dich ansetze, aber wie sich gezeigt hat, bist du nicht einmal dazu zu gebrauchen, nicht wahr? Beim ersten Anzeichen von Schwierigkeiten bist du sofort zu Lilly übergelaufen, noch bevor du irgendetwas herausgefunden hattest. Und jetzt stehst du allen Ernstes hier und fragst dich, warum ich dich nie als Nachfolgerin in Betracht gezogen habe? Ich bitte dich! Sieh dich doch nur mal in diesem Augenblick an. Was hast du denn gemacht, um bis hierher zu kommen? Jede Wächterin, der du begegnet bist, einmal rangelassen? Hältst du das etwa einer Königin für würdig? Lilly hätte das jedenfalls nicht nötig gehabt. Notfalls könnte sie sich durch den gesamten Palast kämpfen und nichts würde sie aufhalten können. Mir war aber gleich klar, dass aus dir nichts werden würde, aber ich schätze, jetzt hast du diene Bestimmung gefunden. Du kannst immerhin noch als williges Spielzeug für Dämoninnen dienen, die zu Höherem berufen sind. Mehr war von dir wohl nicht zu erwarten.«
Unbewusst war Emilia unter dem Ansturm von Sinistras anklagender Rede immer weiter zurückgewichen. Jedes einzelne Wort davon hatte sich wie eine unendlich lange spitze Nadel in ihr Fleisch gebohrt, bis es keine Stelle an ihr mehr gab, die nicht vor Schmerzen geschrien hätte. Langsam verschwamm die Welt vor ihren Augen, als sie sich mit Tränen füllten, und sie fühlte, wie sich ein Wimmern aus ihrer Kehle Bahn brechen wollte, doch noch konnte sie beides zurückhalten. Das wäre für Sinistra mit Sicherheit nur ein weiteres Zeichen von Schwäche gewesen, und obwohl das nicht möglich schien, wollte sie nicht noch weiter in ihrem Ansehen sinken. Doch es war wohl an der zeit, sich der Wahrheit zu stellen, und die lautete nun einmal, dass sie nicht nur für Sinistra eine Enttäuschung gewesen war, sondern für alle, mit denen sie je zu tun gehabt hatte.
Ihre menschliche Mutter hatte sie zumindest unter keinen Umständen gewollt, das stand fest. Als sie sich ausgesprochen hatten, nachdem sie erfahren hatte, was Sinistra ihrer Mutter angetan hatte, hatte diese ihr gebeichtet, dass sie Emilia hätte abtreiben lassen, hätte Sinistra sie nicht dazu gedrängt, sie trotzdem auszutragen, und so war sie also hier, ungewollt in ein Leben geworfen, das ihr nichts als Ablehnung entgegenbrachte. Zwar hatte Emilia unterschwellig schon gespürt, dass ihre Mutter sie unter der Oberflächliche ihrer oft etwas kühlen Art liebte, trotzdem war stets zu erkennen gewesen, dass etwas Fundamentales zwischen ihnen stand. Eine unüberwindbare Kluft trennte sie voneinander, die nie wirklich angesprochen wurde, sich aber auf subtile Weise immer wieder bemerkbar machte. Ihre Klassenkameraden hatten sie wegen ihrer Andersartigkeit ohnehin verachtet, niemand hatte ihr das Gefühl gegeben, willkommen zu sein, und jetzt so unmissverständlich zu hören, dass sogar Sinistra, die immer für sie da gewesen war, die behauptet hatte, sie wäre so viel mehr wert als alle Menschen, sie insgeheim ebenfalls für eine Missgeburt hielt, genauso wie alle anderen, schien ihre Seele in Fetzen zu reißen.
Erst jetzt wurde ihr klar, in welchem Ausmaß sie wirklich seit ihrer Geburt von Sinistra manipuliert worden war. Alle Komplimente, die sie ihr je gemacht hatte, ihr Lob, wenn sie mit ihr an ihren Schattenkräften geübt hatte, waren nichts als bloße Lügen, ihre Erzählungen über den Limbus und die Erde nur die mit Bedacht ausgewählten Eindrücke, die sie ihr vermitteln wollte, um ihr Weltbild nach ihren Vorstellungen zu beeinflussen, und die angebliche Liebe zu ihrer Tochter ein zynisches Mittel zum Zweck, um sich ihre Loyalität zu sichern. Doch jetzt war diese sorgfältig aufgebaute Fassade in sich zusammengebrochen. Emilia war nicht mehr länger von Nutzen für Sinistra, also konnte sie ihr nun ihr wahres Wesen zeigen, und das bestand aus dem Fehlen von jeder Empathie, aus rücksichtsloser Zielstrebigkeit und einem repressiven Klassendenken. Das war zwar im Prinzip nichts Neues, das hatte Emilia schon immer an ihr wahrgenommen, neu war aber die konsequenzlose Rabiatheit ihrer Ansichten und vor allem natürlich, wie sie den Platz ihrer Tochter in dieser Weltordnung einschätzte.
Demzufolge fühlte Emilia sich jetzt nicht nur hintergangen, sie fühlte sich benutzt. Ihr war Liebe und Fürsorge vorgespielt worden, wo in Wahrheit nichts als Verachtung gewesen war; Sinistra hatte nie irgendetwas wie Verbundenheit zu ihr empfunden, sondern sie nur so schonungslos dressiert wie ein Dompteur seine Tiere, und das war das Grausamste, was ihr jemals widerfahren war. Sie hatte nicht einmal geahnt, dass man sich derartig verletzt und vorgeführt fühlen konnte. Ihr war, als wäre sie von einem riesigen Troll gepackt worden, kräftig durchgeschüttelt und anschließend mit tödlicher Wucht mehrmals auf den Boden geschmettert worden. Ihr war übel, ihr war schwindlig und in ihrem Mund breitete sich ein bitterer Geschmack wie nach Galle aus. Es kam ihr vor, als würde sie schwanken, konnte aber unmöglich sagen, ob das real war, oder es nur eine Täuschung ihres von Schwindel ergriffenen Gehirns war.
Eine Weile befürchtete sie sogar, sie könnte stürzen, doch bevor es dazu kommen konnte, verengte Sinistra plötzlich die Augen und funkelte sie unter zusammengezogenen Brauen hervor an. Schlagartig hatte sich ihr Ausdruck von kalter Geringschätzung zu flammender Wut geändert – ein Umstand, der Emilia völlig entging; der Tränenschleier vor ihren Augen ließ solche Nuancen in der Sicht nicht zu, doch selbst in ihrem derzeitigen verwirrten Zustand bemerkte sie den unvermittelt schneidenden Tonfall, den Sinistra anschlug, als sie sagte: »Ach so ist das. Du bist nur zur Ablenkung hier, während Lilly in den Thronsaal eindringt. Aber das wird nicht funktionieren. Glaub mir, ich habe an alles gedacht. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, ich muss mich erst einmal um deine Schwester kümmern. Wir können ja später weiterplaudern.«
Mit diesen Worten trat Sinistra einen Schritt rückwärts, wieder hinein in die Ecke, wo die Schatten auf sie warteten und sie mit jedem Zentimeter, den sie weiter in sie zurückwich, immer mehr verdeckten, bis sie vollständig von ihnen verschluckt wurde.
Das Einzige, was Emilia noch vor dem endgültigen Zusammenbruch bewahrt hatte, war Sinistras einzigartige, Ehrfurcht gebietende Präsenz gewesen, doch nun, da die verschwunden war, hielt sie nichts mehr aufrecht. Die Beine knickten unter ihr weg und sie fand sich auf den Knien wieder, das Gesicht in den Händen vergraben, während ein hemmungsloses Schluchzen sie unkontrolliert erbeben ließ. Auch ihre Tränen flossen nun ohne jede Scham. Innerhalb von Sekunden waren sowohl ihr Gesicht als auch ihre Hände völlig durchnässt; unaufhaltsam strömten sie aus ihr hervor, sie zitterte am ganzen Körper und ihre Atmung bestand nur noch aus einem erstickten nach Luft schnappen und einem langgezogenen, immer wieder von Krämpfen unterbrochenen Ausatmen.
Wäre sie nicht in einer derart desolaten Verfassung gewesen, hätte sie wohl Sinistras Bemerkung entnehmen können, dass Lilly und die anderen gerade bei Lisa angekommen waren und so Sinistra dorthin gerufen worden war. Dann wäre sie trotz allem sofort aufgesprungen und zu ihnen geeilt, um ihnen zur Hilfe zu kommen, doch so, wie die Dinge lagen, verfügte sie nicht über die Kapazitäten, um diesen Schluss zu ziehen, und so blieb sie dort auf dem Boden hocken, versunken in Verzweiflung und einem Meer aus Tränen.
~+~
Wie es dazu kam, dass Sinistra von ihrem Treffen mit Emilia abberufen wurde, war folgendermaßen: Nachdem Lilly mit den noch übrig gebliebenen Mitgliedern des Freak-Clubs eine scheinbar endlose Zeit durch das Gewirr aus Korridoren geschlichen waren, trafen sie schließlich auf einen langen geraden Gang, der sehr viel breiter als die bisherigen war. An beiden Enden waren stabile, eisenbeschlagene Tore angebracht, wobei dasjenige, das mutmaßlich nach draußen führte, geschlossen war, aber das, das tiefer ins Innere des Palasts ging, stand offen, und genau dort, im Gewölbe hinter dem offenen Tor, spürte Lilly das unverkennbare Netz aus Schatten, das Lisa darstellte.
»Da drin ist sie«, sagte Lilly und deutete in den aus ihrer Position aus uneinsehbaren Raum.
»Sieht wie eine Falle aus, wenn du mich fragst«, meinte Fantasma.
»Na ja, das ist es sogar ganz sicher«, gab Lilly zu. »Was soll das sonst alles? Immerhin erwartet sie mich. Sie hat Lisa extra entführt, nur um mich hierher zu locken, und jetzt hält sie sie in einem leicht zugänglichen Raum gefangen, bei offener Tür und ohne sichtbare Bewachung. Es ist offensichtlich, dass sie will, dass ich da reingehe, aber was bleibt mir anderes übrig? Einfach umkehren und Lisa hier zurücklassen?«
»Nein, natürlich nicht«, versicherte Fantasma ihr. »Also gut, dann marschieren wir also einfach durch die Tür rein und schau’n mal, was von da an passiert, ja?«
»Tja, wenn sonst keiner eine bessere Idee hat«, bestätigte Lilly und sah ihre Mitstreiterinnen der Reihe nach an, doch die schüttelten alle die Köpfe.
»Okay«, sagte Fantasma und zog das Wort dabei so in die Länge, dass es beinahe wie ein resigniertes Seufzen klang. »Sind alle bereit? Muss niemand mehr austreten? Nein? Gut, dann los!«
Vielleicht wollte Fantasma mit diesen Nachfragen nicht nur sichergehen, dass sie auch die Zustimmung ihrer Freundinnen hatte, vielleicht wollte sie sich damit ebenso sehr selbst Mut zusprechen, und sollte das ihre Absicht gewesen sein – ob bewusst oder nicht –, schien es Erfolg gehabt zu haben, denn nun stapfte sie entschlossen auf das Tor zu, die Hände zu Fäusten geballt und die Augen starr auf ihr Ziel gerichtet. Lilly war einen Augenblick lang überrascht, so von Fantasma die Führung abgenommen zu bekommen, erholte sich aber schnell wieder und beeilte sich, um sie einzuholen und neben ihr her zu gehen. Die Zwillinge folgten ihnen etwas zögerlicher, dicht beisammen und einander die Hände haltend, bemühten sich aber, mit den beiden Schritt zu halten, verschreckt zwar, aber dennoch erfüllt von dem eisernen Willen, ihre gefangene Freundin zu befreien.
Und das war es also, was von ihrem Rettungstrupp übrig geblieben war, vier junge Mädchen unterwegs in einen Raum, in dem ohne jede Frage ein Hinterhalt auf sie wartete.
Je näher sie dem Tor kamen, desto mehr konnten sie von dem Raum erkennen, der sich dahinter erstreckte, und bald stand fest, dass es eher ein Saal war. Er war riesig und hatte eine unbestreitbare Aura des Majestätischen an sich, die einem unweigerlich Ehrfurcht abverlangte. Die Wände waren in regelmäßigen Abständen mit bunten Tüchern verhängt, und am Boden geleitete ein schmaler burgunderroter Teppich vom Eingang bis zum hinteren Ende, wo sich ein Podest erhob, auf dem ein prachtvoll geschnitzter Thron stand, dessen Polster in derselben Farbe gehalten waren wie der Teppich. Vor diesem Podest waren ein paar Sitzbänke angeordnet, auf denen wahrscheinlich Bittsteller auf eine Audienz warten konnten – sofern sie nicht unverzüglich davongejagt wurden –, oder wo brave Untertaninnen den weisen Beschlüssen ihrer Königin lauschen konnten.Eigentlich war es seltsam, dass sie im Beisein ihrer Herrscherin überhaupt sitzen durften und nicht die ganze Zeit über auf dem Boden des Gangs knien mussten, allerdings sahen die harten Holzbänke im Gegensatz zum Thron auch angemessen unbequem aus, sodass es wohl, kaum einen Unterschied machte.
Jedenfalls war allen der vier Mädchen, die nun eintraten, sofort klar, dass es sich hierbei um den Thronsaal handelte, auch wenn Lilly nur sehr wenig von ihrer unmittelbaren Umgebung mitbekam. Ihre ganze Aufmerksamkeit konzentrierte sich auf Lisa, die mit angezogenen Beinen und die Arme um die Knie geschlungen in einem kleinen quadratischen Käfig gleich links von dem Podest saß. Er war aus dicken Eisenstäben gefertigt und war gerade so groß, dass sie aufrecht darin stehen konnte. Abgesehen von ihrer an die Embryonalstellung erinnernde Körperhaltung, die vermuten ließ, dass sie sich im Moment nach nichts mehr sehnte als nach Schutz, schien es ihr gut zu gehen, trotzdem überkam Lilly sofort der Impuls, zu ihr zu rennen und sich selbst davon zu überzeugen, doch gerade als sie ihr Gewicht nach vorn verlagerte und ihre Muskeln sich darauf vorbereiteten, den Fuß zu heben, schlossen sich Fantasmas Finger um ihr Handgelenk.
»Mach jetzt lieber keine hastigen Bewegungen«, raunte diese ihr aus dem Mundwinkel zu wies sie mit einem Kopfnicken in Richtung der Wand zu ihrer Seite darauf hin, was ihr bislang entgangen war.
Nun war es so, dass der Thronsaal aus naheliegenden Gründen schon unter normalen Bedingungen der am besten gesicherte Raum im gesamten Palast war, aber in Erwartung einer Usurpatorin waren diese Bewachungsmaßnahmen noch deutlich erhöht worden. An beiden Wänden der langen Halle standen uniformierte Wächterinnen Posten, so dicht, dass sie sich hätten berühren können, wenn sie die Arme ausgestreckt hätten. Im Gegensatz zu ihren Kameradinnen waren diese auch bewaffnet. Sie hielten schmale Speere, die sie noch ein paar Zentimeter überragten, und Lilly glaubte auch zu wissen, warum dieses Muster hier durchbrochen worden war. Für gewöhnlich brauchten die Wächterinnen keine Waffen, ihre Schattenkräfte waren mehr als ausreichend, um jeden Angreifer außer Gefecht zu setzen, doch jetzt waren sie von Sinistra ausdrücklich angewiesen worden, etwaige Eindringlinge unverletzt gefangen zu nehmen, und für diese Aufgabe waren Speere nahezu perfekt geeignet. Mit ihnen konnte man seinen Gegner bedrohen und gleichzeitig auf Abstand halten, und bei einer ausreichenden Anzahl konnte man ihn zudem ohne Gefahr umzingeln.
Offenbar waren ziemlich genau das die Gedankengänge der Wächterinnen gewesen. Noch bevor eine von den Mädchen hätte blinzeln können, waren sie auf sie zugelaufen, hatten einen Kreis um sie gebildet und streckten ihnen die Speere entgegen. Einige von ihnen riefen so etwas wie »Stehen bleiben!«, oder »Keine Bewegung!«, aber eine von ihnen schloss die Augen und rief wie befohlen Sinistra zu sich.
Aufgeschreckt von der plötzlichen Hektik hatte auch Lisa den Kopf gehoben. Als sie Lilly entdeckte, sprang sie hoch und umklammerte die Gitterstäbe, als wollte sie sie auseinanderbiegen, um endlich wieder zu ihrer Geliebten zu gelangen. »Lilly!«, rief sie aus, erleichtert und ängstlich gleichermaßen.
Dieses Mal blieb Lilly ebenso wenig Zeit zu reagieren. Während sie wie erstarrt dastand, hin und her gerissen zwischen dem unbändigen Verlangen, Lisa ungeachtet aller Konsequenzen in die Arme zu schließen und der Notwendigkeit wenigstens so lange zu überleben, um sie sicher wieder nach Hause zu bringen, materialisierte Sinistra sich direkt vor ihr. Dass sie das so einfach schaffte, inmitten eines hell erleuchteten Raumes, war ein weiterer Beweis ihrer Macht. Es war leicht, von einem Schatten zum anderen zu reisen, viel mehr Kraft kostete es, die eigene Dunkelheit an einem bestimmten Ort neu zu konstruieren, so wie Sinistra es jetzt tat. Dunkle Fetzen schwirrten so schnell durch die Luft, dass sie kaum zu sehen waren, winzige Fasern reiner Finsternis, die aus den umliegenden düsteren Ecken herbeischossen und sich an diesem einen Punkt sammelten, wo sie sich miteinander verbanden und in der Dauer eines Wimpernschlags zu der ganzen beeindruckenden Erscheinung der Herrscherin über die Dämonen zusammensetzten.
Es waren nur Bruchteile von Sekunden vergangen, seit sie mit wutentbrannter Miene Emilia in ihrem Beratungszimmer zurückgelassen hatte, doch nun lag schon wieder ihr typisches, leicht arrogantes Lächeln auf ihren Lippen, als sie wie aus dem Nichts vor Lilly auftauchte. »Lilly«, begrüßte sie ihre Tochter mit der gelinden Erheiterung, die so gut wie immer in ihrer Stimme mitschwang, als würde sie auf all die Absurditäten des Lebens herabblicken, die aber nur ihr selbst auffielen, »wie schön, dass du meiner Einladung folgen konntest.«
Lilly gelang es, weder zurückzuweichen noch einen Muskel in ihrem Gesicht zu verziehen, als ihre dämonische Mutter plötzlich nur einen Schritt von ihr entfernt Gestalt annahm. Sie war ohnehin davon ausgegangen, hier auf sie zu treffen. »Tja, ich schätze, ich konnte sie nicht ausschlagen.«
»Es ist trotzdem schön, dass du mich endlich mal besuchen kommst. Wir sehen uns in letzter Zeit ja viel zu selten, meinst du nicht auch?«
Nun lief doch ein eisiger Schauer Lillys Rücken hinab, obwohl sie es sich nicht anmerken ließ. Ihr wurde immer übel, wenn Sinistra diese pervertierte Mütterlichkeit an den Tag legte, nicht nur weil es sie daran erinnerte, was sie ihr angetan hatte und damit einen Bund zerstört hatte, der eigentlich selbstverständlich sein sollte, sondern vor allem, weil sie sich damit auch noch ganz unverhohlen über die Qualen lustig machte, die sie ihr zugefügt hatte.
»Wie wär’s wenn wir aufhör’n würden, so zu tun, als ginge es hier nur um die üblichen Uneinigkeiten zwischen zwei Generationen? Also, was willst du von mir?«
»Weißt du, es ist ziemlich pessimistisch von dir, anzunehmen, dass ich immer etwas von dir will, wenn ich dich kontaktiere, aber so warst du ja schon immer. Allerdings muss ich gestehen, dass ich dich tatsächlich nicht ganz ohne Hintergedanken zu mir gebeten habe.«
»Welch schockierende Entwicklung der Ereignisse«, merkte Lilly völlig ausdruckslos an.
»Na so was. Dass du aufsässig wirst, ist zwar keineswegs neu, aber sonst warst du nie wirklich sarkastisch. Das ist ja auch eher ein Ausdruck des Gleichmuts, wohingegen du eine Kämpfernatur bist. Muss wohl der Einfluss deiner Schwester sein.« Insgeheim freute Sinistra das, zeigte es doch, dass Lilly durchaus noch formbar war und schon noch zur Vernunft kommen würde. Wenn ihr Plan aufging, und sie mehr Zeit miteinander verbringen würden, würde sich das unvermeidlich positiv auf sie auswirken, ob sie das nun wollte oder nicht, sodass aus ihr am Ende eine vorzeigbare Thronerbin würde. »Im Grunde wollte ich dir denselben Vorschlag machen wie schon früher heute: Bleib einfach hier. Bleib im Limbus. Hier gehörst du her, weißt du das denn nicht? Oder gab es etwa je einen Augenblick auf der Erde, in dem du dir nicht wie ein Fremdkörper vorgekommen bist? Die Menschen spüren, dass du anders bist als sie, und du spürst, dass sie anders sind als du, oder nicht?«
Lilly sagte nichts. Natürlich hatte Sinistra grundsätzlich recht, sie war immer eine Außenseiterin gewesen und hatte sich nie irgendwo wirklich zugehörig gefühlt. Ihr war eben klar, dass sie nicht so war wie andere Menschen, und die nahmen das im Gegenzug wohl ebenfalls wahr, denn fest stand, dass sie von ihnen immer wieder ausgeschlossen worden war. Doch das wollte sie Sinistra gegenüber keinesfalls zugeben, zumal sie in Lisa letztlich doch noch jemanden gefunden hatte, mit der sie sich zutiefst verbunden fühlte, und der Freak-Club bildete sogar eine Gemeinschaft, in der sie endlich angenommen wurde. Damit hatte sie eigentlich alles, was sie sich je zu erhoffen gewagt hatte, dennoch kam sie nicht umhin, sich zu überlegen, wie es wäre, wenn sie auf Sinistras Angebot einging und im Limbus blieb. Wäre sie dann nicht endgültig am Ziel ihrer Wünsche angelangt? Wäre sie dann nicht endlich Teil der Gesellschaft, statt einer Ausgestoßenen? Die Dämoninnen hätten zumindest keine Schwierigkeiten, ihre Abstammung zu akzeptieren, viel mehr noch würde sie hier doch respektiert werden. Als Tochter ihrer Königin würde niemand es jemals wieder wagen, sich über sie lustig zu machen. Sie schämte sich selbst für diesen Gedanken, aber stimmte es vielleicht und dies war der Ort, an dem sie ihre so lang ersehnte Erlösung finden konnte?
Offenbar war ihr Schweigen für Sinistra Antwort genug. Sofort verbreiterte sich ihr Lächeln und ihre Haltung entspannt sich merklich. »Siehst du?«, fuhr sie fort. »Niemand dort versteht dich, aber ich verstehe dich. Also mach den Limbus zu deiner Heimat und regiere an meiner Seite. Hier wärst du eine echte Prinzessin. Ist das nicht der Traum jedes Mädchens?«
»Meiner nicht«, sagte Lilly ernst. So schön es auch wäre, von allen gemocht zu werden, hatte sie nie viel für dieses unbedingte Streben nach Ruhm und Bewunderung übrig gehabt. Sie hatte keine Berichte über die Monarchien verfolgt und sie hatte auch nicht leben wollen wie in einem Märchen. Dieser ganze Kram kam ihr einfach nur ungerecht vor. Da gab es diese selbsternannte Elite von nur wenigen Personen, die sich für etwas Besseres hielt, bloß weil sie in diese bestimmte Familie hineingeboren worden waren. Sie waren so verwöhnt, dass sie in Palästen lebten, die viel zu groß für sie waren, und hatten mehr Geld als sie jemals ausgeben könnten, ohne auch nur einen Tag dafür gearbeitet zu haben, während sie ihre Untertanen bei sich einstellten, damit sie bei ihnen putzten, sie bedienten und für sie kochten. Das war doch nicht fair, und wenn es eines gab, was Lilly von ganzem Herzen verabscheute, dann war es Autoritarismus, das Verlangen sich mit aller Gewalt über andere zu erheben. Nein, ihr lag nichts daran, selbst in diesen Stand erhoben zu werden, viel lieber wollte sie den Adel zusammen mit sämtlichen anderen Formen der Unterdrückung bekämpfen.
Das siegessichere Grinsen in Sinistras Gesicht verblasste wieder ein bisschen, doch noch gab sie sich nicht geschlagen. »Na schön«, sagte sie, »es muss ja gar nicht die Erfüllung eines lang gehegten, geheimen Traumes sein, Hauptsache du begreifst endlich, dass es doch nur zu deinem eigenen Besten wäre. Es wäre doch eine Verschwendung deiner Macht, wenn du weiter auf der Erde leben würdest unter Menschen, die gar nicht ahnen, wie überlegen du ihnen bist. Also, was sagst du? Du bleibst hier und erklärst dich bereit, meine Nachfolge anzutreten, und dafür können deine Freundinnen ohne weitere Belästigungen wieder nach Hause.«
»Auch Lisa?«
»Wer?«, fragte Sinistra erst verwirrt nach, bevor ihr klar wurde, wen Lilly meinte. »Ach, deine kleine Gespielin da hinten«, sagte sie und wies mit dem Daumen hinter sich auf den Käfig, in dem Lisa gefangen war. Dann schlug sie einen Arm unter und tippte sich mit dem Zeigefinger der anderen Hand nachdenklich ans Kinn. »Nun ja … eigentlich wäre es ganz gut, sie hier zu behalten, um sicherzugehen, dass du keine Dummheiten anstellst, aber ich weiß ja, dass du sonst doch keine Ruhe geben wirst. Ich schlage also vor, sie kann gehen, wohin sie will. Entweder sie bleibt hier bei dir oder sie geht zusammen mit deinen Freundinnen, so lange du auf meine Bedingungen eingehst. Einverstanden? Da sollte es doch wirklich nichts mehr zu überlegen geben. Deinen Freundinnen passiert nichts und aus dir wird eine Prinzessin.«
Doch das sah Lilly ein wenig anders. Auf der einen Seite war sie ernsthaft versucht, dieses Angebot anzunehmen. Sie hätte alles getan, nur um Lisa in Sicherheit zu wissen, sogar ihr Leben hätte sie gegeben, wenn sie nur überzeugt gewesen wäre, dass Sinistra die Wahrheit sagte. Immerhin hatte sie oft genug unter Beweis gestellt, wie hinterhältig und grausam sie war. Was sie Lilly und auch Lisa bereits angetan hatte, war unverzeihlich, und Lilly hatte keinen Zweifel daran, dass sie zu allem bereit war, wenn sie auch nur die leiseste Spur von Ungehorsam zu entdecken meinte. Sie hatte Lisa das Zeichen von Unomnia eingeritzt und damit mehr als deutlich gemacht, dass ihr deren Schicksal nicht das Geringste bedeutete, wie hätte Lilly unter solchen Umständen auch nur ein Wort aus ihrem Mund für glaubwürdig halten sollen? Darüber hinaus hatte sie vorhin gesagt, nur das Beste für Lilly zu wollen, und Personen, die das von sich behaupteten, war grundsätzlich nicht zu trauen, denn woher nahmen sie das Recht, für andere entscheiden zu können, was gut für sie war? Es gab so viele unterschiedliche Lebensentwürfe, die alle ihre Daseinsberechtigung besaßen, und am Ende hatte ohnehin jeder ganz individuelle Vorstellungen von Glück.
Das alles führte zu einer unausweichlichen Entscheidung. »Tut mir leid«, sagte sie, ohne jedes Bedauern in der Stimme, »aber ich fürchte, ich muss ablehnen.«
»Bist du dir sicher?«, fragte Sinistra nach. »Ich denke, du schätzt da die Konsequenzen deines Beschlusses nicht richtig ein.«
Finster starrte Lilly sie an. »Was willst du denn tun? Mich umbringen? Dann bekommst du auch nicht, was du willst.«
»Wie kommst du denn darauf? Ich würde dich doch nie umbringen, du bist schließlich meine Tochter! Allerdings sollte dir bewusst sein, dass ich so meine Mittel und Wege habe.«
Fast schon mitleidig, aber mit wachsamen Augen schüttelte Lilly den Kopf. »Sieh es endlich ein, du kannst mich nicht dazu zwingen, deine Nachfolge anzutreten, und alles Leid, das du mir oder meinen Freundinnen noch zufügen willst, wird nur dazu führen, dass ich erst recht nicht tue, was du von mir verlangst. Und jetzt werde ich da rüber gehen, Lisa aus diesem Käfig befreien und dann zusammen mit ihr und den anderen nach Hause gehen, und nichts, was du tust, wird mich davon abhalten.«
Sie machte einen Schritt nach vorn, auf Sinistra zu, doch die ging ihr nicht aus dem Weg. Stattdessen hob sie ein Hand und zeigte auf sie, während sie zu ihren Wächterinnen sagte: »Fasst sie!«
Die Wächterinnen brachten ihre Speere dichter an Lilly heran und versuchten, ihr den Weg zu versperren, aber die hatte ihre Warnung vorhin nicht leichtfertig ausgesprochen, sondern genau so gemeint, wie sie es gesagt hatte: Nichts würde sie nun mehr aufhalten. Ohne dass auch nur ein Muskel in ihr gezuckt hätte, entfesselte sie ihre Schattenkräfte. Die hatte sie mittlerweile schon viel besser unter Kontrolle als damals, als sie zum ersten Mal, angetrieben durch ihre Wut, ihre Trauer und ihr Entsetzen wie von selbst aus ihr hervorgebrochen waren. Statt einen spitzen Stachel zu formen, achtete sie jetzt darauf, einen möglichst großflächigen und schwachen Angriff zu starten, um niemanden zu verletzen. Blitzschnell sammelte sie die Finsternis vor sich und stieß sie dann explosionsartig vorwärts, sodass sie wie eine Druckwelle davonflog und alles in ihrem Weg mit sich riss.
Ironischerweise blieb das Ergebnis jedoch dasselbe. Wie von einer gewaltigen Sturmböe ergriffen taumelte Sinistra zurück, genau in den Wall erhobener Speere hinein, die ihre Leibgarde hinter ihr errichtet hatte. Drei der Klingen bohrten sich auf einmal in ihren Rücken, und offenbar war die Wucht des Aufpralls so stark, dass sie ihren Körper vollständig durchdrangen und auf der anderen Seite wieder aus ihrem Brustkorb herausstachen. Allerdings ragte nur eines der Blätter zur Gänze hervor, ein anderes steckte in einem Rippenbogen fest und das letzte hatte zwar eine der Lücken zwischen zwei Rippen erwischt, dabei aber zu viel kinetische Energie verloren, sodass nur die äußerste Spitze gerade eben die Haut durchschnitt.
Darauf folgte eine Phase absoluter Stille. Niemand bewegte sich, die Wächterinnen, Lilly, der Rest des Freak-Clubs, sie alle waren zu geschockt, um auch nur einen Finger rühren zu können. Sogar Sinistra brachte mit ihren durchlöcherten Lungen nicht mehr als ein ersticktes Röcheln hervor und konnte nichts weiter tun als zitternd zu versuchen, eine Schulter abzuwenden, um sich von den Speeren loszureißen, ohne damit auch nur ansatzweise Erfolg zu haben. Schließlich sackte sie in sich zusammen und ihr rasselnder Atem verstummte endgültig. So hätte man meinen können, die Zeit an sich wäre stehen geblieben, wäre da nicht das Blut gewesen, das stetig von den aus Sinistras Brust hervorstehenden Speerspitzen tropfte sowie das Platzen der rot gefärbten Speichelbläschen an ihren Mundwinkeln.
Selbst in diesem verstörten Zustand begriff Lilly sofort, dass es dieses Mal keine Wiederauferstehung für Sinistra geben würde. Als sie vor einigen Monaten von einem von Lilly heraufbeschworenen Schatten gepfählt worden war, war sie ja nicht wirklich getötet worden, da hatte sie nur zu viel Kraft verloren, als dass sie ihre Existenz in einem fremden Universum weiter hätte aufrecht erhalten können, und ihr Körper war zurück in den Limbus gezogen worden. Das war jetzt natürlich nicht der Fall. Wenn eine Dämonin im Limbus starb, war das unwiderruflich. Doch auch wenn ihr das nicht bewusst gewesen wäre, hätte es genügend Anzeichen dafür gegeben. Anders als damals schien ihr Körper nicht zu verglühen, sie hing nur leblos in der Luft, einzig gehalten von den Speeren der Wächterinnen, die noch immer wie versteinert dastanden und erschrocken ihre im doppelten Sinne abgetretene Königin anzustarren. Ihr Blut verschwand ebenfalls nicht spurlos, in Ritzen versickernd und so durch die fadenscheinigen Verbindungen zwischen den Welten abgeflossen, stattdessen quoll es aus ihren Wunden, rann zu Boden und sammelte sich dort auf den Steinplatten zu einer sich immer weiter ausdehnenden Pfütze.
Dieses eindringliche Rot, das in Kontrast zu den grauen Felsblöcken, aus denen der Palast gebaut war, beinahe übernatürlich wirkte, wie das Eindringen einer fremden Macht in diese Realität, ließ Lilly wieder zu sich kommen. Während alle anderen noch die eigene Bestürzung niederkämpften, musste sie handeln, wurde ihr schnell klar. Jeden Moment würden die Wächterinnen ihre Fassung wiedergewinnen, und dann sollte sie besser nicht mehr hier sein. Zwar war sie nicht sicher, ob sie als Halbdämonin im Falle ihres Ablebens im Limbus einfach wieder auf der Erde landen würde, wo sie immerhin geboren war, doch war das eine Frage, deren Antwort sie nicht unbedingt durch praktische Erfahrung herausfinden wollte.
»Los, zurück ins Internat!«, rief sie ihren Freundinnen zu, dann, bevor irgendjemand reagieren konnte, hüllte sie sich mit einer Drehung in Schatten ein und löste sich in ihnen auf, tauchte aber sofort wieder neben Lisa in dem Käfig auf, nahm sie bei der Hand, zog sie zu sich in die Dunkelheit und gemeinsam ließen sie sich von ihr nach Hause bringen.
Nachdem Nicole ihr beigebracht hatte, was zu tun war, ging der eigentliche Übergang zwischen den Welten ganz einfach vonstatten. Es war wie ein Blinzeln; einen kaum wahrnehmbaren Moment lang waren sie von Finsternis umgeben, dann standen sie plötzlich wieder auf der Waldlichtung in der Nähe des Internats, von der ihre Rettungsmission ihren Ausgang genommen hatte. Als erstes versicherte Lilly sich mit einem kurzen Blick, dass Lisa unverletzt war, und sie hätte nichts lieber getan, als sie zu fragen, ob auch tatsächlich alles in Ordnung mit ihr war, doch das musste noch warten, bis wenigstens dafür gesorgt war, dass auch die anderen nicht mehr in Gefahr waren. Nur am Rande hatte Lilly mitbekommen, wie Maria aufgesprungen war, als sie hier so unvermittelt wieder erschienen waren. Sie hatte auf einem Stein gesessen und auf ihre Rückkehr gewartet, ohne mehr zu tun zu haben als sich auszumalen, was ihnen alles passieren könnte. Doch jetzt bemerkte Lilly sie, ebenso wie das nervöse Zucken in ihrem Gesicht, als wäre sie bereit, jederzeit in Tränen auszubrechen, sei es nun vor Glück oder Erleichterung.
»Keine Sorge, es geht allen gut«, beruhigte sie Maria und in gewisser Weise wohl auch sich selbst, war das bislang doch eher eine Hoffnung als genaues Wissen. Immerhin bewahrheitete sich ihre voreilige Behauptung ein Stück weit, als Fantasma und die Zwillinge sich auf der Lichtung materialisierten, nun musste sie sich beeilen, auch noch den übrigen Teil Wirklichkeit werden zu lassen. Zum Glück bedurfte es dazu nicht viel. Sie schloss die Augen und konzentrierte sich nacheinander auf das charakteristische Muster aus Schatten ihrer Freundinnen, die ihnen auf dem Weg zu Lisas Gefängnis abgängig geworden waren. Zwar hatten sie es versäumt, das im Vorhinein auszumachen, doch war es wohl deutlich erkennbar als Zeichen, dass sie zu ihr kommen sollten. Nicht von ungefähr hatte sich das im Limbus als gängige Praxis herausgebildet, jemanden zu sich zu bestellen. Man spürte es eben, wenn jemand in so substanzieller Weise zu einem Kontakt aufzunehmen versuchte. Dann war es ein Leichtes, durch die Schatten gleich zu dieser Person zu reisen. Lilly wusste nicht, wie es um Emma oder Isabelle stand, doch das zumindest Emilia bestens mit dieser Methode vertraut war, stand außer Frage.
Ob sie es nun kannten, oder einfach nur instinktiv die richtigen Schlüsse zogen, jedenfalls erschienen alle drei ohne weitere Verzögerung. Eine nach der anderen traten sie aus irgendeinem Schatten eines Baumes und versammelten sich auf der Lichtung, wo die Vögel noch immer zwitscherten als wäre nichts geschehen und wo es jetzt, am späten Nachmittag, noch heller war als zuvor. Sie selbst sahen jedoch im Gegensatz dazu alle miteinander reichlich abgekämpft aus. Die Haare hingen ihnen in nassen Strähnen in die Stirn, ihre Schultern und Köpfe hingen schlaff hinab und in ihren Mienen war nichts als unendliche Erschöpfung zu lesen. Immerhin kehrten sie aus einer Schlacht zurück, und obwohl sie die gewonnen hatten, und keine von ihnen einen ernsthaften Schaden davongetragen hatte, hatte dieser Sieg unter harten Bedingungen errungen werden müssen. Emma hatte die Wächterinnen am Tor zweifellos mithilfe sexueller Dienstleistungen bestochen, damit ihre Gruppe überhaupt auf das Gelände in der Nähe des Palasts gelangen konnten und Emma hatte sich bereit erklärt, sich um drei werwolfähnliche Bestien zu kümmern, zu deren Pflege es auch gehörte, sich von ihnen besteigen zu lassen.
Emilia schien es besonders schwer getroffen zu haben. Zwar wusste Lilly nicht genau, was sie auf sich genommen hatte, aber sie sah aus, als hätte sie in einem See aus Sperma gebadet. Dennoch kam es Lilly vor, als hätte deren Niedergeschlagenheit gar nicht so viel damit zu tun, dass sie offenbar von einer nicht zu unterschätzenden Menge an Dämoninnen angespritzt worden war, sondern schien noch tiefer zu gehen. Sie wirkte eher wie jemand, dem in aller Grausamkeit das Herz gebrochen wurde, als hätte ihre beste Freundin, der sie rückhaltlos vertraut hatte, ihr die Freundin ausgespannt, als wäre sie nicht nur betrogen, sondern auch noch auf schlimmste Weise hintergangen worden. Egal, was ihr im Limbus widerfahren war, dafür konnten keine fremden Dämoninnen verantwortlich sein, das wäre eine andere Art Schmerz gewesen, so am Boden zerstört konnte sie nur sein, wenn jemand, den sie liebte, sie verraten hatte. Bei allen anderen wäre sie einfach nicht so fassungslos gewesen, sie erwartete ja schlicht, dass man ihr mit böswilligen Absichten begegnete.
Lilly konnte gar nicht anders, als sich um sie die meisten Sorgen zu machen, was zum Teil daran liegen mochte, dass sie nun einmal ihre Halbschwester war, doch vor allem lag es darin begründet, dass sie ihre Schwäche noch nie offen gezeigt hatte wie jetzt. Es war nicht zu übersehen, dass Emilia schon immer unter Ausgrenzung hatte leiden müssen, und dass diese Ablehnung sie ein natürliches Grundmisstrauen gegenüber Menschen hatte entwickeln lassen war nur zu verständlich, trotzdem war ihr sonst so allgegenwärtiger Sarkasmus ohne Frage nicht nur ein Zeichen der desillusionierten Misanthropie einer Idealistin, deren Glaube an das Gute in der Welt längst erschüttert war, er war außerdem eine Schutzmauer, die sie um sich herum aufgebaut hatte. Lilly war sich sicher, dass Emilia tief in ihrem Inneren noch weitaus verwundbarer war als ihre übrigen Clubkameradinnen – die alle ähnliche Erfahrungen gemacht hatten –, ja sogar noch verwundbarer als Maria, doch um das zu verbergen, überspielte sie ihre Unsicherheit mit einem trockenen zynischen Humor, der sie wohl unerschrocken und emotionslos erscheinen lassen sollte. Doch hier war diese Fassade gefallen; hier wirkte sie auf einmal wie ein kleines Mädchen, das sich verlaufen hatte und bloß noch in die Geborgenheit der Arme ihrer Mutter zurückfinden wollte.
Das hielt Maria aber nicht davon ab, ihr vor Freude, sie endlich wiederzusehen, um den Hals zu fallen. Glücklich schmiegte sie sich an sie, und das hellte Emilias düstere Gedanken sichtlich auf. Leise seufzend erwiderte sie die Umarmung, und als sie langsam ausatmete, stahl sich ein verhaltenes Lächeln auf ihre Lippen, als hätte sie nun erkannt, das nichts, was im Limbus geschehen war, noch länger von Bedeutung war, jetzt da sie wieder mit Maria vereint war.
Auch die Anderen waren inzwischen paarweise oder in kleinen Gruppen zusammengekommen, wie Lilly bemerkte. Fantasma hielt Emmas Hand umklammert und Isabelle stand bei den Zwillingen. Sie redeten alle miteinander, aber nichts davon ging über das Geflüster in einer Kirche hinaus, kurz bevor die Predigt begann. Es war kein Gelächter zu hören, wie sonst, wenn sie beisammen waren, und niemand schien das Bedürfnis zu haben, ihre erfolgreiche Rückkehr zu feiern. Vielmehr lag Melancholie in der Luft, die seltsame Atmosphäre einer Totenwache, irgendwo zwischen ehrfürchtiger Andacht und dem wohligen Gefühl, wieder mit Verwandten zusammen zu sein, die man lange nicht gesehen hatte.
Erst jetzt, als sie sah, wie alle ihre Freundinnen an einem Ort waren, an dem ihnen nichts passieren konnte, und sie die Ereignisse bereits zu verarbeiten begannen, erlaubte Lilly es sich, sich ein wenig zu entspannen. Sie wollte sich an Lisa wenden, und ihr endlich die Frage stellen, die ihr so auf der Seele brannte, doch plötzlich konnte sie sich keinen Augenblick länger auf den Beinen halten. Es war, als wäre sie eine Marionette, der die Fäden durchtrennt worden waren. Ihr knickten die Knie ein und sie ließ sich auf den Boden fallen, schlug die Beine untereinander und stützte den Kopf auf die Hände. In dieser Haltung blieb sie hocken, unfähig auch nur einen Muskel zu bewegen.
Dabei war es nicht einmal so, dass sie körperlich ausgelaugt wäre. Natürlich war es anstrengend gewesen, mit ihren Kräften in eine andere Welt zu reisen und dort durch die ewig langen Gänge eines verworrenen Palasts zu irren, doch das war es nicht, was sie nun so fertigmachte. Vor allem fühlte sie sich emotional ausgebrannt. Ihre Nerven waren eben den gesamten Nachmittag über bis zum Zerreißen gespannt gewesen, jede einzelne Sekunde hatte sie sich Sorgen um Lisa gemacht, sie hatte sich Vorwürfe gemacht, weil sie nur ihretwegen überhaupt entführt worden war, und gleichzeitig hatte sie sich verantwortlich für ihre Freundinnen gefühlt, die sie begleitet hatten. Es war, als wäre konstant Strom durch sie geflossen, so gering, dass sie es gar nicht richtig wahrgenommen hatte, der aber trotzdem ihr Herz schneller schlagen ließ und sie unterschwellig zittern ließ, doch nachdem der abgeebbt war, merkte sie, dass er das Letzte gewesen war, was sie noch am Funktionieren gehalten hatte. Furcht um alle, die ihr nahe standen, hatte ihr ganzes Denken beherrscht, sodass ihr erst jetzt wirklich die Tragweite dessen bewusst wurde, was sie getan hatte: sie hatte ihre eigene Mutter umgebracht.
Sicher, wenn man einen Sinn für Spitzfindigkeiten hatte, konnte man behaupten, dass es die Wächterinnen mit ihren Speeren waren, und dass es Sinistra selbst gewesen war, die sie mit diesen Waffen ausgestattet und sie dort positioniert hatte, wo sie in sie gestürzt war, oder dass es niemals wo weit gekommen wäre, wenn sie nicht alles daran gesetzt hätte, ihre Tochter nach ihren Vorstellungen zu formen, doch so selbstgerecht war Lilly nicht, dass sie sich das hätte einreden können. Ihr Gewissen war unbeugsam, und es bestand darauf, dass sie die volle Schuld am Tod ihrer Mutter traf. Immerhin war es ihre Macht über die Schatten gewesen, die sie zu Fall gebracht hatte, und die so dafür gesorgt hatte, dass sie von Speeren durchbohrt worden war.
Wie hatten die Dinge nur so außer Kontrolle laufen können? Ja, was Sinistra getan hatte, war keinesfalls zu entschuldigen, und Lilly verabscheute sie dafür aus tiefster Seele, dennoch, das hatte sie nicht gewollt. Was sollte sie denn jetzt nur tun? Es war ein Unfall gewesen, aber das machte es nicht viel besser. Von nun an würde sie für immer mit dem Wissen leben müssen, jemanden getötet zu haben. Das würde sie nie vergessen können, schon jetzt quälten sie die Erinnerungen an das ungläubige Gesicht ihrer Mutter, als die messerscharfen Speerspitzen in ihren Rücken drangen, an das Blut, das wie ein rot glänzender See zu ihren Füßen herum ausgebreitet lag, und vor allem an ihr verzweifeltes Schnappen nach Luft, als sie zu atmen versucht hatte, ihre nunmehr undichte Lunge sich aber einfach nicht mit Sauerstoff füllen lassen wollte. Keine Buße würde ausreichen, um diese Sünde von ihren Schultern zu heben. Egal wie sehr Sinistra eine Strafe verdient hatte, stand es Lilly nicht zu, sie zu verhängen und schon gar nicht, sich gleich zur Henkerin aufzuschwingen. Dafür konnte sie schlicht keine Vergebung erwarten.
»Nein«, hörte sie plötzlich eine Stimme neben sich, die bestimmt und gleichzeitig doch sanft klang, »das werde ich nicht zulassen.«
Es war Lisa, die sich nun unmittelbar an ihrer Seite niederließ. So aus ihren düsteren Gedanken gerissen, wandte Lilly ihr den Kopf zu. »Was lässt du nicht zu?«, fragte sie nach. Es konnte damit zusammenhängen, dass sie bis eben noch völlig davon ausgelastet gewesen war, geistig eine Anklageschrift gegen sich selbst vorzubereiten, aber sie hatte das Gefühl, irgendetwas nicht mitbekommen zu haben.
Doch das war nicht der Fall, wie sie Lisas nun folgenden Worten entnehmen konnte. »Mir kannst du nichts vormachen, ich sehe doch, was in dir vorgeht. Du gibst dir selbst die Schuld an allem, und das lasse ich nicht zu. Glaub mir, die Welt ist einfach ist einfach nur ein besserer Ort, alleine dadurch, dass Sinistra nicht mehr da ist.«
»Ich sage ja nicht, dass sie es nicht verdient hat, aber das rechtfertigt doch keinen Mord!«
»Es war kein Mord«, warf Isabelle sachlich ein. »Der Tatbestand eines Mordes ist nur erfüllt, wenn du von Vorneherein die Absicht hattest, jemanden zu töten, ansonsten ist es Totschlag. Aber soweit ich das verstanden habe, hattest du ja nicht einmal vor, Sinistra zu töten, sondern es ist durch dein Einwirken auf die äußeren Umstände passiert, deswegen ist es wohl eher fahrlässige Tötung.«
»Du warst doch gar nicht dabei«, entgegnete Lilly.
»Stimmt, Nicole und Nadine haben mir eben erzählt, was in meiner Abwesenheit vorgefallen ist.«
»Na gut, aber das macht ja wohl keinen Unterschied. Mord oder fahrlässige Tötung, das sind doch bloß juristische Winkelzüge, aber letzten Endes geht es darum, dass ich jemanden umgebracht habe und das nicht wiedergutzumachen ist.«
»Ja, macht nur den völlig marginalen Unterschied zwischen fünf Jahren und lebenslänglich«, gab Isabelle in vor Ironie triefendem Tonfall zu, wurde damit aber komplett ignoriert.
»Isabelle hat recht – auf ihre Weise«, übernahm nun wieder Lisa die Verteidigung. »Was du getan hast, war ein Versehen. Du hast dein Bestes getan, die Situation auf friedliche Weise zu entspannen. Es war einzig Sinistra, von der die Aggression ausging, du hast dich nur gewehrt … oder eigentlich nicht mal das. Du wolltest nur an ihr vorbeigehen, um mich zu retten, aber sie hat sich dir in den Weg gestellt und dir so keine andere Wahl gelassen, als sie ein bisschen zur Seite zu drängen. Dass sie dabei unglücklich gefallen ist, dafür kannst du nichts.«
»Das kann ja alles sein, trotzdem hätte sich das anders lösen lassen müssen. Ich hätte einfach auf ihre Forderungen eingehen sollen.«
»Nein, das hättest du nicht. Sie hatte kein Recht dazu, über dich bestimmen zu wollen, und sie hatte vor allem kein Recht dazu, mich gegen meinen Willen festzuhalten, um ihre Ziele mit Gewalt durchzusetzen. Ganz ehrlich, für mich bist du eine Heldin!«
»Aber …«
»Kein aber«, unterbrach Lisa sie. »Du musst es auch von der Seite sehen: Sie hat dich über Jahre hinweg missbraucht, sie hat Mias Mutter immer wieder missbraucht, Mia selbst war für sie sie nie mehr als ein Mittel zum Zweck, und das sind nur die ihrer Opfer, von denen wir wissen. Also sag, was du willst, aber ich finde, es wurde Zeit, dass ihr jemand Einhalt gebietet. Und dabei spreche ich jetzt gar nicht von Rache, ich meine, wer weiß, wem sie noch alles etwas angetan hätte, wenn du sie nicht aufgehalten hättest. Im Grunde war das doch nichts anderes, als das Stauffenberg-Attentat. Wer würde heute denn nicht Hitler töten, wenn er die Chance dazu hätte? Du hast damit also mit Sicherheit noch mehr Menschen gerettet als nur mich und dich und Mia.«
Eine lange Zeit schwieg Lilly, den Kopf gesenkt und zu Boden starrend. Als sie wieder aufblickte, lief eine einzelne Träne ihre Wange hinab, die jedoch weder etwas mit Sinistras Tod zu tun hatte, noch mit ihren Schuldgefühlen diesbezüglich; es war Lisas Hingabe derentwegen sie weinte, ihren unermüdlichen Versuch, ihren Schmerz zu lindern, aber so gern sie es auch getan hätte, konnte sie ihr nicht einfach zustimmen und Trost in ihren Armen suchen. Es war wie ein innerer Zwang, der sie dazu antrieb, sich Lisa zu erklären. Sie wollte, dass sie ganz genau verstand, wie elend ihr zumute war, vielleicht weil sie sich im Moment nicht vorstellen konnte, dass es ihr jemals wieder besser ginge, oder vielleicht weil sie wider aller Wahrscheinlichkeit hoffte, dass, wenn Lisa alle ihre Punkte hörte und ihr dennoch vergab, sie sich auch selbst verzeihen konnte.
»Aber war das wirklich angemessen?«, sagte sie schließlich. »Hätte man sie nicht anders aufhalten sollen? Ist die Todesstrafe nicht barbarisch und rückständig?«
Langsam hob Lisa eine Hand und wischte mit einer unendlich zarten Berührung die Träne aus Lillys Gesicht. »Schon gut, ich weiß ja, was du durchmachst. Du trägst sogar Spinnen in deiner Hand raus und setzt sie im Garten aus, statt wie ich aus möglichst größter Entfernung ein Buch nach ihnen zu werfen und danach sicherzustellen, dass sie auch wirklich tot sind. Außerdem hast du schon recht, die Todesstrafe ist auf keinen Fall gutzuheißen, nicht einmal bei jemandem wie Sinistra, trotzdem kann ich nicht behaupten, dass es mir leid tun würde, dass sie jetzt tot ist. Du ahnst ja gar nicht, wie viel Angst ich heute Nachmittag hatte, Nach dem, was sie damals mit mir gemacht hatte, mit uns beiden, und als sie mich dann in diesen Käfig gesperrt hatte … da dachte ich schon, dass es wieder geschehen würde, nur noch viel, viel schlimmer. Da waren so viele Dämoninnen in diesem Saal … Na ja, was ich sagen will, ist, dass ich mich jetzt sehr viel sicherer fühle, da ich weiß, dass sie mir nie mehr etwas antun kann, und es ist auch beruhigend zu wissen, dass sie niemand anderem mehr etwas tun kann. Also verzeih bitte, dass ich nur wenig Mitleid für sie aufbringen kann. Natürlich wäre es schöner, wenn es anders ausgegangen wäre. In einer idealen Welt hätte Sinistra möglicherweise ihre Fehler eingesehen und geschworen sich zu bessern, aber glaubst du wirklich, dass sie das jemals getan hätte? Letzten Endes hat sie es sich selbst zuzuschreiben, dass es so gekommen ist und überhaupt, jetzt ist es sowieso nicht mehr zu ändern. Wir müssen uns damit abfinden, dass sie gestorben ist, und um ehrlich zu sein, wird mir das nicht allzu schwer fallen.«
»Das ist es ja gerade«, beharrte Lilly. »Sie ist tot und das kann nie mehr rückgängig gemacht werden. Auch wenn sie sich wohl nicht geändert hätte, berechtigt es doch niemanden, ihr Leben zu beenden. Und egal wie sehr man sich das schönreden will, habe ich genau das getan, ob absichtlich oder nicht. Bin ich dann nicht … bin ich dann nicht genau wie sie?«
»Quatsch! Wie kommst du denn darauf?«
»Na ja, sie wollte unbedingt meine Persönlichkeit ändern, und hat dafür grausame Taten begangen, und ich wollte, dass sie einsieht, dass es zwecklos ist, mich bekehren zu wollen, ich wollte sie also ebenfalls ändern, und letztlich hat sie dadurch den Tod gefunden.«
»Aber das kannst du doch nicht miteinander vergleichen! Sie wollte eine vollständige Kontrolle über dich erlangen, sie wollte Stück für Stück deine gesamte Seele auslöschen, und um das zu erreichen, hat sie einen detaillierten Plan ausgearbeitet, der darauf hinauslief, dich systematisch immer wieder zu missbrauchen, und als das nicht geklappt hat, hat sie sich auch noch an mir vergangen. Dass du sie davon abhalten wolltest, ist doch wohl nur natürlich! Okay, das Ganze ist dann ein wenig aus dem Ruder gelaufen, aber wie ich schon sagte, dafür kannst du nichts.«
»Aber hätte es denn wirklich so weit kommen müssen? Ihr Angebot klang doch durchaus annehmbar. Ich wäre Königin geworden, alle anderen hätten den Limbus wieder sicher verlassen können und sogar du hättest dir aussuchen können, ob du mit den anderen gehen wolltest oder bei mir bleiben. Aber ich wollte eben nicht, dass sie gewinnt, dass sie weiter Einfluss auf mich hat. Wenn ich nicht so stur gewesen wäre, würde sie noch leben.«
»Lilly, das hatten wir doch schon. Sie hätte das einfach nicht tun dürfen.«
»Ich weiß, aber wenn du es dir mal genauer überlegst …, ist es dann nicht bezeichnend, dass ausgerechnet ich so reagiert habe, dass Sinistra dabei umgekommen ist, obwohl die meisten anderen so gehandelt hätten, dass niemand zu Schaden gekommen wäre?«
»Wie meinst du das?«
»Ich bin nun mal Sinistras Tochter, ich habe ihre Gene. Egal wie sehr ich mich auch dagegen wehre, ein Teil von ihr ist in mir. Ist es da nicht logisch, dass ich in der Situation genau so unnachgiebig war wie sie? Und ist in mir dann nicht auch etwas Böses, das nur darauf wartet herauszukommen?«
»Moment«, hakte sich jetzt wieder Isabelle ein, »ganz so funktionieren Gene auch wieder nicht. Zwar ist es richtig, dass ein Teil von Sinistra auch in dir steckt, so leid es mir auch tut, das sagen zu müssen. Du hast jedenfalls ganz sicher ihre Haarfarbe und die Augenfarbe von ihr geerbt. Die Gene bestimmen nun einmal viel vom allgemeinen Aussehen, daher spricht man ja auch von Familienähnlichkeit, außerdem legen sie einige grundlegende Persönlichkeitszüge fest, zum Beispiel ob man eher introvertiert oder extravertiert ist, ob man offen für Neues ist, oder mehr zur Routine neigt, und sogar die Intelligenz und die Vorstellungskraft beruhen bis zu einem gewissen Grad – also innerhalb welchen Spektrums man sich entwickeln kann – auf Veranlagung. Aber das heißt nicht, dass du dazu verdammt wärst, so zu werden wie deine Mutter. Du hast immer eine Wahl, du kannst dich frei für das Gute entscheiden oder für das Böse. Da stehen dir höchstens die Befangenheit deiner Gedanken im Weg oder äußere Einflüsse wie gesellschaftliche Konventionen, beziehungsweise das Abwägen von Vorteilen egoistischen Handelns gegenüber möglichen Nachteilen, wenn du einem grenzenlosen Hedonismus anhängst. Dass du nicht auf Sinistras Angebot eingegangen bist, liegt eben daran, dass du einen starken moralischen Kompass hast, und daran ist nichts falsch. Du hast einfach ganz andere Werte als sie und für die trittst du mit aller Macht ein. Ich finde, das ist eine durchweg positive Charaktereigenschaft, keine negative.«
»Siehst du?«, fragte Lisa. »Du brauchst keine Angst zu haben, du bist ganz sicher nicht wie Sinistra. Und von uns ist ganz sicher niemand der Meinung, dass du Unrecht getan hättest, oder?« Mit dem letzten Wort blickte sie über die Schulter zurück, wo der Rest des Freak-Clubs stand. Als alle einhellig nickten und zustimmendes Gemurmel zu hören war, wandte sie sich wieder Lilly zu. »Also, geht es dir jetzt besser?«
»Ja«, sagte Lilly, ein Schniefen unterdrückend. »Danke, Isabelle, danke euch allen und … ganz besonders danke ich dir.« Die Hand, mit der Lisa ihr die Träne von der Wange gewischt hatte, lag mittlerweile auf ihrer Schulter, und nun ließ Lilly sich endgültig in deren Arme sinken. Ihre Bedenken waren nicht völlig verflogen, sie machte sich immer noch Vorwürfe wegen Sinistras Tod, und sie hatte nur wenig Hoffnung, dass die jemals aufhören würden, aber wenigstens hatte sie endlich wieder das Gefühl, Lisa umarmen zu dürfen, dass sie es wert war, geliebt zu werden. Dementsprechend rückhaltlos drückte sie sich jetzt an ihre Freundin. Es mochte stimmen, dass sie heute Lisa gerettet hatte, aber wenn dem so war, hatte die sie ebenfalls gerettet, zumindest kam sie sich auf einmal befreit vor, als wäre ein tonnenschweres Gewicht an sie gekettet gewesen, das nur durch einen einzigen Schlüssel von ihr genommen werden konnte, und der war Lisas alles überdauernde Liebe zu ihr.
Ihre Erleichterung war so gewaltig, dass sie sogar noch ein paar Tränen vergoss, doch selbst durch deren Schleier, den die an ihren Wimpern bildeten, konnte sie erkennen, dass es unerwartet dunkler wurde. Zunächst dachte sie, dass bereits die Dämmerung einsetzte, oder sich eine Gewitterwolke vor die Sonne geschoben hätte, erst als sie sich von Lisa löste und sich umblickte, bemerkte sie, dass die Welt im Begriff war, aus den Fugen zu geraten.
Es war nicht so, dass das Licht von oben schwand, vielmehr war es, als würde die Dunkelheit aus dem Boden heraufkriechen. Die Schatten bedeckten das Gras der Lichtung vollständig, sodass es grau wirkte, sie flossen wie Tinte die Bäume empor, hüllten sie ein vom Stamm bis zum letzten Blatt und waberten von dort sich kräuselnden Rauchfahnen gleich in den Himmel hinauf, bis sie sich hoch über den Wipfeln zu einer geschlossenen Decke vereinigten. Als das geschehen war, kam es Lilly vor, als wäre sie in einer riesigen Schneekugel gefangen. Eine halbdurchsichtige kuppelförmige Wand hatte sich um die Lichtung herum aufgebaut, die aussah wie getöntes Glas, aber ohne Frage aus reiner Finsternis bestand. Ob sie durchlässig war, konnte sie für den Moment nicht beurteilen; um das herauszufinden hätte sie die Strecke eines Sportfelds zurücklegen müssen, doch was sie mit Sicherheit sagen konnte, war, dass innerhalb dieser Ausmaße die ganze Landschaft eine erschreckende Ähnlichkeit mit dem Limbus aufwies. Von der Dunkelheit bedeckt sah das Gras verdorrt aus, die nun im Herbst allmählich kahl werdenden Bäume ragten düster im Hintergrund empor wie das Bühnenbild eines Scherenschnitttheaters und der Himmel selbst erschien auf einmal niedrig und drohend.
Mit einem Satz sprang Lilly auf, doch noch bevor sie irgendetwas hätte tun können, brach bereits die nächste Ungeheuerlichkeit über sie herein. In der Mitte der Wiese befand sich eine Senke, in der sich die zähe Dunkelheit zu einer Pfütze angesammelt hatte, als wäre sie Regenwasser. Aus diesem schwarzen Pfuhl streckte sich nun eine Hand herauf. Eine zweite folgte, beide zusammen schlossen sich um den Rand der Senke und dann zog sich eine Gestalt daraus hervor wie aus einem Schwimmbecken. Sie setzte ein Knie auf, zog das andere Bein nach und erhob sich langsam. Anschließend stand sie da, unbeweglich, ein Schemen in dem auf unnatürliche Weise herrschenden Zwielicht. Sie stand leicht vornübergebeugt, die Arme schlaff an den Seiten herabhängend und ließ ziellos den Blick über den Wald schweifen, als wüsste sie nicht, wo sie war, oder wie sie überhaupt hergekommen war.
Die Gestalt war offenbar noch dabei sich zu orientieren, als Lilly endlich den nötigen Atem fand, um zu sprechen. »Wer bist du? Was willst du hier?«, fragte sie laut und mit einer Stimme, die fester war, als sie sich selbst zugetraut hätte.
Die in Schatten gehüllte Chimäre ließ sich Zeit mit einer Antwort. Es hatte den Anschein, als müsste sie erst mühsam den Sinn dieser Worte entschlüsseln bevor sie eine angemessene Erwiderung formulieren konnte. »Ich schätze, ihr kennt mich wohl am ehesten unter dem Namen Unomnia.«
Scharf atmete Lilly ein. Damit hatte sie nicht gerechnet. Sie hatte eigentlich angenommen, sich einer Dämonin aus dem Limbus gegenüberzusehen, wahrscheinlich einer Offizierin der Palastwache, die Sinistra rächen wollte, doch stattdessen hatte sie es mit einer angeblichen Göttin zu tun. Schon oft hatte Lilly sich überlegt, wie diese unausweichliche Begegnung wohl ablaufen würde, zumeist in schlaflosen Nächten, wenn sie neben Lisa im Bett lag, aber als es nun so weit war, wusste sie beim besten Willen nicht, was sie tun sollte. Mit einem Mal war ihr Kopf wie leergefegt. Was sollte man denn schon sagen, wenn man sich plötzlich im Beisein einer mehr oder weniger mythologischen Figur wiederfand, die gekommen war, um die eigene Freundin einem unbekannten Schicksal zuzuführen? Lilly hatte keine Ahnung, Aber selbst wenn, bezweifelte sie, dass sie zu mehr imstande gewesen wäre, als eine wenig überzeugende Drohung hervorzustammeln.
Inzwischen war es Unomnia gelungen, ihre Augen zu fokussieren. Ihre Miene blieb abwesend, als wäre sie im Geiste zusätzlich noch mit einer hochkomplexen Aufgabe betraut, die ihre volle Konzentration beanspruchte, dennoch richtete sich ihr Blick mit einer unvermittelt klaren Intensität, die man ihr gar nicht zugetraut hätte, auf Lisa. »Wegen dir bin ich gerufen worden, nicht wahr?«, sagte sie mit einer Stimme, die ähnlich ihrem Blick ebenso traumwandlerisch wie eindringlich war.
Diese Aufmerksamkeit auf sich zu spüren, und sei sie auch noch so flüchtig, war, als würde man vom Blitz getroffen werden. Das ging nicht nur Lisa so, alle Mitglieder des Freak-Clubs hatten das Gefühl, als hätten sich sämtliche ihrer Muskeln auf einmal verkrampft, sodass sie sich unmöglich rühren konnten. Sie waren so gebannt wie Rehe im Scheinwerferlicht eines auf sie zurasenden Autos, und diese Starre fiel selbst dann nicht von ihnen ab, als Unomnia mit langsamen gemessenen Schritten auf sie zu kam wie ein Messias, der zu einer Predigt vor seinen Apostel antrat. Allerdings wäre der Gedanke an eine Flucht wohl ohnehin sinnlos; es gab kein Versteck, in dem man sicher vor ihr wäre, früher oder später kam sie zu jedem, der ihr Zeichen trug, egal in welchem Universum er sich aufhielt, oder mit wie vielen Armeen er sich zu seinem Schutz umgab. Ob diejenigen, die sie mit sich nahm, nun starben oder nicht, ein Vergleich drängte sich förmlich auf: sie rückte so unaufhaltsam näher wie der Tod, der letztlich doch ausnahmslos jeden ereilte, so sehr man sich auch dagegen wehren mochte.
Unverwandt starrte Lilly ihr entgegen. Sie verschloss die Augen eben nicht vor unbequemen Wahrheiten, sondern versuchte, möglicherweise auftretende Komplikationen frühzeitig zu erkennen, um sich auf sie vorbereiten zu können, und so analysierte sie jede Kleinigkeit, die sie an Unomnia entdecken konnte, diesem Verhängnis, das wie ein Damoklesschwert über ihren Geliebten geschwebt war, und das nun tatsächlich auf sie herabstürzte.
Je weiter sie voranschritt und je weiter sie damit aus den Schatten der Bäume trat, desto mehr Details konnte Lilly nun an ihr ausmachen. So war es unverkennbar, dass sie die Herrin der Dunkelheit war. Was Lilly zuerst nur dem Umstand zugeschrieben hatte, dass sie in der Düsternis des Waldes gestanden hatte, stellte sich beim Näherkommen schnell als Charakteristikum heraus; Unomnias ganzes Äußeres war wirklich so tiefschwarz wie eine wolkenverhangene Nacht, einzig ihre Augen strahlten silbern wie Mondlicht aus dem Dunkel ihres Gesichts hervor, und unablässig stoben Schatten um sie her. Allein ihre Anwesenheit schien sie stofflich werden zu lassen, sie kondensierten in der Luft wie Nebel, flatterten Fledermäusen gleich um sie herum, so lange sie bei ihnen weilte, und fielen schlingernd zu Boden, wenn sie vorüber war, wie trockenes Herbstlaub, das vom Wind fortgetragen wurde. Die Finsternis wurde sogar so sehr von ihr angezogen, dass sie herabsickerte, wohin auch immer sie ging, und sammelte sich zu ihren Füßen zu Pfützen, wo sie auftraten, als dürfe kein noch so geringes Licht die Reinheit ihrer archaischen Dunkelheit beschmutzen.
Sie trug keinerlei Kleidung, weshalb ihre körperlichen Merkmale noch besser zu begutachten waren. Als Erstes fiel Lilly dahingehend ihre sportliche Statur auf. Sie war groß und wirkte durchtrainiert, fast wie eine Bodybuilderin. Ihre Schultern waren breit, ihre Hüften schmal und an ihren Armen sowie an den Beinen zeichneten sich sichtbar die Muskeln ab, wie dicke Ranken, die sich um Baumstämme wickeln. Das zweite, was ihr auffiel, war der riesige Schwanz, der zwischen ihren Beinen baumelte. Wie Lillys eigener reichte auch der von Unomnia fast bis an deren Knie, wies aber ansonsten nur wenig Ähnlichkeiten auf. Wie der Rest ihrer Haut war sie auch hier so dunkel wie der schwärzeste Abgrund, sogar an der Eichel, die ein winziges Stückchen aus dem sie schützenden Mantel hervorlugte. Erst als Unomnia schon fast bei ihr angelangt war, bemerkte Lilly, dass sie völlig kahl war. Sie hatte überhaupt keine Haare auf dem Kopf, keine Schamhaare, ja, nicht einmal Augenbrauen. Doch sah es nicht so aus, als hätte sie die abrasiert, sondern als wäre einfach nie so etwas an ihr gewachsen.
Dennoch machte sie einen ganz klar femininen Eindruck. Dazu trugen natürlich nicht unmaßgeblich ihre Brüste bei, die voll und rund an ihr wogten, aber selbst ihr Gang war unglaublich grazil und elegant, wenn auch weniger im Sinne einer Königin, die auf einem Ball tanzte, sondern vielmehr wie ein Panther, der lautlos durch den Dschungel schlich. Alles in Allem konnte Lilly verstehen, wieso sie von den Dämoninnen als Göttin verehrt wurde. Sie war ohne Frage der Inbegriff all ihrer Ideale: sie war von einer unirdischen dunklen Schönheit, sie vereinte Scheinbare Gegensätze in sich und sie war so mächtig, dass sie gar nicht erst ihre Kräfte anzuwenden brauchte, um die Schatten zu kontrollieren; die taten von sich aus alles, nur um ihr zu gefallen.
Lilly hatte einmal ein Zitat von Xenophanes, einem altgriechischen Philosophen, gelesen, dass ›wenn Rinder, Pferde und Löwen Hände hätten und mit ihren Händen wie Menschen formen könnten, dann würden Pferde ihre Götter wie Pferde und Rinder ihre Götter wie Rinder formen‹. Ihr war klar, dass er es anders gemeint hatte, dass es eben unsinnig war, sich einen Gott wie einen Menschen vorzustellen, wo es doch laut Glaubensgrundsätzen nicht viele Gemeinsamkeiten gab. Warum sollte eine Wesenheit, die ein ganzes Universum nach ihren Wünschen geschaffen hatte, überhaupt fleischlich sein? Warum sollte sie eine Anatomie besitzen, die in der Wirklichkeit doch nur dazu diente, den beiden elementarsten Anforderungen des Lebens in eben dieser neu geschaffenen Welt zu genügen, der Selbsterhaltung und der Arterhaltung? Warum sollte sie ein Gehirn besitzen, wenn dessen kümmerliche Fähigkeiten doch gar nicht ausreichten, um die Dinge zu bewerkstelligen, die ihr zugesprochen wurden; warum Beine, um sich fortzubewegen, wenn sie doch angeblich allgegenwärtig war; warum Augen, wenn sie doch eigentlich alles gleichzeitig sah; warum eine Nase zum Riechen und zum Atmen; warum einen Mund zum Essen und eine Zunge zum Sprechen? Ganz zu schweigen natürlich von noch anderen, weitaus profaneren Dingen, doch hier stand Unomnia und war nicht nur im Besitz all dieser Dinge, sondern trug sogar noch die sichtbaren Auswüchse ihres Verdauungsapparats und ihrer Fortpflanzungsorgane offen zur Schau. Auch wenn das zugegebenermaßen ein ziemlich beeindruckendes Fortpflanzungsorgan war, wie passte das ins Bild einer göttlichen Entität?
Nun konnte man argumentieren, dass das nur die säkularisierte Hülle war, die sie im Umgang mit ihren Schöpfungen annahm, um deren unzureichenden Verstand nicht mit ihrer wahren Form zu überfordern, doch hatte Lilly bisher nicht gehört, dass die Dämoninnen es nötig hatten, ihren Glauben mit einer solchen Sophistik rechtfertigen zu müssen. Sinistra hatte sich nicht nur bei jedem ihrer Besuche an ihr vergangen, sie hatte daneben auch versucht, ihr die kulturellen Eigenheiten des Limbus näherzubringen. Demnach sahen sie keinen Widerspruch darin, für sie war Unomnia die vollkommene Lebensform, und musste somit eine höhere Macht darstellen, zumal sie sämtliche Streitkräfte der Dämoninnen mit einem Wischen ihrer Hand hinwegfegen konnte. Aber sie war nicht nur das mächtigste Wesen, das ihnen bekannt war, es war auch das älteste. Schon seit Urzeiten gab es im Limbus Berichte über Begegnungen mit ihr, und doch schien sie seit diesen unzähligen Generationen noch um keinen Tag gealtert.
Lilly neigte da hingegen zur Dissidenz. Sie nahm an, dass die Dämoninnen in ihren Glaubensvorstellungen den umgekehrten Weg gegangen waren, wie ihn Xenophanes beschrieben hatte. Sie hatten keine Göttin imaginiert, die sie nach ihrem Bilde erschaffen hätte, sie waren diesem Wesen unbekannter Herkunft begegnet, das ihnen äußerlich durchaus ähnelte, aber mehr noch verkörperte Unomnia eine überstilisierte Version ihrer selbst. Sie besaß alle ihre Eigenschaften, mit denen sie sich über die übrigen Spezies des Multiversums stellten, nur waren sie bei ihr bis zur Perfektion gesteigert. Kein Wunder also, dass sie eine Apotheose erfahren hatte.
Doch Lilly vermutete, dass es sich zwischen ihr und den Dämoninnen verhielt wie zwischen den Dämoninnen und den Menschen. Die Menschen hatten die Dämoninnen ja für übernatürliche Wesenheiten halten müssen, immerhin verfügten sie über Kräfte, die sie sich nicht erklären konnten und ihre Lebensspanne übertraf ihre eigen um Längen. Genau so war es den Dämoninnen ergangen, als sie auf Unomnia trafen. Sie waren es gewohnt, sich allen anderen Arten überlegen zu fühlen, nichts konnte ihnen etwas anhaben, aber Unomnia waren sie auf einmal wehrlos ausgeliefert. Das war natürlich der richtige Stoff für Legenden, und schon hieß es, dass sie seit Anbeginn der Zeit existierte, und dass sie allmächtig wäre. Für diese Theorie sprach auch, dass die Dämoninnen, die Unomnia mit sich nahm, niemals wieder zurückkehrten. So wie Menschen nicht in den Limbus reisen konnten, war es doch möglich, dass es Sphären gab, die den Dämoninnen vorenthalten blieben, und aus einer solchen musste Unomnia dann wohl stammen.
Nun waren derartige Gedankengänge ganz besonders Isabelles bevorzugtes Metier, die mit ihrer reduktionistisch geprägten Weltanschauung immerzu nach Erklärungen und Mustern in allem suchte, womit sie konfrontiert wurde, waren es das Verhalten ihrer Mitmenschen oder das Zusammentreffen mit angeblichen Gottheiten, doch in diesem Fall hatte sie diese Spekulationen bereits hinter sich. Diese ganzen Überlegungen, die Lilly gerade angestellt hatte, war sie schon ausführlich durchgegangen, als sie zum ersten Mal von Unomnias Existenz erfahren hatte und war deshalb von anderweitigen Betrachtungen vereinnahmt. Sie beschäftigte sich indessen mit den Verbindungen zwischen dem Monotheismus der Dämoninnen und ihren soziologischen Ausbildungen. So ließ sich mit dem religiösen Hintergrund vieles von dem begründen, was Isabelle mittlerweile über sie herausgefunden hatte.
Zum Beispiel waren Anhänger monotheistischer Glaubenssysteme nicht unbedingt für Inklusion und Vielfältigkeit bekannt, was sogar nachvollziehbar war. Andere Kulturen hatten eben andere religiöse Vorstellungen, und wenn sie sich nur in wenigen Belanglosigkeiten unterschieden. Wenn ihr Gott den Anspruch auf Allmächtigkeit erhob, konnte er eben keine anderen neben sich dulden, und davon sahen sich viele seiner Jünger mit fanatischem Eifer dazu berufen, Andersgläubige entweder zu bekehren oder, wenn das nicht von Erfolg beschienen war, abzuschlachten. Besonders häretisch entstandene Gemeinschaften waren stets gerne dazu bereit, die Hegemonie, von der sie sich abgespalten hatten, möglichst auszumerzen. Von Anfang an hatte die Christen versucht, das Judentum zu vernichten, der Islam tat dasselbe und sogar Katholiken und Protestanten bekriegten sich immer wieder untereinander. Damit hatten die Dämoninnen eine bequeme Legitimation gefunden, weshalb sie auf Menschen herabblicken konnten, ohne sich der kognitiven Dissonanz aussetzen zu müssen, dass das moralisch wohl kaum vertretbar war.
Auch ihre Herrschaftsform ergab unter diesem Gesichtspunkt mehr Sinn. Monotheisten bevorzugten im Allgemeinen einen starken Führer, und gleichzeitig gaben sich Autokraten bewusst gottesfürchtig, um ihre Regentschaft auf dieses Fundament zu stützen. Die Dämoninnen hatten das nur auf die Spitze getrieben, indem sie praktisch einen Wettbewerb veranstalteten, bei dem die Mächtigste unter ihnen gewann und deren totalitärem Wirken von da an keine Grenzen gesetzt waren, bis sie eines Tages besiegt wurde. Da im Limbus nur diese eine Religion bekannt war, machte sich eben auch ihre Königin die gesamte Population untertan.
Was Unomnia anbelangte, so wusste sie selbst nicht, ob sie tatsächlich eine Göttin war. In Bezug auf ihre Herkunft war sie ebenso ahnungslos wie jedes andere Lebewesen auch. Sie lebte jetzt schon so lange, dass die Ereignisse in ihrem Kopf sich immer mehr vermischten. Manchmal war sie sich nicht sicher, ob die Dinge, an die sie zurückdenken konnte, schon geschehen waren oder erst noch geschehen würden, jedenfalls konnte sie sich nicht daran erinnern, Eltern gehabt zu haben, ja nicht einmal daran, je wirklich jung gewesen zu sein. Alles, woran sie sich erinnerte, war eine allumfassende schwarze Leere, die sie umgab, bis sie sich irgendwann gewünscht hatte, sie wäre nicht gefangen in dieser ewigen Finsternis, und dann trieb sie plötzlich schwerelos zwischen Sternen umher. Nach einer Zeit, die Äonen oder nur Augenblicke sein mochte, entstanden auch Planeten, es wuchsen Bäume auf ihnen, die sie bewundern konnte, und es entwickelten sich Tiere, mit denen sie spielen konnte. Einige dieser Tiere wurden immer intelligenter, sie bildeten unterschiedliche Kulturen und begannen schließlich, sie anzubeten. Manchmal führten sie Kriege untereinander, in denen sie darum stritten, wer von ihnen sie auf die richtige Weise anbetete. Doch nach und nach starben alle diese Kulturen aus, manche durch eigenes Verschulden, manche einfach so, einzig Unomnia blieb bestehen, reiste durch die Universen, sah den Niedergang von Welten und und den Aufstieg von neuen, die sich aus dem Staub formten, den die vorigen zurückgelassen hatten, in einem stetigen Wandel von Zerstörung und Neubeginn.
Doch ob Unomnia nun eine Göttin war oder eine höher entwickelte Lebensform, allmächtig oder anderweltlich, keinesfalls würde Lilly zulassen, dass sie Lisa etwas tat. Als Unomnia bis auf eine Armeslänge an sie herangekommen war, brachte Lilly endlich genug Willenskraft auf, um ihre Lethargie zu überwinden. So dicht vor Unomnia fühlte sie sich unweigerlich klein und unbedeutend, wie eine Maus vor einem riesigen Tiger, trotzdem trat sie nun einen Schritt vor und versperrte ihr so den Weg. »Das reicht! Rühr sie nicht an! Sie bekommst du nicht, sie bleibt hier.«
»Das geht nicht.«
»Warum nicht?«
»Sie trägt das Zeichen.«
Lilly war nicht leicht aus der Fassung zu bringen; Beleidigungen perlten für gewöhnlich an ihr ab wie Wasser an den Blüten einer Orchidee, und sie war so geduldig, dass selbst die menschliche Dummheit sie nicht verzweifeln ließ, doch jetzt fiel es sogar ihr schwer, die Ruhe zu bewahren. Sie kannte diese Art der Argumentation eben nur zu gut, es war der Zirkelschluss von Menschen, die in Traditionen verhaftet waren, die die Dinge immer auf dieselbe Weise taten und es sich gar nicht vorstellen konnten, aus dieser Routine auch nur ein Mal auszubrechen. Das war eine Denkweise, die Lilly schon unter den besten Voraussetzungen zutiefst zuwider war, stand sie doch seit jeher allem Fortschritt im Wege, doch jetzt bedrohte sie das Leben ihrer Freundin, und damit war für sie endgültig ein Punkt erreicht, an dem sie vor Wut hätte durchdrehen können.
So betrachtet kam es einem mittleren Wunder gleich, dass sie nur kurz zusammenzuckte, scharf Luft holte und dann mit zusammengebissenen Zähnen leise sagte: »Und warum musst du sie unbedingt mitnehmen, nur weil sie das Zeichen trägt?«
Doch das war eine Gegebenheit, die auch Unomnia sich nicht erklären konnte. Sie spürte es einfach, wenn jemand dieses Zeichen trug, und sei es in einer noch so weit entfernten Welt. Es war wie ein Jucken, das aber merkwürdigerweise ihre Seele aufrieb, so lange, bis sie es irgendwann nicht länger aushielt und diesem Verlangen nachgab, den Träger des Zeichens aufsuchte und ihn mit sich nahm. Nur war dieser Zwang – wovon er auch immer ausging – schwierig zu vermitteln, und so beschränkte sie sich auf eine Doktrin, die ihrer Erfahrung nach nur selten infrage gestellt wurde: »So will es der Kosmos.«
Lilly fühlte sich dadurch jedoch verständlicherweise in ihrer Befürchtung bestätigt, dass ein Appell an die Vernunft in dieser Situation keinen Sinn hatte. Unomnia war mit Sicherheit keine Widerworte gewohnt, und das Betteln, Flehen und Feilschen der Verdammten, ihre Versprechungen und ihre verspäteten Gebete hatten sie bisher auch nie davon abgehalten, diesen Fluch zu erfüllen. Trotzdem war Lilly nicht dazu bereit aufzugeben. Sie hätte alles getan, um Lisa zu retten. Sie hatte ihr versprochen, sie mit allen Mitteln zu beschützen, und wenn es sonst keine andere Möglichkeit gab, scheute sie sich auch nicht davor, einer Göttin mit Militanz entgegenzutreten, um zu ihrem Wort zu stehen.
»Nun«, sagte sie fest entschlossen, »wenn du zu Lisa willst, musst du erst einmal an mir vorbei.«
Voller Gleichmut blickte Unomnia auf Lilly herab. »Du willst kämpfen?«, fragte sie ohne jede Überraschung in der Stimme. Das kam allenthalben vor. Nur die wenigsten, die zu dieser Opferung auserkoren worden waren, hatten sich aktiv darum beworben, oder waren so überzeugt in ihrem Glauben, dass sie sich ergeben in ihr Schicksal fügten. In den meisten Fällen war Gegenwehr zu erwarten, entweder von den Opfern selbst, so wie jetzt von deren Freundinnen oder manchmal auch von Leibwächterinnen oder verdingten Söldnerinnen. Doch ob nun so oder so, letztlich war noch jede, die das Zeichen trug, mit ihr gekommen, mal wild um sich schlagend und kreischend, mal in bußfertiger Stille.
All das war Lilly mehr oder weniger bekannt, Berichte von Unomnias Auftauchen, wenn sie ihre Opfergaben einforderte, gab es schließlich zuhauf, aber auch das konnte ihren Entschluss nicht erschüttern. »Egal was du tust, du wirst sie jedenfalls nicht bekommen.«
»Dann sei es so«, willigte Unomnia ein. Unbekümmert streckte sie die Hand zur Seite aus, als würde sie nach etwas greifen, wo nichts war als die von Schatten angereicherte Luft, doch als sie die Hand mit einem Mal wieder zu sich heranzog, hielt sie ein Schwert geformt aus Dunkelheit. Es war tiefschwarz und länger als ihr ganzer Arm, dennoch schien es keinerlei Gewicht zu haben, denn es machte ihr keine erkennbare Mühe, es in nur einer Hand zu halten; die Klinge war dünner, als sie je sein könnte, bestünde sie tatsächlich aus Materie und sie glitzerte vor überirdischer Schärfe. »Und was ist mit deinen Freundinnen? Wollen sie auch versuchen, mich aufzuhalten?«
Ungläubig starrte Lilly das unheilvoll aufragende Schwert an. Sie hatte nicht gewusst, dass so etwas überhaupt möglich war. Bisher hatte sie nur immer gesehen, wie Dämoninnen mit ihren Kräften einen Schatten kontrollierte, ihm kurzzeitig Substanz verlieh und ihn so das tun ließ, was sie von ihm verlangte, aber dass jemand wirklich einen Gegenstand erschuf und damit herumhantierte, hatte sie noch nie erlebt. Nicht einmal Sinistra hatte ihr davon erzählt. Doch so beeindruckend das auch war, hieß es gleichzeitig, dass die anderen ihr nicht zu Hilfe kommen durften. Das wäre viel zu gefährlich für sie, nun da diese Bedrohung so real geworden war. Andererseits hätte sie das ohnehin nicht von ihnen erwartet. Dies hier war allein ihr Kampf, ein Duell zwischen ihr und der Herrin der Dunkelheit.
»Keine Sorge«, versicherte sie Unomnia, »sie werden sich nicht einmischen.« Sie sah über die Schulter zu ihnen zurück, um sie selbst ausdrücklich darum zu bitten, sich herauszuhalten, doch noch bevor sie ein Wort herausbringen konnte, stellte sie fest, dass Unomnia ihr bereits zuvorgekommen war. Lisa, ebenso wie der Rest des Freak-Clubs waren im wahrsten Sinne des Wortes in Schatten gehüllt. Es sah aus, als stünden sie einfach nur im Dunkeln, bloß dass es auf der Lichtung trotz der Kuppel, die Unomnia darum errichtet hatte, gar nicht dunkel genug dazu war. Sie waren offenbar unbemerkt von Finsternis überzogen worden, die sich dann verfestigt hatte, sodass sie nun in ihr eingeschlossen waren. Sie standen da wie aus schwarzem Marmor gehauene Statuen, völlig reglos und stumm. Lisa hatte wohl gerade etwas rufen wollen; ihr Mund stand offen, ohne dass ein Ton zu hören wäre, und sie hatte die Augen aufgerissen. Fantasma hatte einen Arm zur Hälfte angehoben, als hätte sie auf etwas deuten wollen, und auch alle anderen waren mitten in ihren Bewegungen erstarrt. Nicht einmal ihre Kleidung oder ihr Haar flatterte mehr im Wind.
Unwillkürlich musste Lilly bei diesem Anblick schwer schlucken, jedoch nicht so sehr, weil sie sich Sorgen um ihre Freundinnen gemacht hätte – Unomnia war nicht dafür bekannt, irgendjemandem Schaden zuzufügen, einmal vom unbekannten Schicksal ihrer Opfergaben abgesehen, und Lilly hatte keinen Zweifel daran, dass sie wieder erwachen würden, als wäre nichts geschehen, sobald diese Sache vorüber war –, sondern weil ihr damit auf eindrucksvolle Weise bewusst gemacht wurde, wie aussichtslos ihr Unterfangen eigentlich war. Unomnia konnte sie jederzeit ohne Vorwarnung genau so versteinern lassen wie den Freak-Club, und sie hätte nichts dagegen tun können, wahrscheinlich würde sie es nicht einmal bemerken, bevor es zu spät war, und dann würde ein Hieb mit dem Schwert genügen, um sie kampfunfähig zu machen. Um das zu erreichen, könnte sie ihr sogar einen Arm abschlagen, so scharf wie es war. Die Klinge war immerhin so dünn wie nur irgend möglich, buchstäblich so flach wie ein Schatten, und somit vermutlich überhaupt nicht messbar, sondern besaß nur die unvorstellbar geringen Ausmaße des Planck-Raums, wie Isabelle erklärt hätte, wenn sie denn gerade abkömmlich gewesen wäre. Ihr Knochen würde jedenfalls kaum genug Widerstand entgegenbringen, sie würde ihn so sauber durchtrennen wie ein rot glühendes Messer, das durch Butter gleitet.
Zum Glück schien das aber nicht in Unomnias Absicht zu liegen. Stattdessen tat sie etwas, das in Lilly noch mehr Bestürzung hervorrief als das unvermittelte Ziehen des Schwerts aus der Scheide der Dunkelheit: Sie ließ sich Flügel wachsen, auch wenn Lilly sie nicht sofort als solche erkannte. Für sie sah es aus, als würden plötzlich zwei längliche Schatten hinter ihrem Rücken hervorschiessen, von denen sie zuerst keine Ahnung hatte, was es mit ihnen auf sich haben sollte, bis sie sich zu rabenhaften Schwingen entfalteten. Sie waren riesig, was sie ja auch sein mussten, sollten sie das Gewicht dieser bestimmt zwei Meter großen Göttin tragen. Ihre fransigen Spitzen reichten fast bis auf den Boden und jede von ihnen ähnelte sowohl in ihren Abmessungen als auch Beschaffenheit den breiten Bannern von Standartenträgern. Sie sahen so dick und schwer aus wie dichtes Brokatgewebe, doch Lilly war sicher, dass sie unglaublich leicht sein würden, hätte sie die Gelegenheit bekommen, sie zu berühren – so gewichtslos wie ein Schatten eben.
Allerdings war Lilly nur ein Augenblick gewährt, um diese Flügel zu bestaunen. Unomnia streckte sie bloß kurz so aus wie ein Adler, der sich zum Flug bereit machte, dann hob sie auch schon ab. Der Flügelschlag erzeugte so viel Wind, dass das Laub der Bäume vom Boden hochgewirbelt wurde, und Staubpartikel rasten wie Geschosse durch die Luft, prasselten Lilly ins Gesicht und nahmen ihr damit erst einmal die Sicht. Als sie wieder etwas sehen konnte, befand Unomnia sich bereits hoch über ihr, wo sie mit ausgebreiteten Schwingen langsam schwebend einen Kreis beschrieb, als würde sie darauf warten, dass sie sich ebenfalls in die Luft erhob, damit ihr Kampf endlich beginnen konnte.
Das gab Lilly zu denken. War es möglich, dass sie das auch konnte? Aber wie sollte das gehen? Sie hatte noch nie auch nur davon gehört, dass Dämoninnen fliegen konnten, und das aus gutem Grund. Es erschien ihr absurd. Selbst wenn sie es schaffte, die Schatten zu so etwas Komplexem wie Flügel zu formen und sie dazu brachte, sich so um sie zu schlingen, dass sie an ihr hielten, wie sollte sie sie dann über einen längeren Zeitraum so genau steuern, dass sie sie in der Luft hielten und die Manöver ausführten, die sie ihnen auftrug? Das würde mehr Konzentration erfordern, als irgendjemand aufzubringen in der Lage war, doch sogar wenn sie das hinbekam, müsste sie dem unentwegt ihre volle Aufmerksamkeit widmen, sodass sie gar nichts anderes mehr tun könnte, erst recht nicht kämpfen. Allein die Vorstellung war vollkommen lächerlich, außer … außer vielleicht die Schatten wären Teil des eigenen Körpers. Das könnte funktionieren, immerhin konnte man auch laufen, ohne ständig daran denken zu müssen, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Ein Versuch konnte wohl nicht schaden, und was sollte sie sonst schon tun? Unomnia machte keine Anstalten, wieder zu landen, sondern wartete dort oben geduldig auf sie und beobachtete interessiert ihre nächsten Schritte.
Also schloss Lilly die Augen und horchte in sich selbst hinein. Sie nahm die Dunkelheit in sich wahr, dieses einzigartige Muster, das die Essenz ihres Daseins war, ganz so wie immer, wenn sie ihre Kräfte anwandte, nur dass sie ihr Bewusstsein jetzt nicht auf einen außenstehenden Schatten lenkte, sondern versuchte, ihre eigenen so zu befehligen, als wären sie Muskeln – und das klappte. Sie konnte fühlen, wie sie aus ihren Schulterblättern hervorbrachen, ohne dabei jedoch die Haut zu durchstoßen, wie sie die Armschwingen bildeten und letztlich das Gefieder. Nun stand sie da wie zuvor Unomnia, die Flügel ausgebreitet und den Rücken streckend, aber im Gegensatz zu ihr war sie sich nicht sicher, wie sie weiter vorgehen sollte. Probeweise schlug sie ein paar Mal schwach mit den Flügeln, um ein Gefühl für sie zu bekommen, und als das schon kleine Windstöße erzeugte, die Staubwolken davonwirbeln ließen, schlug sie immer kräftiger, bis sie endlich abhob und immer höher stieg.
Als sie auf einer Höhe mit Unomnia war, hörte sie auf, mit den Flügeln zu schlagen, und stellte sie gerade, sodass sie ebenfalls sanft durch die Luft glitt. Dort folgte sie dem Kreis, den Unomnia durch die Luft zog, in möglichst demselben Tempo, und bewahrte damit einen gleichbleibenden Abstand zu ihr. Nun da der Beweis erbracht war, dass sie diese bislang undenkbare Fähigkeit besaß, überlegte sie, ob die andere nicht auch noch unbemerkt in ihr schlummerte. Unomnia setzte jedenfalls noch nicht zum Angriff an, sie schien ein faires Duell zu erwarten, und dafür brauchte Lilly noch ein Schwert.
Erneut dachte sie darüber nach, wie Unomnia das geschafft haben mochte, und kam zu dem Schluss, dass es wohl ein recht ähnliches Prinzip wie mit den Flügeln war. Allerdings musste sie nicht auf ihre eigene Dunkelheit zugreifen, um es zu formen, was ja ziemlich unsinnig gewesen wäre, stattdessen musste sie den Schatten, dem sie benutzte, sein eigenes Muster verleihen, und zwar das eines Schwerts. Mit dieser Erkenntnis griff sie wahllos in das Zwielicht um sich herum, sammelte so die darin schwelende Finsternis, gestaltete sie zu einem Schwert und versiegelte ihre neue Struktur, indem sie das charakteristische Muster aus Dunkelheit anpasste. Auch das klappte wie vorgesehen. Auf einmal hielt sie ein richtiges, aus Schatten geschmiedetes Schwert in der Hand. Prüfend wog Lilly es von einer Seite auf die andere. Es war fest und völlig unabhängig von ihr, sie musste sich nicht wie sonst darauf konzentrieren, damit es seine Materialität beibehielt, sondern war nun ein eigenständiger Gegenstand. Es ähnelte dem, das Unomnia für sich erschaffen hatte; natürlich war es so schwarz wie die reine Finsternis, aus der es bestand, es war so lang, dass es den Boden berührt hätte, wenn sie es mit der Spitze nach unten halten würde und wenn sie noch festen Boden unter den Füßen gehabt hätte, außerdem sah die Klinge scharf genug aus, um Stahl zu schneiden. Zur Sicherheit hätte sie die Schneide noch mit dem Daumen betasten können, aber das erschien ihr doch zu gefährlich; sie machte ganz den Eindruck, als könnten selbst sachteste Berührungen tiefe Wunden reißen.
So umkreisten sie sich also nun, das Mädchen und die Göttin, die schattenhaften Schwingen zum Schwebeflug ausgebreitet und die schwarzen Schwerter fest in der Hand haltend, während sie einander taxierten. Lilly machte sich keine Illusionen darüber, dass Unomnia ihr in jeder direkten Konfrontation hoffnungslos überlegen wäre. Wenn sie überhaupt eine noch so geringe Chance haben wollte zu gewinnen, musste sie sie überrumpeln, sie musste zuerst zuschlagen und durfte sich dabei keinesfalls zurücknehmen, sie musste schnell sein und ihre ganze Kraft dabei einsetzen, denn aller Voraussicht nach würde sie keine Gelegenheit für einen zweiten Angriff bekommen.
Demgemäß zögerte Lilly nicht länger. Sie schlug ein paar Mal so kräftig mit den Flügeln wie sie nur konnte, bis sie ihre Höchstgeschwindigkeit erreicht hatte, dann legte sie sie an ihrem Rücken an, um den Luftwiderstand so gering wie möglich zu halten und stürzte so auf Unomnia zu, das Schwert mit beiden Händen vor sich gestreckt, wie ein todbringender stromlinienförmiger Pfeil, der abgefeuert worden war und nun unaufhaltsam auf sein Ziel zuraste.
Damit hätte sie Unomnia in die Brust getroffen, hätte die nicht mit übermenschlicher Schnelligkeit reagiert. Wie eine vom Kurs abschwenkende Krähe drehte sie den Körper zur Seite, und während Lilly, ohne eine Gefahr für sie darstellend, an ihr vorbeiflog, streckte sie ihr Schwert ein winziges bisschen aus. Lilly bemerkte es kaum, für sie fühlte es sich an, als würde ihr jemand mit einem Kugelschreiber einen Strich auf den Oberarm malen. Erst als sie abbremste, indem sie ihre Flügel entgegen der Flugrichtung aufspannte, fielen ihr die seltsamen roten Streifen auf, die an ihrem Arm hinabliefen. Es war Blut, das aus einem schmalen Riss in ihrer Haut hervorquoll und dann in mehreren Bahnen senkrecht bis zu ihrem Ellbogen hinabrann. Bei diesem Anblick erinnerte sie sich wieder daran, wie die äußerste Schwertspitze sie ganz leicht gestreift hatte, doch was sie dabei so fassungslos machte, war nicht, wie mühelos Unomnia ihr diese Wunde zugefügt hatte, sondern mit welcher Präzision sie das getan hatte. Sie hatte ihr gezielt nur diese harmlose Schramme beigebracht, es wäre eine Kleinigkeit für sie gewesen, ihr Schwert nur wenige Zentimeter weiter zu führen, womit sie Lilly mindestens eine lebenswichtige Arterie durchtrennt hätte, doch das hatte sie ganz bewusst nicht getan. Sie hätte diesen Kampf schon hier für sich entscheiden können, ohne sich auch nur einmal anzustrengen, aber stattdessen spielte sie mit ihr und hatte ihr diesen mehr als metaphorischen Klaps auf den Arm verpasst.
Eigentlich hätte Lilly sich freuen sollen, überhaupt noch am Leben zu sein, doch machte sie das bloß noch wütender. Für sie ging es hier um etwas viel Wertvolleres als ihr eigenes Wohlergehen, sie verteidigte den Menschen, für den sie alles aufzuopfern bereit war, aber das schien Unomnia nichts zu bedeuten. Mit einer Mühelosigkeit, die Lilly förmlich das Herz zerriss, schmetterte sie ihren Versuch, Lisa zu beschützen, nieder und machte sich dabei noch lustig über sie.
Dieser Zorn trieb sie dazu an, gleich den nächsten Angriff zu starten, dennoch behielt sie einen klaren Kopf. Nachdem ihre erste Strategie so wirkungslos gewesen war, verlagerte sie sich nun auf eine neue. Sie wendete in einem großen Kreis, sodass sie nun seitlich auf Unomnia zuflog und behielt eine geringere Geschwindigkeit bei, die ihr mehr Kontrolle erlaubte. Als sie bei ihr anlangte, nutzte sie den Schwung ihres Flugs, um mit aller Macht von oben herab zuzuschlagen, doch Unomnia griff über ihren Rücken hinter sich und machte eine Handbewegung, als würde sie sich einen Mantel über den Kopf ziehen. Tatsächlich hüllte sie sich damit jedoch in einen Schatten, auch wenn dessen Effekt viel mehr der eines Schildes war. Lillys Schwert prallte so hart von ihm ab, dass schwarze Splitter davonstoben und sie selbst sich fühlte, als wäre sie ungebremst gegen einen Stahlträger angerannt. Ihr blieb die Luft weg, die Muskeln in ihrem Arm vibrierten vor Schmerz und die Wucht des Aufpralls schickte ein Beben durch ihren Körper, das sich von Zelle zu Zelle fortsetzte und so jede einzelne Faser in ihr zum Schwingen brachte. Sie wurde sogar ein Stück zurückgeworfen, und weil sie, erschüttert von der reflektierten Kraft ihres eigenen Angriffs, sich nicht schnell genug mit den Flügeln wieder abfangen konnte, geriet sie ins Trudeln.
Sie krachte in einen Baum, dessen Zweige ihr das Gesicht zerkratzten, und es war reines Glück, dass sie dabei kein Auge verlor, aber immerhin bewahrte er sie davor, auf den Boden zu fallen, wobei sie sich aller Wahrscheinlichkeit nach noch ein Bein gebrochen hätte. So stürzte sie nur durch die dünneren oberen Äste, bis sie mit der Brust auf einem dickeren weiter unten landete. Dort zog sie sich herauf und verschnaufte kurz, während sie sich nach Unomnia umsah. Die war mittlerweile wieder dazu übergegangen, am Himmel ihre Kreise zu ziehen. Falls sie eine Göttin war, musste sie sich also wenigstens an die Grenzen der Physik halten, wie Lilly nun auffiel. Sie hatte gerade am eigenen Leib erfahren, dass es mit solchen Schwingen nicht möglich war, einfach in der Luft zu schweben; dazu hätte man so schnell mit den Flügeln schlagen müssen wie ein Kolibri, und das zu leisten war der Metabolismus von größeren Lebewesen nicht in der Lage. Doch wenn sie nicht über den Naturgesetzen stand, konnte sie auch nicht unbesiegbar sein.
Ermutigt von dieser Schlussfolgerung breitete Lilly wieder ihre Flügel aus, stieß sich vom Ast ab und flog los. Das war zwar nicht ganz einfach vom Geäst des Baums aus, doch hatte der Herbst und ihr Sturz durch die Zweige dafür gesorgt, dass sie einigermaßen Platz hatte. Sie musste nur erst ein wenig mit aufgespannten Schwingen durch die Luft segeln, bis sie den Baum hinter sich gelassen hatte, bevor sie anfing, mit den Flügeln zu schlagen, um an Höhe zu gewinnen. Auf diese Weise erreichte sie wieder Unomnia, doch diesmal verschwendete sie keine Zeit damit, sich in vorsichtigem Abstand zu ihr zu halten und auf die richtige Gelegenheit zu warten; jetzt verfolgte sie sie regelrecht, flog neben ihr her und schwang ihr Schwert immer wieder in dem verzweifelten Versuch, sie irgendwie zu treffen, doch ging nicht nur jeder Schlag ausnahmslos ins Leere, sondern wurde auch noch sofort von Unomnia mit einem Konter bestraft.
Als Lilly zum ersten Mal ausholte, um die Klinge gegen Unomnia zu führen, stach die ihr stattdessen in die ungeschützte Flanke. Der nächste Angriff von oben wurde abgeleitet und mit einem Schnitt in den Oberschenkel erwidert. Daraufhin bemühte sie sich, ihren dritten hieb besser zu tarnen, aber auch diese verdeckt von unten nach oben gerichtete Offensive wurde frühzeitig entdeckt und zog eine weitere Blessur an ihrem Arm nach sich. So ging es immer weiter. Ohne Unterlass setzte Lilly Schlag auf Schlag an, und ebenso ohne Unterlass wurde jeder davon abgewehrt und mit einem Gegenangriff versehen. Bald war Lillys ganzer Körper von Verletzungen übersät, die zwar schmerzhaft waren, aber ansonsten keine Bedrohung darstellten. Sie waren gerade einmal tief genug, um Kleidung und Haut aufzuritzen, aber sofern sie sich nicht im Dreck wälzte und sich eine Entzündung zuzog, würden sie schnell wieder verheilen.
Dennoch merkte sie allmählich, wie sie schwächer und schwächer wurde. Das hatte allerdings kaum etwas mit ihren immer zahlreichere werdenden Wunden zu tun, denn auch wenn Lilly durch sie einen gewissen Blutverlust erlitt, war der höchstens eine kleinere Unbequemlichkeit verglichen mit allem anderen, was sie heute schon durchgemacht hatte. Sie war in ein anderes Universum gewechselt, hatte sich des Patrizids schuldig gemacht, hatte sich ein Schwert aus Dunkelheit geschmiedet, sich Flügel wachsen lassen und kämpfte nun dem ungeachtet gegen eine Göttin, und obwohl sie dabei alles gab, was sie noch aufzubieten hatte, war nicht zu bestreiten, dass sie nun wirklich am Ende war. Sowohl ihre körperliche Kraft als auch ihre Schattenmächte waren fast vollständig aufgebraucht. Zwar kostete es sie keine geistige Anstrengung, die Form ihrer Flügel aufrecht zu halten, da sie aus ihrer eigenen Finsternis bestanden, aber ihre Erschaffung hatte ihre Macht über die Schatten in nicht unbeträchtlichem Maße beansprucht und mit ihnen zu schlagen verausgabte ihre menschliche Physis. Das Gleiche galt für das Schwert, und wenn nicht bald etwas geschah, würde sie aus reiner Erschöpfung vom Himmel herabstürzen wie ein gefallener Engel.
Doch kurz bevor es so weit war, als sie sich schon kaum mehr in der Luft halten konnte und sie nur noch von einer Seite auf die andere schlingerte, nahm Unomnia die Sache selbst in die Hand. Mit einer einzigen blitzschnellen Bewegung schwang sie ihr Schattenschwert und jagte es durch Lillys aufgestellte Flügel. Die waren damit völlig zerstört. Sie hingen nur noch in Fetzen, die zwar groß genug waren, um noch so viel Luftwiderstand zu bieten, dass Lilly nicht augenblicklich wie ein Stein zurück auf die Erde sauste, aber die Gelenke waren dahin, sodass sie nicht mehr unter Kontrolle zu bringen waren. Lilly konnte nichts anderes tun, als Schadenbegrenzung zu betreiben. Sie konnte ihre Schwingen jedenfalls nicht wieder aufrichten, und so zerschnitten wie sie waren, trugen sie Lillys Gewicht ungefähr noch so gut wie ein aufgespannter Regenschirm. Sie musste hilflos mitansehen, wie sie immer weiter an Höhe verlor, wie der Boden unaufhaltsam auf sie zuraste und wie sie schwankend durch die Luft gewirbelt wurde. Sie hätte vielleicht gerade noch Zeit für ein kurzes Gebet gehabt, aber welchen Sinn sollte das haben, wenn sie womöglich von einer Göttin herabgestoßen worden war? Da nutzte sie die ihr verbleibenden Sekunden lieber dazu sich auf eine harte Landung vorzubereiten, die Arme flach auszustrecken und sich einigermaßen parallel zum Boden zu halten.
Zum Glück war die Landung nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Sie schaffte es, ziemlich eben aufzukommen, sodass sie erst ein Stück rutschte, als würde sie ohne Schlitten auf dem Bauch liegend einen zugeschneiten Hügel hinabrauschen, und der vom Herbstlaub bedeckte Waldboden war weich genug, dass ihr dabei nicht mehr passierte, als sich ein paar weitere kleine Schrammen zuzuziehen. Als sie endlich zum Stehen kam, war ihr Gesicht schmutzig und in einem Haufen nasser Blätter vergraben, doch fand sie nicht die Stärke, sich daraus zu erheben. Keuchend blieb sie darin liegen, als wäre er ein warmes Bett, bis sie Unomnia sachte hinter sich aufsetzen hörte. Erst dann wälze sie sich auf den Rücken und streckte ihr das Schwert entgegen in einem letzten jämmerlichen Aufflammen von Kampfeswillen.
Doch sie war von Anfang an keine Gegnerin für Unomnia gewesen und jetzt war sie ohnehin nicht mehr als eine von einem gelangweilten Kind in den Dreck geworfene und vergessene Puppe, über die sie einfach hinwegsteigen konnte auf ihrem Weg zu Lisa, ihrem eigentlichen Opfer. Fast schon sanft schlug sie Lilly das Schwert aus der Hand, das daraufhin in die Dunkelheit zwischen den Bäumen geschleudert wurde und sich dort auflöste. In dieser Konstellation verharrten die beiden anschließend, Lilly blutüberströmt und mit unzähligen kleinen Schnittwunden versehen am Boden liegend und Unomnia über ihr aufragend, das pechschwarze Schwert genau auf ihr Herz gerichtet.
Es hätte eine Ewigkeit sein können, die sie reglos dort verbrachten, sich nur still in die Augen sehend, aber Lilly nahm an, dass es bloß ein paar Sekunden waren, ehe sie plötzlich die aufgeregten Rufe und die näher kommenden Schritte ihrer Freundinnen hörte. Sie wollte den Kopf drehen, um sich ihnen zuzuwenden, aber es klappte nicht. Es war, als wäre sie in einer Schlafparalyse gefangen; ihr Gehirn sandte eindeutig Signale an ihre Muskeln, dass die sich bewegen sollten, doch es tat sich nichts. So schwach hatte Lilly sich noch nie gefühlt. Sogar als sie nach ihrem Selbstmordversuch im Krankenhaus wieder zu sich gekommen war, zitternd vor Blutarmut und die Sehnen in ihrem Handgelenk von dem scharfen Messer durchschnitten, sodass sie nicht einmal ohne Hilfe ein Glas hatte heben können, um etwas zu trinken, hatte sie doch immerhin noch so viel Kraft aufbringen können, die elementarsten Tätigkeiten auszuführen, wie eben sich nach ihrem Besuch umzusehen, wenn jemand ihr Zimmer betreten hatte, doch selbst das war ihr jetzt nicht möglich. Sie konnte nichts weiter tun, als hier zu liegen und versuchen, wieder zu Atem zu kommen.
Obwohl sie so nicht sehen konnte, wie ihre Freundinnen zu ihr rannten, war nicht zu überhören, dass sie sich Sorgen um sie machten. Das Laub und die Erde unter ihren Füßen knirschte, als sie fast schon schlitternd neben ihr anhielten, und dem Gewirr ihrer Stimmen war unschwer zu entnehmen, dass sie kurz davor waren einzugreifen, um Lilly zu retten und sich nur noch uneinig darüber waren, wie sie das anstellen sollten, ohne sie dabei noch weiter zu gefährden. Das musste Lilly natürlich unter allen Umständen verhindern. Auch zusammen hatten sie keine Chance gegen Unomnia, daran waren schon ganze Heere gescheitert, und selbst wenn ihr offensichtlich nichts daran lag, irgendjemandem Schaden zuzufügen, der nicht mit dem Fluch ihres Mals behaftet war, konnten bei so einer Situation leicht Unfälle passieren, sei es nun weil Unomnia die Kraft ihres Angriffs falsch einschätzte, oder weil ein Mitglied des Freak-Clubs versehentlich eine ihrer Verbündeten traf.
»Schon gut«, sagte Lilly also schnell. »Keine Sorge, mir geht’s gut. Das sieht schlimmer aus, als es ist.« Sie klang heiser, als wäre sie gerade erst einen Marathon gelaufen, trotzdem gelang es ihr, mit festem Ton zu sprechen, was wohl daran lag, dass es schlichtweg stimmte, was sie sagte. Die zerrissene Kleidung und die Schnitte darunter, das viele Blut auf ihr und die Abschürfungen in ihrem Gesicht, das alles musste wirklich furchtbar aussehen, aber nichts davon würde ernstliche Konsequenzen nach sich ziehen. Zwar spürte sie mit einem schmerzhaften Stechen die kühle Herbstluft an den Stellen in sie dringen, wo die zarte Schutzhülle der Haut aufgerissen war und den darunterliegenden Organismus bloßgelegt hatte, doch das verblasste neben den Qualen, die sie erdulden musste, wenn sie sich nur vorstellte, dass einer ihrer Freundinnen etwas zustoßen würde.
Ihren Clubkameradinnen schien das nicht sonderlich zu gefallen, aber sie taten immerhin, was sie von ihnen verlangt hatte, und verhielten sich ruhig. Zwar redeten sie weiterhin leise miteinander, wobei ihre Stimmen klar von Zweifel erfüllt waren, doch konnte Lilly spüren, wie die Schattenkräfte, die sie bereits um sich gesammelt hatten, ungenutzt wieder schwanden, während sie aufmerksam beobachteten, was nun geschah. Einzig Lisa sah sich außerstande, das zu akzeptieren. Sie stürmte los, warf sich neben Lilly auf den Boden und schlang ihr die Arme um den Hals. Dann sah sie zu Unomnia auf und sagte: »Tu ihr nichts! Ich komm ja mit, aber tu ihr nichts!«
»Nein!«, rief Lilly sofort dazwischen, fast schon automatisch, bevor sie überhaupt merkte, was sie da forderte. »Nein! Nimm mich statt ihr, ich bitte dich!« Sie hatte keine Ahnung, ob ein Tauschhandel solcher Art überhaupt gestattet war und nicht gegen irgendwelche Dogmen verstieß, in den Berichten, mit denen sie bisher über Unomnias Niederkunft konfrontiert worden war, hatte so etwas jedenfalls keine Erwähnung gefunden. Sogar Unomnia war von diesem Vorschlag sichtlich überrascht.
»Du willst dich für sie opfern?«, fragte sie verwundert nach. Sie schwenkte das Schwert weg von Lilly, sah es an, als wäre sie ein wenig irritiert, dass sie es noch in der Hand hielt, und entließ es aus ihren Diensten wieder zurück in seinen ursprünglichen Daseinszustand. Einen Moment lang sah es so aus, als wäre es flüssig geworden und würde nun aus ihrer Hand rinnen, doch bevor sie zu Boden fallen konnten, lösten sich die Tropfen auf und wurden wieder Teil des Zwielichts, das Unomnia mit sich über die Lichtung gebracht hatte.
»Ja«, sagte Lilly und bracht ein Nicken zustande, das sich anfühlte, als würde es ihre letzten Kraftreserven verbrauchen, »ich will mich opfern.«
Doch Lisa konnte dieser Idee nichts abgewinnen. »Das darfst du nicht tun!«, rief sie voller Entsetzen.
Lisa hatte sich über sie gebeugt, sodass Lilly keine andere Wahl hatte, als ihr in die Augen zu schauen, so schwer es ihr auch fiel. »Bitte, ich möchte es tun … Nein, ich hab sogar das Gefühl, dass ich es tun muss. Du weißt doch, was ich dir versprochen habe, oder?«
»Dass du mich immer beschützen wirst?« Tränen bildeten sich in Lisas Augen. Wie hätte sie das je vergessen sollen?
»Genau. Nur wegen mir bist du gezeichnet worden. Auch wenn es Sinistra war, ich bin dafür verantwortlich, und dem kann ich mich nicht entziehen. Mich hätte dieser Fluch treffen sollen, nicht dich, aber da du ihn nun mal abbekommen hast, muss ich wenigstens alles dafür tun, um ihn wieder abzuwenden. Unomnia kann ich nicht besiegen, das können wir alle nicht, und damit bleibt nur noch dieser letzte Ausweg.«
Lisa blinzelte, und damit löste sich eine erste Träne, die nun ihre Wange herablief. »Wie kommt es, dass dein letzter Ausweg immer deinen Tod beinhaltet?«
Lilly verstand natürlich, dass diese Bemerkung auf ihren Selbstmordversuch anspielte, trotzdem verstand Lisa gar nicht, wie recht sie damit hatte. Für Lilly war es irgendwie immer ein Trost gewesen, zu wissen, dass es immer diese eine Möglichkeit gegeben hatte, allem zu entkommen, ihren Schuldgefühlen, ihrer Trauer und ihren Erinnerungen an das, was Sinistra ihr angetan hatte, die sie immer wieder einholten. Es war absurd, dennoch gab dieser Gedanke ihr eine gewisse mentale Stärke und letztendlich kam ihr jede Stunde, in der sie ihm nicht nachgab, wie ein Gewinn vor. Erst seit sie Lisa getroffen hatte, war dieses Bedürfnis verschwunden, doch musste sie sich eingestehen, dass sie insgeheim hin und wieder – in den dunkelsten Augenblicken ihrer Existenz, wenn alles sie zu überwältigen drohte, und sie jede Hoffnung auf Erlösung verloren hatte – in diese alten Verhaltensmuster zurückgefallen war.
»Tja, ich schätze, schlechte Angewohnheiten wird man nur schwer wieder los. Aber jetzt mal ehrlich, wir wissen doch gar nicht …« Sie unterbrach sich, hielt kurz inne und sah dann fragend zu Unomnia auf. »Äh, was passiert eigentlich mit denjenigen, die du mit dir nimmst?«
»Das ist bei jedem unterschiedlich«, sagte Unomnia ohne jede Regung.
»Hm-hm. Und könntest du mir sagen, was mit mir passieren würde?«
»Tut mir leid, das kann ich nicht voraussehen.«
»Na ja, einen Versuch war’s wert«, sagte Lilly mehr zu sich selbst als zu irgendjemandem sonst, bevor sie sich wieder an Lisa wandte. »Na gut, dann bleibt es dabei, wir wissen nicht, was passiert. Vielleicht ist es mein Tod, vielleicht nicht, vielleicht geht es nach dem Tod irgendwie weiter, vielleicht nicht, aber eines ist sicher, du kannst dich auf mich verlassen. Heute habe ich dich enttäuscht, der einzige Weg, mein Versprechen nicht zu brechen, besteht darin, dich für eine Weile zu verlassen, deshalb gebe ich dir jetzt ein neues: wir werden uns wiedersehen, was auch passiert. Irgendwie werde ich einen Weg zurück zu dir finden, und dann werde ich nie mehr von deiner Seite weichen.«
Lisas Tränen flossen mittlerweile völlig ungehindert, und ihre Wangen waren nass von den Bahnen, die sie auf ihnen bildeten, aber das hielt sie nicht davon ab, jetzt Lillys Gesicht mit Küssen zu bedecken. Immer wieder senkte sie ihre Lippen hinab, ohne sich darum zu kümmern, wo sie auftrafen, sei es nun Lillys Mund, ihre Nase oder ihre Wangen, und ebenso wenig kümmerte es sie, dass sie damit ihre Tränen überall auf ihr hinterließ. »Ich … liebe … dich«, brachte sie schließlich heraus, mühsam hervorgepresst zwischen Küssen und rückhaltlosem Schluchzen.
»Ich liebe dich auch«, erwiderte Lilly flüsternd, blieb ansonsten aber erstaunlich gelassen. Zwar berührte es sie, zu sehen, wie Lisa um sie weinte, und sie konnte auch absolut nachvollziehen, was sie empfand, doch blieb sie in ihrem Innern seltsam distanziert, als würde sie das alles gar nichts angehen. Sie wusste, wenn es nun andersherum wäre, und sie Lisa einem unbekannten Schicksal überlassen müsste, würde sie vor Emotionen überkochen, sie würde rasen vor ohnmächtiger Wut, maßlosem Leid und seelenbrechender Verzweiflung. Sie hätte es nicht ertragen, wenn Lisa ihr auf diese Weise genommen worden wäre, doch angesichts ihres eigenen Übergangs in eine andere Welt – in welcher Form auch immer – hatte sie keine Furcht. Das konnte daran liegen, dass ihr schon so viel Schreckliches widerfahren war, dass sie daran gewohnt war und eigentlich gar nichts anderes mehr erwartete, jedenfalls war sie froh, sich für Lisa opfern zu können.
Nur zu gern wollte sie eine Märtyrerin für sie sein, sterben, damit sie leben konnte, dann hätte das alles wenigstens irgendeinen Sinn gehabt. Schließlich hatte der Tod nichts Glorioses an sich, das hatte sie gerade erst bei Sinistra mit eigenen Augen gesehen. Da war eine Herrscherin über eine ganze Welt gestorben, umringt von der ihr treu ergebenen Leibgarde, trotzdem hatte es keine bedeutsamen letzte Worte gegeben, keine späte Einsicht oder Reue auf dem Totenbett, nicht einmal gehauchte Verwünschungen für ihre Mörderin, nur dasselbe banale, von Krämpfen geschüttelte Versagen der Organe, das früher oder später jeden ereilte. Das, was man gemeinhin Leben nannte, war nichts weiter als ein Kampf, der von vorneherein zum Scheitern verurteilt war. Tag für Tag rackerte man sich ab, um seine Ziele zu erreichen, doch egal wie hehr die auch waren, letzten Endes wurde einem unabwendbar alles zunichte gemacht. Keine Errungenschaft, die man als sein Vermächtnis aufgebaut hatte, war von Bestand, sondern würde ebenso vergehen wie das eigene Leben, und nichts, was man tat, konnte daran etwas ändern. Welche Reichtümer man auch angehäuft haben mochte, wie berühmt man war oder wie sehr man sich bemüht hatte, ein guter Mensch zu sein, irgendwann kam der Tod zu jedem, und machte sämtliche Bestrebungen hinfällig. Nichts davon würde diesen Augenblick verhindern oder auch nur weniger jämmerlich machen, wenn in seiner Umklammerung die Muskeln versagten und sich die Blase entleerte. Er würde immer zu früh kommen, immer unpassend und er würde einem alles nehmen, sodass das Einzige, was von einem selbst und seinen Ambitionen übrigblieb, eine Pfütze Blut und ein Haufen toter Zellen waren.
Außerdem hatte Lisa nie etwas getan, was eine Verurteilung zu einem vorzeitigen Tod gerechtfertigt hätte. Sie war immer nett zu allen gewesen, hatte geholfen, wo sie nur konnte und hatte sich nie etwas zuschulden kommen lassen, Lilly dagegen hatte gerade erst ihre dämonische Mutter umgebracht, War das nicht ein Verbrechen, für das der Tod eine angemessene Strafe wäre? So oder so, auch wenn die anderen recht haben mochten und sie nicht dafür zur Rechenschaft zu ziehen war, war Lilly es leid, nach Ausflüchten oder mildernden Umständen zu suchen. Sie fühlte sich nur noch unendlich ausgebrannt, vollkommen leer und dieser Welt überdrüssig. Sie war müde und wollte nur noch die Augen schließen, bis entweder der Schlaf oder der Tod über sie kam. Beides würde ihr das erhoffte Vergessen bringen, und Unomnia war nun dabei, ihr das eine oder das andere zu schenken, denn die verkündete in diesem Augenblick: »Ich nehme das Opfer an.«
Sie reichte ihr eine Hand nach unten, und nach kurzem Zögern ergriff Lilly sie und ließ sich von ihr auf die Füße ziehen. Auch Lisa stand auf, noch immer von ganzem Herzen weinend, und sah Lilly sehnsuchtsvoll an, obwohl sie durch den Tränenschleier gerade einmal ihre Silhouette erkennen konnte. Am liebsten hätte sie sich sofort wieder an sie geklammert, schaffte es aber unter Aufbietung ihrer gesamten Willenskraft gerade so, sich davon abzuhalten. Lilly hatte recht, sie konnten Unomnia unmöglich aufhalten, und das hätte den unvermeidlichen Abschied für sie beide nur noch schwerer gemacht. Sich versuchte, sich zusammenzureißen, und wenigstens das Schluchzen, das immer wieder aus ihr hervorbrach, zurückzuhalten, damit Lilly sich nicht schlecht fühlen würde, sie allein lassen zu müssen, aber es gelang ihr einfach nicht. Noch nie in ihrem Leben war sie so traurig gewesen wie jetzt. Sie war völlig am Boden zerstört und konnte nicht glauben, dass es ihr jemals wieder besser gehen würde.
Es war noch gar nicht so lange her, dass sie Lilly zum ersten Mal getroffen hatte, erst etwas über ein halbes Jahr, trotzdem kam es ihr so vor, als wären sie schon seit Ewigkeiten zusammen. Lisa hatte sie auf Anhieb sympathisch gefunden, und je näher sie sich kennengelernt hatten, desto tiefere Gefühle hatte sie für sie entwickelt. Es hatte gerade einmal zwei Tage gebraucht, bis ihr klar geworden war, dass sie sich unsterblich in Lilly verliebt hatte, und sie nie wieder auch nur einen Tag ohne sie verbringen wollte. Von da an waren sie unzertrennlich gewesen; nichts hatte sie auseinanderbringen können, nicht die befremdeten Blicke ihrer Klassenkameradinnen oder ihre anzüglichen Bemerkungen und auch nicht Sinistras unaussprechliche Taten. Ihre Liebe war für sie beide wie ein wärmendes Feuer in kalter Nacht gewesen, sie hatten Trost und Schutz in den Armen der jeweils anderen gefunden, sie hatten sich durch schwere Zeiten und über alle Widrigkeiten hinweg geholfen, sie waren immer füreinander da gewesen und konnten sich aufeinander verlassen.
Dabei war Lisa nie besonders sentimental gewesen. Lilly war ihre erste große Liebe. Zuvor hatte sie höchstens einmal für einige ihrer Mitschülerinnen geschwärmt und hatte gedacht, das wären die stärksten Empfindungen, die man für jemanden haben könnte. So war es bei Melanie gewesen, dem Mädchen, das ihr Nachhilfe gegeben hatte, bevor sie auf das Internat gekommen war. Sie hatten schnell herausgefunden, dass sie aufeinander standen, und hatten ihre gemeinsamen Stunden viel mehr damit zugebracht, sich verstohlen gegenseitig unter dem Schreibtisch zu befingern als zu lernen. Lisa hatte sie unglaublich süß gefunden, ihre leicht schrullige Art, ihr vielen liebenswerten aber merkwürdige Eigenheiten und wie sie es schaffte, gleichzeitig still und offen zu sein.Sie hatte sich immer darauf gefreut, Melanie zu sehen und die zeit mit ihr sehr genossen, aber es hatte ihr nicht das Herz gebrochen, als sie sich von ihr verabschieden musste, um in Zukunft im Internat zu wohnen. Lisa war eben gern unabhängig und hatte lieber so viel Spaß wie möglich, während sie ihre langweiligen Pflichten vor sich her schob.
Umso überraschter war sie gewesen, als sie festgestellt hatte, mit welcher Leidenschaft sie sich zu Lilly hingezogen fühlte. Plötzlich war da viel mehr gewesen als Zuneigung und eine sexuelle Spannung. Es hatte sie ganz unerwartet getroffen, aber auf einmal wäre sie bereit gewesen, Folter zu erdulden, um Lilly zu schützen, und immer, wenn sie nicht bei ihr war, kam die Welt ihr dunkler und einsamer vor. Sie war zu einem inhärenten Bestandteil ihres Lebens geworden, fast als wäre ihr gesamtes Wohlergehen von ihr abhängig. Wie sollte sie je wieder so etwas wie Freude empfinden, wenn sie nicht da war? Wie sollte sie lachen oder auch nur die grundlegendsten Verrichtungen des Alltags bewältigen? Sie mochte sich gar nicht ausmalen, wie es wäre, wenn Lilly erst fort war, und doch war sie nun gezwungen mitanzusehen, wie sie ihr genommen wurde.
Unomnia hatte Lilly nicht losgelassen, nachdem sie ihr hoch geholfen hatte, und so standen sie Hand in Hand da, beinahe wie Mutter und Tochter, nur dass die Mutter eben nackt war und die Tochter von einer Vielzahl blutiger Schnittwunden bedeckt war.
»Bereit?«, fragte Unomnia jetzt.
Lillys Blick streifte Lisa, die noch immer völlig aufgelöst war und die verquollenen Augen nicht von ihr abwenden konnte. »Moment noch«, sagte sie, beugte sich ein wenig vor, um den Arm nach Lisa ausstrecken zu können und streichelte ihr noch einmal sachte über die Wange, obwohl die mittlerweile so nass von Tränen war wie ein Sumpfgebiet nach einem Unwetter. »Mach dir keine Sorgen um mich«, flüsterte sie ihr zu, »ich komme schon klar. Und denk an mein Versprechen. Auch wenn wir jetzt Abschied von einander nehmen müssen, ist es nicht für immer. Nichts wird mich davon abhalten, wieder zu dir zu finden, keine Götter, keine noch so unüberwindbar scheinende Grenze zwischen den Welten und nicht einmal der Tod.«
Sie richtete sich wieder auf und sah die übrigen Mitglieder des Freak-Clubs an. Auch in ihren Gesichtern stand Fassungslosigkeit und Tränen in ihren Augen. Vermutlich sollte sie auch ihnen noch ein paar Worte widmen, irgendeinen Trost, etwas, das ihnen deutlich machte, dass es ihr ganz recht war, sich Lisa zuliebe diesem Schicksal zu ergeben, was auch immer das für sie bereithielt, oder zumindest ein Lebewohl, aber sie hatte keine Ahnung, was genau sie sagen sollte. Deshalb hatte sie damals bei ihrem fehlgeschlagenen Suizid auch keinen Abschiedsbrief hinterlassen; sie war einfach nicht gut darin, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Nun gut, in dem Fall war es ohnehin unnötig gewesen, ihre menschliche Mutter hatte auch so gewusst, was der Grund dafür gewesen war, und ihr noch einmal zu versichern, dass sie sie liebte, dazu war sie so kurz vor dieser Tat, mit der sie ihr nur noch mehr Leid aufbürdete, einfach nicht in der Lage gewesen. Letztlich hatte dieses Unvermögen auch dazu beigetragen, dass sie Goth geworden war. Die Menschen steckten einen eben gern in Schubladen, das ersparte ihnen die Mühe, sich mit ihnen befassen zu müssen, und wenn sie ein blasses, schwarz gekleidetes Mädchen mit schweren Stiefeln und übermäßig viel Metall wie Nietenbesatz und Ketten, die vom Gürtel hingen, sahen, erwarteten sie keine großen emotionalen Ausbrüche. Lilly hatte eben kein besonders fröhliches Naturell, sondern blieb im Allgemeinen sehr gefasst und zurückhaltend.
Sicher, sie besaß auch eine andere Seite, gerade im Umgang mit Lisa war sie kaum wiederzuerkennen. Bei ihr lachte sie viel, ja himmelte sie sogar regelrecht an, liebkoste sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit, küsste sie und strich ihr durch die Haare. Aber das war leicht, Lisa kannte sie bereits besser als jeder andere, bei ihr brauchte sie sich nicht zu verstecken, brauchte keine Angst zu haben, missverstanden zu werden oder sie mit irgendeiner unbedachten Äußerung gegen sich aufzubringen, sie würden immer zusammenhalten.
Natürlich war das bei ihren Freundinnen hier ähnlich, auch bei ihnen konnte sie ganz sie selbst sein, trotzdem konnte sie sich ihnen gegenüber nicht so öffnen wie Lisa. Bei ihnen war sie reservierter und ohnehin griff sie im Alltag oft auf Plattitüden zurück. Situationen, die ihr völlig fremd waren, machten ihr immer ein wenig Angst, und dies war eine von ihnen. So etwas hatte sie eben noch nie erlebt, und auch in den Büchern, die sie gelesen hatte – für sie immer eine wichtige Quelle von Informationen darüber, wie soziale Interaktionen gewöhnlicherweise abliefen, wenn man in dieser Hinsicht nicht so gehemmt war wie sie –, war das nie wirklich vorgekommen. In ihnen starben die Figuren meistens ziemlich plötzlich, und wenn sie doch einmal Zeit hatten für ein paar letzte Worte, hatten sie ihren Mitstreiterinnen wenigstens noch etwas Wichtiges mitzuteilen. Das war hier anders. Was hätte sie ihnen schon zu sagen, das sie nicht schon wussten?
»Tja«, begann sie schließlich unsicher, »und euch danke ich, dass ihr mich in euren Club aufgenommen habt, dass ihr mich willkommen geheißen habt … und ich bin froh, dass ich euch kennenlernen durfte. Jede einzelne von euch. Ich werde euch nie vergessen und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja auch noch mal wieder. Also … macht’s gut.«
Lilly versuchte, ihnen zum Abschied ein Lächeln zu schenken, scheiterte dabei aber kläglich. Es war seltsam, sogar jetzt noch, Sekunden bevor sie diese Welt verließ und es zumindest höchst fragwürdig blieb, ob sie je wieder mit ihren Freundinnen vereint würde, war es ihr noch immer wichtig, was sie von ihr dachten, und im Moment hatte sie das Gefühl, sich vor ihnen blamiert zu haben. Ihre kleine Rede wäre für jeden Anlass unzureichend gewesen, doch bei diesem ganz speziellen war sie bestenfalls lächerlich. Trotzdem war offensichtlich keiner der Anwesenden nach Lachen zumute. Sie alle blickten Lilly bloß mit rotgeränderten tränennassen Augen entgegen und ihre bebenden Münder formten traurige Erwiderungen, die zu einem unverständlichen Kanon in einem Requiem verschmolzen. Da war ihr Plan, sie zu beruhigen, wohl schiefgelaufen, aber sie bezweifelte, dass ein zweiter Anlauf irgendeine Verbesserung diesbezüglich darstellen würde. Wahrscheinlich gab es keine Worte, die das vermitteln konnten, was sie nun empfand. Wenigstens hatte sie ihr Bestes versucht, mehr konnte sie nicht tun. Wie es aussah, waren damit alle ihre verbliebenen Angelegenheiten geregelt, und es gab keinen Grund mehr, das Unvermeidbare noch länger hinauszuschieben.
Mit einem unvermittelt entschlossenem Ausdruck im Gesicht wandte sie sich an Unomnia und nickte ihr zu. »Okay, ich bin bereit.«
»Gut.« Unomnia nickte ebenfalls, aber das war es auch schon an Vorbereitungen. Sie schnippte nicht einmal mit den Fingern oder gab sonst irgendwie zu erkennen, dass sie ihre Kräfte einsetzte. Lilly merkte bloß plötzlich, dass es schon losging, als sie zu versinken schien wie in Treibsand. Sie konnte ihre Füße nicht mehr bewegen und der Boden kam ihr immer näher. Ein hastiger Blick nach unten bestätigte ihren Eindruck. Unter ihr hatte sich so etwas wie eine Teergrube aufgetan, in die sie nun Stück für Stück tiefer eintauchte. Sie erinnerte sich daran, wie Unomnia hier in Erscheinung getreten war, dass sie aus einem dichten Schatten in einer Einsenkung in der Wiese emporgestiegen war wie aus einem Brunnenschacht, und offenbar hatte sie vor, diese Welt auf dieselbe Weise wieder zu verlassen, wie sie in sie getreten war. Die materialisierte Dunkelheit umspülte Lillys Beine wie Meeresgischt, leckte langsam wie die Strömung steigender Flut an ihr hinauf und zog sie damit weiter hinab in die Finsternis.
Mittlerweile war Lilly bis zu den Knien in dem Schattenportal verschwunden, und alles, was darin steckte, konnte sie nicht mehr spüren. Das war so ähnlich wie damals, als sie sich die Pulsadern aufgeschnitten hatte. Da war es gewesen, als würde zusammen mit dem Blut auch jede Wärme aus ihrem Körper fließen. Es hatte sich ein Taubheitsgefühl in ihr ausgebreitet, und ihre Finger waren wie in Eiswasser getaucht gewesen, sodass es ihr vorkam, als würden sie gar nicht mehr zu ihr gehören, sondern als wären es unförmige kalte Stahlbolzen, die ihr ein wenig kunstfertiger Maschinenbauer an die Enden ihrer stumpfen Arme geschweißt hatte. So ähnlich war es jetzt auch, nur eben dass sie ihre Beine nun gar nicht mehr wahrnahm, als wären sie überhaupt nicht mehr da, und dass Dunkelheit um sie her schwappte, als würde sie in einer endlosen Nacht in das Meer hineinwaten. Fühlte es sich so an, zu sterben? Das stete Schwinden jeden Empfindens, bis irgendwann einfach alles aufhörte?
Falls dem so war, so hätte Lilly sich jedenfalls keinen schöneren Tod wünschen können. Immerhin war sie hier umgeben von allen, an denen ihr etwas lag, eine Trauergemeinde, die größer war, als sie je gedacht hätte. Wäre ihr der Selbstmord damals geglückt, wäre höchstens ihre Mutter zu ihrer Beerdigung gekommen. Freunde hatte sie nie wirklich gehabt, und außer ihrer Tante, die sie kennengelernt hatte, wusste sie auch von keiner weiteren Verwandtschaft. Doch sie hatte überlebt, und obwohl sie seitdem ihre Mutter verloren hatte, hatte sie eine ganze Schar an Freundinnen gewonnen, denen sie so viel bedeutete, dass sie sich hier an diesem lichtlosen Loch im Boden versammelt hatten, und weinend dabei zusahen, wie sie darin versank, als wären sie wirklich Gäste einer Bestattung, und vor ihnen würde der Sarg ins Grab hinabgelassen.
Sogar die Liebe hatte Lilly gefunden, womit sie immer am allerwenigsten gerechnet hatte. Nach dem, was Sinistra ihr angetan hatte, hatte sie sich nie vorstellen können, sich jemals zu verlieben, doch kaum hatte sie Lisa getroffen, war genau das geschehen. Sie liebte Lisa mehr als alles andere in der Welt, mehr als ihr eigenes Leben, weshalb sie es jetzt ja auch opferte, um das ihre zu retten. Für sie hätte Lilly schlichtweg alles getan; sterben war da noch das Geringste. Zwar zerriss es ihr das Herz, sie verlassen zu müssen und sie deshalb so leiden zu sehen, tränenüberströmt und die Arme um sich geschlungen, als müsste sie sich selbst festhalten, um nicht auf sie zuzustürzen und sich an sie zu klammern, aber letztendlich war es besser so. Eine von ihnen beiden musste schließlich gehen, und sie hätte es nicht aushalten können, wenn es Lisa wäre.
Außerdem war da noch die Tatsache, dass Unomnia bei ihr war. Es mochte komisch klingen, immerhin war sie dafür verantwortlich, dass sie sich nun von Lisa trennen musste, aber in diesem Moment von ihr an der Hand gehalten zu werden, gab ihr neue Kraft. Das lag zum einen natürlich an der Art der Berührung selbst. Die Wärme, die von ihr ausging, versprach einem Sicherheit und Geborgenheit, und darüber hinaus ließ sie einen unweigerlich eine gewisse Gemeinschaftlichkeit verspüren. Wohin sie auch gingen, sie würden auf jeden Fall gemeinsam dort anlangen.
Zum anderen war es Unomnias überraschend angenehme Präsenz. Sie hatte nichts Boshaftes an sich. Lilly verstand nicht, warum es ihr so wichtig war, die ihr gewidmeten Opfergaben in Empfang zu nehmen, vielleicht war das eine Sache, die Götter – oder eben die Spezies von der Unomnia abstammte – so machten, aber sie tat es nicht, weil sie irgendjemandem etwas zu leide tun wollte. Stattdessen strahlte sie etwas aus, das Antworten auf sämtliche offenen Fragen des Kosmos verhieß, bestanden doch alle Welten, ja das ganze Multiversum, fast nur aus Dunkelheit, und was sich Lilly in ihrer Gegenwart ebenso deutlich aufdrang wie die Strahlen der Sonne, war die untrügliche Essenz der Dunkelheit selbst. Neben ihr zu stehen war, als würde die Energie des Lebens an sich durch sie strömen. Ihre Funken sprangen auf Lilly über, flimmerten um sie herum und tanzten auf ihrer Haut wie Blütenblätter im Wind. Deshalb flogen ständig die Schatten auf Unomnia zu, wohin sie auch schritt; sie fühlten sich unwiderstehlich von ihr angezogen, weil sie in ihr den Ort ihrer Herkunft erkannten und sich wieder mit ihrem Ursprung vereinigen wollten.
Lilly war nie besonders gläubig gewesen, sie sah keine göttliche Fügung im Lauf der Dinge, einzig das Chaos einer zufälligen sinnlosen Existenz, aber an Unomnias Seite konnte sie zum ersten Mal das Konzept eines himmlischen Beistands nachvollziehen. Unomnia mochte sie ins Jenseits geleiten, an die fremdartigen unvorstellbaren Gestade ihrer eigenen Welt oder vielleicht war das Ende der Reise auch nur die bloße Auslöschung, nichts davon konnte ihr Angst machen und nichts davon würde sie auf ihrem Weg aufhalten zurück zu Lisa, dem Mädchen, das sie aus tiefster Seele liebte.
Die Schatten reichten ihr jetzt bis an den Hals, es war also nur noch eine Frage von Augenblicken, bis sie zumindest dieses Mysterium gelöst hatte, was das Schicksal noch für sie bereithielt, doch sah sie dem jetzt mit einiger Zuversicht entgegen. Für sie barg das Unbekannte keine Schrecken mehr. Früher hatte sie die Nacht gefürchtet; nicht die Dunkelheit an sich, doch hatten Sinistras Besuche immer erst am späten Abend stattgefunden, und so hatte Lilly oft wach gelegen und sich gefragt, ob ihr wohl heute wieder eine solche Qual bevorstand, während sich das Dunkel um sie herum angefühlt hatte, als wäre es die Wände einer viel zu engen Gefängniszelle, die immer näher rückten, bis sie sie irgendwann ersticken würden.
Doch das war nun vorüber. Nicht weil Sinistra tot war – diese Sünde lastete zu schwer auf ihrem Gewissen, als dass sie Erleichterung darüber hätte empfinden können –, sondern weil sie jetzt die Stärke gefunden hatte, sich zu wehren. Diese Stärke waren aber nicht die Fähigkeiten, die ihre dämonische Abstammung ihr verlieh, es war der Wille, niemals aufzugeben. Ihr Selbstmordversuch war eine Flucht gewesen, das erkannte sie nun, sie hatte sich einfach allem entziehen wollen und Erlösung im Vergessen gesucht, doch nun war sie fest entschlossen, für sich einzustehen und zu kämpfen. Sie würde sich nie wieder unterdrücken lassen, sie würde nicht hinnehmen, was nicht hinzunehmen war, sie würde frei und selbstbestimmt sein, und sie würde es mit allem aufnehmen, was sich ihr dabei entgegenstellte. Sie würde Mauern einreißen und Ketten sprengen, sie würde Ozeane überqueren und Berge erklimmen, sie würde Verantwortung für ihre Taten übernehmen und dasselbe von allen anderen einfordern, und vor allem würde sie am Ende wieder Lisa in die Arme schließen. Erst dann würde sie endgültig ihren Frieden finden.
Zufrieden mit dieser Aussicht holte sie noch einmal tief Luft, bevor die brodelnden Schatten des Portals über ihrem Kopf zusammenschlugen und sie vollständig verschluckten.
Lisa bekam schon gar nicht mehr mit, wie Lillys hochgwirbelten kinnlangen Haare noch einen Moment lang an der Oberfläche trieben, und sich die aufgewühlte Finsternis zu einer glatten schwarzen Ebene schloss, wo kurz zuvor noch ihre Freundin gewesen war; sie hatte rechtzeitig die Hände vor die Augen geschlagen und vergrub ihr vor Kummer erblasstes Gesicht in ihnen. Ihre Schultern bebten unter ihrer von Schluchzern erschütterten Atmung, und die Hände vor den Augen konnten ihren Tränen keinen Einhalt gebieten. Lisa spürte, wie sie zwischen ihren Fingern hindurchrannen und langsam ihre Wangen hinabliefen. Aber sie spürte auch, wie sich sanfte Arme um sie schlangen, und dankbar ließ sie sich in diesen dringend benötigten Halt fallen. Sie wusste nicht, wie lange ihre wackligen Knie sie noch hätten tragen können; wahrscheinlich wäre sie Sekunden später einfach eingeknickt und ohne ihren Sturz abfedern zu können hart auf dem Waldboden aufgekommen, wäre sie nicht so aufgefangen worden.
Es war Fantasma, wie sie am Rande bemerkte, an deren Halsbeuge sie sich nun ausheulte. Sie fest an sich drückend wiegte sie Lisa hin und her und streichelte ihr dabei beruhigend über den Rücken. Als auch noch Emma dazu kam und ihr von der anderen Seite die Schulter tätschelte, fiel ihr auf, dass das Licht um sie herum plötzlich heller geworden war. Es war, als hätte die ganze Zeit über eine undurchdringliche Gewitterwolke vor der Sonne gehangen, die nun vorübergezogen war, aber natürlich war das nicht der Fall. Da Lilly Unomnia nur an den Bauch gereicht hatte, brauchte die ein wenig länger, um in ihrem Dimensionstor zu versinken, und während sie das tat, zog sich auch die von ihr erschaffene Kuppel des Zwielichts immer weiter in dieses Portal zurück. Zugleich nahm Lisa ein Kribbeln an ihrer Hinterbacke wahr, genau dort wo Unomnias Mal eingeritzt war, und sie brauchte nicht erst die Hosen herunterzulassen und nachzusehen, um genau zu wissen, dass zusammen mit ihr auch diese Narbe verschwand.
Lisa hielt ihr Gesicht jedoch weiterhin in Fantasmas Umarmung verborgen, einerseits weil sie noch immer zu sehr zitterte, um alleine stehen zu können, und andererseits weil sie den Gedanken unerträglich fand, Unomnia noch einmal sehen zu müssen. Sie hatte ihr Lilly genommen, die Einzige, in die sie sich je hatte verlieben können, da wollte sie nicht auch noch dabei zusehen, wie sie sich davonmachte, ohne irgendwelche Konsequenzen fürchten zu müssen. Irdische Gerichtsbarkeiten konnten ihr ohnehin nichts anhaben, und was metaphysische anging war es doch äußerst zweifelhaft. Angeblich war sie ja unsterbliche, sodass sich diese Frage erst gar nicht stellte, und sollte sie tatsächlich eine Göttin sein, so war jeder ihrer Beschlüsse automatisch sakrosankt.
Jedenfalls dauerte es nicht lange, bis die letzten Reste dieser Urfinsternis, die Unomnias ständige Begleiterin zu sein schien, mit ihr in dem Tor verschwunden war. Das Licht war in die Welt zurückgekehrt, und die Wiese im Wald lag wieder so friedlich da wie zuvor: die Vögel zwitscherten, die Zweige der Bäume raschelten in einer angenehmen leichten Brise und die Sonne schien jetzt, als sie sich allmählich dem Horizont näherte, besonders hell zu strahlen, doch die Dunkelheit, die sich über Lisas Herz gelegt hatte, war nicht so leicht zu vertreiben. Sie ließ ihren Tränen freien Lauf, aber was blieb ihr denn auch anderes übrig? Sie hätte sich doch sowieso nicht beruhigen können, nun da die Liebe ihres Lebens von einer obskuren Gottheit als Opfergabe in einen Abgrund siedender Schatten hinabgezogen worden war.
Dennoch versiegten ihre Tränen irgendwann, auch wenn das wahrscheinlich bloß eine Schutzmaßnahme ihres Körpers war, um sie vor völliger Dehydration zu bewahren. Sie war immer noch von einem Gefühl unbändigen Verlusts erfüllt, als sie ihr Gesicht endlich von Fantasmas Schulter hob, an der sie unbehelligt vor sich hin geweint hatte. Niemand sagte etwas, während Lisa sich schniefend mit der Hand über die Augen fuhr, um die Nässe von ihnen zu wischen, und sich zu sammeln versuchte. Ihre Mienen waren von demselben Schrecken gezeichnet, der auch von Lisa Besitz ergriffen hatte, und auch sie mussten sich erst wieder fassen. Vermutlich sollte Lisa ihnen erst einmal Zeit geben, selbst damit klarzukommen, was sie gerade erlebt hatten, ihnen vielleicht sogar zu verstehen geben, dass sie es ebenfalls schaffen würde, dass sie diese Leere in sich, die sie von innen heraus zu verschlingen drohte, schon irgendwie würde bewältigen können, obwohl im Moment nichts darauf hindeutete, aber das schaffte sie nicht. Dazu ging ihr zu viel im Kopf herum, zu viele Unwägbarkeiten, die dazu führten, dass es ihr vorkam, als würde sich eine kaum auszuhaltende eisige Kälte in ihrer Brust ausbreiten, und so tat sie das, was sie immer tat, wenn sie eine Frage hatte, die nicht durch eine kurze Recherche im Internet zu klären war: sie wandte sich an Isabelle.
»Was …«, wollte sie gerade beginnen, doch versagte ihr sofort wieder die Stimme, die vom langen Weinen brüchig und rau geworden war, und sie musste sich erst kurz räuspern, bevor sie von Neuem ansetzen konnte. »Was glaubst du, ist jetzt mit Lilly?«
Natürlich war ihr bewusst, dass das keinen Zweck haben würde, immerhin hatte Lilly diese Frage vorhin auch schon Unomnia gestellt, und nicht einmal die hatte eine Antwort darauf geben können, aber sie konnte einfach nicht anders. Wie hätte sie denn irgendetwas anderes tun sollen, als wenigstens zu versuchen, irgendeinen Hinweis auf den Verbleib ihrer Freundin zu finden, mit den Mitteln, die ihr eben zur Verfügung standen?
Doch wie befürchtet konnte Isabelle ihr in dieser Sache nicht weiterhelfen. »Tut mir leid«, sagte sie entschuldigend, »ich … ich weiß es nicht.«
Aber irgendjemand muss doch etwas wissen«, beharrte Lisa. »Ich meine, Unomnia ist ja nicht wie andere Götter dafür bekannt, sich nie zu zeigen. Sie ist doch schon im Limbus gewesen, da muss sie doch ihren Anhängerinnen irgendwas sagen, ihnen versprechen, dass sie in den Himmel kommen, wenn sie sie verehren, oder so. Hat sie denn nicht so was wie eine Bibel, irgendjemandem das Wort Gottes diktiert? Verdammt, sie könnte sogar Kurse geben, wie man ihrer Lehre nach ein gutes Leben führt.«
»Ähm, ich glaube, genau das spricht die Dämoninnen an dieser Theologie so an, dass Unomnia eben keine strengen Regeln aufstellt, was sie zu tun und zu lassen haben. Sie bevorzugen es wohl, wenn sich da keine Autoritäten einmischen.«
»Aber gibt es nicht so was wie eine Mythologie?«
Langsam nickte Isabelle. Es war etwa zwei Jahre her, da hatten ihre beiden Mütter sie gefragt, ob sie getauft werden wollte oder sich sonst einer Konfession zuwenden wollte. Aus diesem Anlass heraus hatte sie sich ausgiebig mit den verschiedenen Religionen auseinandergesetzt, einschließlich der des Limbus, deshalb war sie in dieser Hinsicht einigermaßen bewandert, allerdings wollte sie ihre Forschungsergebnisse nur höchst ungern in dieser Situation an Lisa weitergeben. Nichts davon war dazu geeignet, ihren Schmerz zu lindern. Aber wie hätte sie da herumkommen können? Lisa hatte sie direkt gefragt, und Isabelle verabscheute es zu lügen, da wollte sie sie nicht mit irgendwelchen Ausflüchten abspeisen, zumal sie Lisas Verlangen nach Antworten nur zu gut nachvollziehen konnte.
»Nun ja, es ist so«, sagte sie dementsprechend, »dass bisher noch niemand von denen, die Unomnia als Opfer dargebracht worden sind, zurückgekommen ist, um davon berichten zu können, was dann mit einem passiert. Die Dämoninnen haben daraus zwei mögliche Schlüsse gezogen. Die Realisten behaupten, sie würden einfach sterben, und diejenigen, die sich eher zum Spiritistischen hingezogen fühlen, sind der Meinung, Unomnia würde sie in ihre eigene Welt mitnehmen, was praktisch ihren Vorstellungen vom Jenseits entspricht, den Ort, an den Dämoninnen eben kommen, wenn sie sterben, an dem sie von allen irdischen Fesseln befreit sind, aber aus dem es kein Zurück mehr gibt.«
Na toll, das half Lisa nicht unbedingt weiter. Nicht nur war das ziemlich genau das, was Lilly ihr darüber erzählt hatte, es war auch exakt dasselbe Narrativ, das alle Religionen für sich beanspruchten. Im Grunde war es ja sogar das, was man Kindern sagte, wenn ihr Hund starb: ›Er ist jetzt an einem besseren Ort, mit viel Auslauf, wo er unbeschwert herumtollen kann.‹ Da hatte sie ein wenig mehr von Isabelle erwartet. Allerdings gab es vielleicht doch noch etwas, wo sie mit ihrer Expertise etwas mehr Einsicht hatte als Lilly.
»Okay, aber hast du nicht vielleicht irgendeine Ahnung, was mit Dämoninnen oder Halbdämoninnen geschieht, wenn sie sterben?«
»Tut mir leid, die Dämoninnen haben nie so etwas wie die wissenschaftliche Methode entwickelt. Ich schätze, wenn man Schattenkräfte hat und das gesamte Multiversum bereisen kann, rückt das etwas in den Hintergrund, und ohne Daten kann ich keine Analyse erstellen … wobei es in diesem Fall ohnehin schwierig werden dürfte, Daten zu sammeln.«
»Und was ist deine persönliche Ansicht?«
Zögernd schürzte Isabelle die Lippen. Ihre Einstellung zu diesem Thema war klar. Sie hielt alle Vermutungen bezüglich eines Lebens nach dem Tod für Quatsch. Ihre Gedanken, ihre Gefühle, ihre ganze Persönlichkeit waren schließlich bloß ein paar elektrische Impulse in ihrem Gehirn, die mit ihrem Tod unwiderruflich vergingen, wie sollte da irgendein Teil von ihr bestehen bleiben und ewig in einer transzendentalen Welt weiterleben? Das waren für sie nichts als Märchen, die man Menschen erzählte, die nicht mit dem Umstand zurechtkamen, dass ihre eigene Existenz zwangsläufig enden würde, aber sogar Isabelle mit ihrem mangelnden Gespür für soziale Konventionen wusste, dass es nicht angebracht wäre, das jetzt so deutlich darzulegen.
Außerdem lag es gar nicht in ihrer Absicht, anderen ihren Glauben abzusprechen. Zwar waren Religionen für viel Leid verantwortlich – sie spalteten die Menschheit, legitimierten Gewalt mit dem angeblichen Willen Gottes, vertraten Homophobie und aus irgendeinem Grund lief es oft darauf hinaus, Frauen zu unterdrücken –, trotzdem stand es ihr nicht zu, darüber zu urteilen. Nun gut, der Glaube an ein Leben nach dem Tod war wirklich nichts weiter als Opium für das Volk; er verleitete dazu, sich mit Missständen abzufinden, statt sie zu bekämpfen, weil man immer dachte, dass man es irgendwann einmal sowieso besser haben würde, und so ließen sich die Massen leicht kontrollieren, aber er gab den Menschen eben auch Hoffnung. Isabelle wollte keinesfalls jemandem, der todkrank war, diesen letzten Strohhalm nehmen, an den er sich klammerte, und wie herzlos musste man sein, um jemandem, der mit einem Verlust zu kämpfen hatte, zu sagen, dass jede Aussicht auf Wiedervereinigung obsolet war? Nein, da war jetzt ein wenig mehr Taktgefühl gefragt, auch wenn sie dafür nicht ihre eigenen Überzeugungen verraten würde.
»Ähm, das möchtest du nicht hören«, entschied sie sich letztlich für die diplomatischste Antwort, die ihr einfiel.
»Hör nicht auf sie«, sagte Fantasma in einem ungewohnt sanften Tonfall. »Ich bin mir sicher, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, und egal wo Lilly jetzt ist, es geht ihr bestimmt gut.«
Langsam nickte Lisa, dann holte sie tief Luft und stieß sie seufzend wieder aus, wobei es ihr gerade so eben gelang, ein weiteres Schluchzen zurückzuhalten.
Sie hasste sich selbst ein wenig dafür, und obwohl sie ernste Zweifel hatte, je wieder ihren Alltag bewältigen zu können, musste sie sich dennoch den harten Fakten stellen, den Anforderungen, die ein Leben in der modernen Gesellschaft so mit sich brachte. »Ich denke, wir sollten dann mal zu Frau Flimm gehen und ihr alles erzählen. Wir werden wohl die Polizei rufen müssen, und sie wird uns sicher helfen können, uns eine Geschichte zurechtzulegen, die wir ihnen einreden können, vorzugsweise eine, in der keine dunkle Göttin auftaucht, der wir eine Mitschülerin geopfert haben.«
»Ja«, bestätigte Fantasma, »wahrscheinlich werden sie auch so schon nicht besonders erfreut sein, dass ein paar Monate, nachdem die Schulleiterin plötzlich spurlos verschwunden ist, auch eine Schülerin vermisst wird.«
Fantasma hatte die ganze Zeit über weiterhin ihren Arm über Lisas Schultern liegen lassen, als die mit Isabelle gesprochen hatte, und den nahm sie auch jetzt nicht fort, sondern führte sie so den schmalen Pfad durch den Wald entlang in Richtung Internat, dessen hell erleuchtete Fenster über den nun einsetzenden Sonnenuntergang hinweg strahlten. Dafür war Lisa ihr mehr als dankbar; sie war sich keineswegs sicher, ob sie es andernfalls überhaupt geschafft hätte, in das Haus zu kommen. Ihre Knie fühlten sich noch immer zittrig an und es kam ihr vor, als würde der Horizont vor ihr von einer Seite auf die andere schwanken, als würde sie an der Reling eines Schiffs stehen und auf das Meer hinausschauen. Hätte Fantasma sie nicht gestützt, wäre sie wahrscheinlich über jeden Stein und jede Wurzel, die den Boden durchbrach, gestolpert, doch so konnte sie für einen Moment die Verantwortung für sich selbst abgeben, sich einfach nur in die Umarmung ihrer Freundin schmiegend sich darauf verlassen, dass sie sich um sie kümmerte.
Nun, da sie sich in Fantasmas Obhut befand, und sie sich nicht darauf konzentrieren musste, den Weg ins Internat unbeschadet zu überstehen, schweiften ihre Gedanken unwillkürlich wieder zu Lilly und das Mysterium um ihr Schicksal ab. Lisa hatte nie wirklich darüber nachgedacht, ob es ein Leben nach dem Tod gab oder nicht. Sie hatte es immer als etwas unsinnig betrachtet, sich mit einer Frage zu befassen, die man ja doch nicht im Vorhinein lösen konnte, und deren Antwort einem zu einem gewissen Zeitpunkt von alleine zufiel. Warum sich also die Mühe machen und sich den Kopf über etwas zerbrechen, das einen noch gar nicht betraf? Das hätte sie schon früh genug herausgefunden, kein Grund also sich die Laune mit pessimistischen Vermutungen zu verderben, doch jetzt war das anders. Wo war Lilly? War Unomnia wirklich eine Göttin und hatte sie ins Paradies mitgenommen? Oder war sie gestorben und war in die eine oder andere Form des Jenseits eingegangen, je nachdem welcher Religion man glauben wollte? War sie vielleicht sogar wiedergeboren worden? Oder war mit ihr etwas ganz anderes geschehen, etwas, das noch niemand in Betracht gezogen hatte?
Lisa wusste es nicht. So weit sie damit vertraut war, konnte alles der Wahrheit entsprechen oder nichts davon. Sie wusste nur eines mit absoluter Sicherheit: Lilly war nie leichtfertig mit ihrem Wort umgegangen. Sie hatte noch nie ein Versprechen gebrochen, das sie Lisa gegeben hatte, und nun hatte sie sich sogar selbst geopfert, um es zu halten. Daraus ergab sich für Lisa die Gewissheit, dass sie auch jetzt nicht gelogen hatte. Sie würden sich wiedersehen, komme was wolle.
Lisas Gesicht war noch immer nass von den unzähligen Tränen, die sie vergossen hatte, und ihnen würden ohne Zweifel noch viel mehr folgen, dennoch schlich sich ein kaum merkliches Lächeln auf ihre Lippen, als sie mit neu entdeckter Hoffnung auf das Internat zuschritt. Lilly würde tun, was sie konnte, um zu ihr zurück zu kommen, und sie würde in der Zwischenzeit die Dinge für sie in dieser Welt übernehmen, ihr Verschwinden erklären und sich nicht unterkriegen lassen, denn so unvorhersehbar das Leben auch war, in dieser Hinsicht zumindest standen die Geschicke unauslöschbar festgeschrieben. Egal wie lange es dauerte, und egal wie unmöglich es auch scheinen mochte, irgendwann würden sie beide wieder vereint sein, und dann gab es keine Macht im Multiversum, die sie mehr zu trennen vermocht hätte.
ENDE